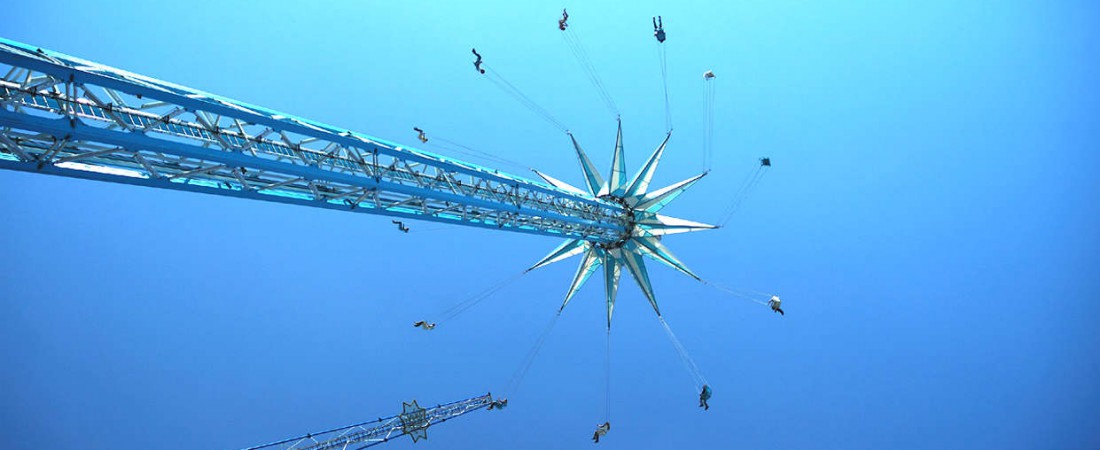Better than free: Strategien eines Webevangelisten
Die Botschaft einer vernetzten Kirche in Sinn und Form
Sinn und Form – das sind die Herausforderungen, denen sich die Kirche in den nächsten Jahren zu stellen hat. Nicht, dass sich nicht ihres eigenen Sinnes bewusst ist. Allerdings muss sich gefragt werden, wie dieser Sinn weiterhin vermittelt werden kann. Dass dabei auch das Lernen von der Umwelt eine Rolle spielt, ist evident. Ebenso wie es trivial ist, dass die Frage nach der ureigenen Substanz nicht mit der Frage nach der Form vermengt werden kann. Denn, so Bischof Claude Dagens von Angoulême: „Eine notwendige Befreiung besteht darin, die Kirche von der quälenden Sorge um sich selber zu befreien!“. Sowohl bei der Frage nach der Substanz als auch nach der sie vermittelnden und mit ihr gelebten Form muss es also um die Frage nach der „Kirche für Andere“ gehen – nur dies ist ihr Auftrag.
Beleuchten wir zuerst die Frage nach dem Sinn. Was die Kirche vermitteln will, ist klar. Die frohe Botschaft. Aber konnotiert sie diese mit den richtigen Parametern? Glaubt „man“ ihr?
Institutionen, die Glauben vermitteln wollen, aber ihre Glaubwürdigkeit verloren haben, sind tot. Die Glaubwürdigkeitskrise hat im Sommer 2010 insbesondere die katholische Kirche mit voller Wucht erfasst. Wenn Verkündigung und Zeugenschaft ein offensiver Charakter eignet, ist die Abwehr von Vorwürfen oder das öffentlich geäußerte Bemühen um Aufklärung dort, wo die Institution oder deren Vertreter gefehlt haben, ein absolut defensiver Vorgang. Das korrespondiert mit einer eh seit Jahren vorhanden Krise der Glaubensinstitution Kirche, die sich Säkularisierung, Pluralisierung und Patchworkreligiosität zu stellen hat. Was hat es zu bedeuten, dass ausgerechnet ein schwülstiges Pop-Projekt mit dem Namen „Unheilig“ den transzendentalen Soundtrack der Saison lieferte, und dies in hoher Auflage mit maximalem ökonomischem Erfolg:
Wir war’n geboren um zu leben,
mit den Wundern jener Zeit,
sich niemals zu vergessen
bis in alle Ewigkeit.Wir war’n geboren um zu leben,
für den einen Augenblick,
bei dem jeder von uns spürte,
wie wertvoll Leben ist.
Das Lied sei, so der Frontmann der Band Unheilig Bernd Heinrich Graf am 19. April bei Stefan Raabs „TV-Total“, eine „Hommage an das Leben“. Der Bandtitel ist eine Anspielung betont Graf im gleichen Interview, er sei ein „sehr gläubiger Mensch“, brauche dafür aber keine definierten Religionen. Wie ihm geht es garantiert Millionen von Zeitgenossen, seine Liedtexte bilden dem SZ-Magazin zu folge eine „perfekte Projektionsfläche“ (37/2010). Projektionsfläche hin, ökonomische Cleverness her. Die Verkaufszahlen des Albums gehen in die Hunderttausende und die spirituelle Sehnsucht ist groß, allein: sie geht an den Institutionen vorbei. Kevin Kelly, Mitbegründer des Internet- und Technologiemagazins „Wired“ einer der bekanntesten amerikanischen Zukunftsforscher hat im Jahr 2008 acht Punkte definiert, die die Grundlage eines sinnvollen Angebotes im Internet bilden sollen.1 Das Internet, so Kelly, sei an sich schon kostenlos verfügbar, deswegen brauche, wer Aufmerksamkeit erzeugen wolle, ein Angebot, dass besser als kostenlos sei, also einen Mehrwert für den Konsumenten bedeute. Das führt zur Definition immaterieller Werte, die es zu vermitteln galt, Werte, die den Menschen zusagen in einer Menge kostenloser Alternativen.
Kelly nennt diese Werte „generativ“. Ein „generativer” Wert ist nach Kelly eine generierte Eigenschaft, deren Vorhandensein kultiviert werden muss. Das Generativ ist für ihn einmalig und unverwechselbar.
Die ökonomischen Implikationen des Ansatzes haben uns in unserem Zusammenhang nicht zu interessieren. Allerdings zeugt die Formulierung der acht Punkte von genauer Beobachtung menschlicher Psyche und gesellschaftlicher Entwicklung. Gnade, so wissen wir, ist ebenfalls gratis und keiner Vorbedingung unterworfen und die Frohe Botschaft des Evangeliums ist ebenso jederzeit frei verfügbar. Dass viele Menschen eher einer „unheiligen“ Botschaft vertrauen, hat mir Glaubwürdigkeit zu tun und so vermag der Ansatz Kevin Kellys vielleicht einen Weg aus der Krise weisen. Wagen wir den Versuch der Übersetzung!
Unmittelbarkeit
Wenn Kirche unmittelbar wird, dann ist sie dem Individuum nah und in dieser Nähe auch erfahrbar, nicht anonymisiert. Das heißt, sie darf sich nicht in pastoralen Räumen verstecken. Wie dies möglich ist, dazu später mehr zur Form. Eindeutig aber ist, dass die Kirche in jeder Lebenslage erfahrbar und damit inhaltlich und geographisch erreichbar sein muss. Stellungnahmen können gelegen oder ungelegen sein, Dispens von Äußerungen auch zur gesellschaftspolitischen Themen gibt es nicht. Rückzug aus der Fläche auch nicht. Das heißt nicht, dass die Präsenz, wie sie heute besteht, weitergeführt werden muss; gefragt sind sicherlich neue Ideen. Dort, wo es personalen und räumlichen Kontakt gibt, darf er nicht abschreckend oder exkludierend wirken. Schon 1984 hat das Rolf Zerfaß in seiner „Menschlichen Seelsorge“ eindrücklich beschrieben. Leider gilt dies oft heute noch, wie erst vor einigen Jahren einige Ergebnisse der SINUS-Milieustudie bewiesen haben. Was Zerfaß „gastfreundliche Seelsorge“ nennt, bezeichne ich hier mit unmittelbar, barrierefrei (auch ästhetisch), erreichbar:
„Gastfreundliche Seelsorge ist aufnahmebereit. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir dies in der Bundesrepublik schon begriffen hätten. Zur Illustration zwei Beispiele: Auf dem Faltblatt am Eingang der St. Peter Church in der City von New York las ich im September 1979: ‚Dies ist Gottes Haus. Komm herein, mach es zu deinem! Die Leute von St. Peter laden dich herzlich ein, hier zu verweilen, um zu beten und nachzudenken. Du bist auf der Suche nach einem erfüllten Leben; verbünde deinen Glauben mit dem unseren.’ Beim Betreten der Marienkapelle in der City von Würzburg war zum gleichen Zeitpunkt zu lesen: ‚Die Marienkapelle ist ein Gotteshaus, kein Museum! Die Würde des Gotteshauses gebietet: Ehrfurcht, größte Ruhe, anständige Haltung! Umhergehen während des Gottesdienstes ist untersagt!’ Wie mag es einem Fremden gehen, der, vom überfüllten Marktplatz kommend, arglos den Fuß in diese Kirche setzt – und das sind viele Tausende in einem Jahr! Wir trommeln das Geld zusammen für kostspielige Renovierungen, aber dazu, dass, wie in den ärmsten romanischen Dorfkirchen Frankreichs, ein Tonband mit Flötenmusik aus dem Frühbarock den Eintretenden grüßt oder eine Choralmelodie ihm den Raum erschließt, dazu reicht unsere Fantasie nicht aus. Ungastlich ist auch der Eindruck beim Betreten eines durchschnittlichen Pfarrhauses – Pardon: Pfarrbüros. Falls man nicht vor dem überfüllten Schreibtisch der Sekretärin abgefertigt, sondern tatsächlich in ein Sprechzimmer hineinkomplimentiert wird, ist auch dies in aller Regel ein Ausbund an Ungastlichkeit: uralter, ererbter Wohnzimmertisch oder billigste Kaufhausstühle, gehäkelte Tischdecke oder Resopalplatte, stapelweise Heftchen, Bistumsblätter, Gotteslob, in der Ecke die Abziehmaschine für das Pfarrblatt; auf dem Tisch der überdimensionale Aschenbecher der Baufirma, die vor 15 Jahren das Kirchendach reparierte.“2
Personalisiert
Menschen sind individuell und sie müssen in der kirchlichen respektive seelsorglichen Zuwendung eben diese Individualität personal an sich erfahren können. Die Erfahrung der Zuwendung Gottes geschieht nicht durch raffinierte Internetseiten, Newsletter, Facebookprofile3, Anrufbeantworter oder Pfarrbriefe. Wir brauchen Menschen, seien sie haupt- oder ehrenamtlich, freiwillig oder bezahlt, die der Kirche ein Gesicht geben – ihr eigenes.
Interpretation
Ein schwieriger Punkt. Bei Kelly ist Interpretation ein Verdienstmoment in dem Informationen zwar zur Verfügung gestellt, die Hermeneutik aber kostenpflichtig wird. Auf die Kirche übertragen definieren wird Interpretation hier dergestalt, dass sie den Menschen Hilfen anbietet, mit den Informationen ihres eigenen Lebens umgehen zu gehören. Menschen an sich wissen trotz der Komplexität des Lebens gut über sich Bescheid. Oft fehlt aber das Vermögen (oder aber es gibt den durch Überforderung getrübten Blick), mit dem Wissen um das Selbst umzugehen, positive Entwicklungslinien auch in schwierigen Situationen umzugehen oder den eigenen Charakter lieben zu lernen. Hier liegt ein Anknüpfungspunkt für kirchliches Handeln bzw. kirchliche Angebote. In immer schwierigeren Zeiten braucht es Hilfestellungen zur Komplexitätsreduktion, zum Verständnis des eigenen Lebens (vor dem Hintergrund des unbedingten Angenommenseins durch Gott).
Authentizität
Für die Botschaft müssen Zeuginnen und Zeugen einstehen, authentisch handelnde Personen „Wirklich authentisches hat auch heute seine Faszination!“, sagt Bischof Joachim Wanke. Authentisch zu erzählen bedeutet, das Erzählen von dem, was erlebt, erfahren und bewegt wurde und sich damit in die Geschichte und die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft zu stellen. Authentizität ist nur personal erfahrbar (s.o.).
Zugänglichkeit
Kirchen, kirchliche Einrichtungen und ihre Vertreter müssen offen sein. Und zwar im wahren wie im übertragenen Sinn des Wortes. Dieser Punkt hängt eng mit den beschriebenen von Personalisierung und Authentizität zusammen. Während im Internet oder bei modernen Bauvorhaben Barrierefreiheit gefordert wird, ist dies im pastoralen Kontext kaum thematisiert. Was bedeutet der Schwellenabbau: Für die Sprache? Für die Kompetenz von Haupt- und Ehrenamtlichen? Für Gebäude? Für Medien? Für die „heißen Themen“ wie der Begegnung wiederverheirateter Geschiedener oder Homosexueller? Für Migranten und Asylbewerber?
Verkörperung
Was gelehrt und gesagt muss auch gelebt bzw. gefeiert werden. Eine (gute) Liturgie ist nicht nur theologisch die lebendige Verkörperung des Todes und der Auferstehung Christi sondern auch erlebbare Verkörperung der theologischen Substanz, der frohen Botschaft. Wir müssen mit den Zweideutigkeiten aufhören. Diese Forderung ist oft erhoben worden im Zusammenhang mit dem Aufdecken vieler Missbrauchsfälle der vergangenen Monate. Doch – und das muss kritisch angemerkt werden – sind die entscheidenden Schritte oft nicht gegangen worden. Der Weg der Verkörperung ist noch nicht zu Ende und muss weiter beschritten werden.
Patronage
Das Publikum so Kelly, ist bereit für ein Produkt, wenn es sich gut anfühlt, zu zahlen. Was die Institution angeht: Der Austritt wegen der Kirchensteuer ist oft ein vorgeschobener Grund. Wer sich mit Botschaft, Auftritt und Engagement der Kirche identifiziert, zahlt auch – weil es sich gut anfühlt und weil er oder sie sich als Teil der Solidar- und Glaubensgemeinschaft fühlt. Hier müssen Möglichkeiten der Mitsprache entwickelt werden, nicht nur für die „großen“ Kirchensteuerzahler. Die meisten derer in der Mittelschicht haben bisher keinen Einblick auf die Verwendung ihrer Kirchensteuermittel geschweige denn ein Mitspracherecht.
Auffindbarkeit
Auffindbarkeit bedeutet Erreichbarkeit (und korrespondiert deswegen mit den Punkten Personalisierung, Zugänglichkeit und Authentizität), Komplexitätsreduktion und daraus resultierende Erkennbarkeit und Profil. Auf die Zeichen der Zeit zu hören heißt ja nicht, sich dem Zeitgeist bis zur Unendlichkeit anzupassen. Was Aussagen des Evangeliums, muss deutlich gesagt werden.
Die Generative sind der Weg. Das Ziel muss klar sein und ergibt sich aus der Botschaft des Christentums, ihrem Ur-Generativ. Die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Kirche kulminiert letztlich in einer Aussage des Trägers des alternativen Nobelpreises 2010, Bischof Erwin Kräutler: „Wir brauchen kein neues Menschenbild, vielmehr ist es notwendig, aus den Erfahrungen der Vergangenheit und neuen wissenschaftlichen und empirischen Erkenntnissen eine zeitgemäße Sicht zu gewinnen, die zulässt, alle Menschen der Erde als Teil einer gemeinsamen Menschheitsfamilie betrachten zu können. Die vielzitierten ‚Hoffnungsträger für eine bessere Welt‘ sind damit alle Menschen, die ihre Verantwortung in und gegenüber der Gesellschaft aktiv wahrnehmen (wichtig ist das praktische Handeln). Der interdisziplinäre Austausch von Kunst, Wissenschaft und Religion kann mithelfen, das eigene Menschenbild zu finden. Dabei gilt es, darauf zu achten, die unveräußerliche Würde jedes einzelnen Menschen und die daraus resultierenden Rechte anzuerkennen.“4. Dies Zitat umfasst alle wesentlichen Wegweiser, denen die Kirche auch in der westlichen Gesellschaft folgen kann, um glaubwürdig die Botschaft zu verkünden und für jedem einzelnen Menschen seine ihm durch Gott kommende Würde und Einzigkeit zu vermitteln. Die klare Botschaft muss Liebe sein; im Mittelpunkt der Botschaft steht jeder Mensch mit seinen Freuden und Hoffnungen, Ängsten und Sorgen und besonders dem zentralen Wunsch, nämlich unbedingt angenommen und geliebt zu sein.
Bleibt die Frage nach der Umsetzung, nach einer möglichen Struktur dieser Botschaft. Liebe spatiologisch übersetzt bedeutet Nähe. Jegliche pastorale Struktur der Zukunft muss an einem Paradigma der Nähe orientiert sein und das gerade unter den gegebenen Bedingungen von Ent-Institutionalisierung, Säkularisierung und Individualisierung des Glaubens.
An dieser Stelle kommt der Begriff des Netzwerkes ins Spiel.
Wer früher von seinem Netzwerk sprach, meinte Menschen in der Umgebung, die man kennt und mit denen man in irgendeiner Weise privat oder beruflich verbunden ist. Das Online-Tagebuch Facebook behauptet von sich, zurzeit annähernd 500 Millionen Mitglieder zu haben, sozusagen die viertgrößte „Nation“ der Welt zu sein.
Soziale Netzwerke revolutionieren den Netzwerkgedanken. Mittlerweile ist es en vogue, auch die Veränderungen von Organisationen hin zu Netzwerke zu beschreiben.
Netzwerke zeichnen sich durch einen besonderen Charakter von unverbindlicher Verbindlichkeit aus. Tradierte Organisationen stehen vor dem Probleme geringer werdenden Bindungsbereitschaft. Gleichwohl ist die Suche nach einer Verbindung – neudeutsch Vernetzung – gegeben. Von daher mag es angesagt sein, auch im kirchlichen Rahmen von Netzwerken zu sprechen, die Kompetenzen und Wünsche der Beteiligten – Charismen, Freude und Hoffnung – mit einzubringen. Gemeinsam geht es, an einer Sache zu arbeiten und auch die Kompetenz (den Glauben, die Würde als Gotteskind, die Ermächtigung aus Taufe und Firmung) einzusetzen. Dies entspricht im Übrigen auch einem Ansatz, in der Pluralisierung von Religiosität heutzutage die Chance einer Art Dialektik der Offenbarung zu sehen, wie sie Gianni Vattimo beschreibt: „Die Heilsgeschichte ist nicht allein eine Geschichte derjenigen, welche die Botschaft empfangen, sie ist auch und vor allem Geschichte der Botschaft, für welche die Rezeption ein konstitutives und nicht nur akzidentielles Moment darstellt.“5 Insofern kommt religiösen Netzwerken als einer Plattform der gegenseitigen Glaubensvergewisserung eine hermeneutische und darüber hinaus zeugnishafte Funktion zu. „Gewiß ist die Kirche als Vehikel der Offenbarung wichtig, aber auch und vor allem als Gemeinschaft von Gläubigen, die in der Liebe als Caritas frei den Sinn der christlichen Botschaft hören und interpretieren, wobei sie sich gegenseitig unterstützen und sich also auch korrigieren.“6
Netzwerke sind nicht im Gegensatz zu Räumen zu verstehen, sondern in einer gegenseitigen Beziehung. Netzwerke gestalten Räume und Räume werden zu Netzwerken.7 Unter dieser Maßgabe kann auch die Gestaltung pastoraler Räume neu gesehen werden, nämlich als Haltung, nicht als Strukturmerkmal.
Wer die pastoralen Räume als Haltung sieht, wer sich nicht vorenthält, wer bereit ist, auch in kleiner Gemeinschaft vor Ort Kirche, Kirche der Nähe – eben in einem gemeinsamen Raum und durch diesen geprägt – zu sein, der lebt Glauben viel stärker, als jegliche Struktur dies möglich macht. Wer sich über die Zukunft der Kirche in Deutschland Gedanken macht, muss über den Grund zu leben und den Grund zu hoffen denken und sprechen. Überall. An jedem Ort. Als ganz persönliche Haltung und nicht als Struktur. Wenn wir aber über Struktur reden, dann muss es eine Struktur sein, die Nähe ermöglicht.
Pastorale Räume dürfen kein Strukturmerkmal sein, sondern müssen eine Einstellung werden, Vernetzungen zu fördern. Solange wir versuchen werden, Kirche zu „organisieren“, werden wir an den Gegebenheiten scheitern. Glauben lässt sich nicht organisieren, Glauben lässt sich nur leben. Und die Zeiten, da die Kirche eindimensional als Organisation betrachtet werden konnte, sind vorbei. Von Menschen, die mit Freiwilligen und Ehrenamtlern arbeiten haben wir gelernt, dass sich Menschen nur dann engagieren, wenn sie es aus freien Stücken tun, wenn die Kompetenzen geklärt sind, wenn Einsatzzeitraum und Einsatzumfang überschaubar sind und wenn man einen eigenen Benefit bekommt.
Wer die Kirche „organisieren“ will, wird an diesen Hürden scheitern. Angesichts der vorherrschenden Berufungskrise, der Finanzkrise und der Glaubenskrise Strukturen implementieren zu wollen, die Tradiertes – oder Überkommenes?- beibehalten, heißt, Menschen in ein Raster zu zwingen, in das sie womöglich nicht wollen. Das gilt für Ehren- und Hauptamtliche. Im Gegensatz zu diesen, können jene sich befreien und werden das auch tun.
Wer sich über das Fortbestehen des christlichen Lebens in unserem Land Gedanken macht, der darf nicht bei der Struktur ansetzen. Wer sich über die Zukunft des Christentums – und der Kirche als die Gemeinschaft der Glaubenden – Gedanken macht, muss nach der Hoffnung, der Sehnsucht und den Ängsten fragen. „Mit Recht“, so sagt die Konzilskonstitution Gaudium et Spes, „können wir annehmen, dass das künftige Schicksal der Menschheit in den Händen jener ruht, die imstande sind, den kommenden Generationen Gründe des Lebens und der Hoffnung zu vermitteln.“(GS) Wer sich über die Zukunft der Kirche in Deutschland Gedanken macht, muss über den Grund zu leben und den Grund zu hoffen denken und sprechen. Diese Erfahrungen, dieses Erleben und dieses Erzählen aber ist nur über Nähe mögliche. Pastorale Räume müssen Nah-Räume sein.
Wie ist das möglich umzusetzen? Einen Weg, der mich überzeugt, geht das Volk Gottes in der französischen Diözese Poitiers.
Das zentrale Element in der Pastoral der Erzdiözese sind die örtlichen Gemeinden (communautés locales). Ihre Bildung wirkt der Gefahr entgegen, dass sich die Kirche vom Lebensort der Menschen entfernt (und damit vom Leben der Menschen schlechthin) und seelsorgliche Präsenz am Ort sicherstellt. „Was wird jetzt aus uns, Herr Bischof?“8 wurde Albert Rouet direkt nach seinem Amtsantritt gefahren: „Die Kommunen auf dem Land hatten erlebt, wie Straßenbahnen und Nebenstrecken der Bahn stillgelegt und Busverbindungen ausgedünnt wurden […]. Postämter waren verschwunden. Einzelhändler in den Dörfern machten ihre Läden zu, Supermärkte zogen die Kunden in die Hauptorte der Kantone. […] Menschen ohne Fortbewegungsmittel haben das Nachsehen.“9 Ausgangspunkt war für Rouet die Frage: Welches Gesicht soll die Kirche haben?10 Für eine Pastoral, die den Menschen dient, ist deswegen Nähe (proximité) wichtig, Ausgangspunkt und Konzentrationspunkt der Pastoral ist die Gemeinschaft der Christen auf dem Land, in den Dörfern und den Stadtvierteln. Verbunden mit der Einrichtung der communautés locales ist eine neue Terminologie für die Strukturierung der Diözese. Man spricht nicht mehr von der Pfarrei, sondern von den pastoralen Sektoren (secteurs pastoraux). Albert Rouet wird im Frühjahr 2011 emeritiert, so ist nun geplant, die Sektoren als „Pfarreien“ kirchenrechtlich zu kanonisieren. Ein Sektor kann bis zu zehn Basisgemeinden umfassen. Mittelfristig soll ein Priester für einen Sektor zur Verfügung stehen.
Die Verantwortung in den örtlichen Gemeinden übernimmt eine Gruppe, die Équipe de base, Basisequipe, genannt wird. Die Équipe setzt sich aus fünf Personen zusammen:
- Die/der délégué pastorale als Leitung,
- ein trésorier, ein Kämmerer,
- jeweils ein/e Verantwortliche/r für Liturgie, Verkündigung und Caritas.
In dieser Aufteilung spiegeln sich die Grundfunktionen kirchlichen Lebens wider, das Gemeinschaft stiftende Element der Koinonia wird durch die Leitung repräsentiert. Jede dieser Basisequipen wird in einer symbolhaften Feier durch den Erzbischof bzw. den für die Region zuständigen Bischofsvikar in das Amt eingeführt. Die Verantwortlichen für die Sachbereiche werden von der Diözese ernannt, die beiden weiteren Mitglieder der Èquipe (délégué pastoral und trésorier) werden von der Gemeinschaft gewählt. Die Amtszeit beträgt drei Jahre, Wiederwahl für eine weitere Amtsperiode ist möglich.11 Jede/r Sachbereichsverantwortliche bildet wiederum eine thematisch orientierte Équipe, die ihn/sie in der operativen Arbeit unterstützt.
Die Basisequipe leistet einen Dienst an der lokalen Gemeinschaft. „In der Mitte der Menschen lebt und bezeugt die Gemeinschaft das Evangelium“, sagt Erzbischof Rouet. Die Basisequipe sieht sich dieser Mission verpflichtet. Es geht bei der Entscheidung für die Basis und gegen die Zusammenlegung zu Großpfarreien im Kern um das (missionarische) Glaubenszeugnis in der Nachbarschaft; man lässt im wahren Sinne des Wortes die „Kirche im Dorf“, damit sie niemand aus den Augen verlieren kann. „Konzentration auf das Zentrum zerstört die Peripherie, die Macht des Priesters wird größer und man gewinnt keine neuen Christen hinzu“ (Albert Rouet). Die communautés wollen Kirche des Petrus und des Paulus sein, Kirche am Ort und Kirche der Verkündigung und Mission.
Die Gründe für diesen Aufbau liegen in einer Grundsatzentscheidung für die Nähe. Da die territorialen Gegebenheiten eine wichtige kulturelle Rolle spielen und sich das Christentum als wesentlicher Teil der Kultur (Frankreichs) versteht, lag es nahe, alles daran zu setzen, diese Verbindung beizubehalten und zu pflegen.
Der Basisequipe entspricht auf der Ebene des pastoralen Sektors die Èquipe d’animation pastorale (EAP). Der Begriff ist kaum adäquat zu übersetzen, er intendiert die Koordination des Sektors ebenso wie die Animation, gleichsam die Be-Geist-erung der christlichen Gemeinschaft. Gemeinsam mit dem Pastoralrat des Sektors werden die Projekte im Bereich koordiniert.
Die Basisgemeinden sind nicht nur territorial zu verstehen, es gibt auch Gemeinschaften und Verbände wie z.B. die Katholische Aktion – die traditionell eine große Rolle im kirchlichen Lebens Frankreichs spielt – die eine communauté bilden.
Vom Weg der Kirche im Poitou zu lernen, bedeutet, einen Dialog zu führen, den Austausch mit den örtlichen Gemeinden zu pflegen und sich inspirieren zu lassen. Die wichtigsten Impulse sind der Mangel, der als Verheißung verstanden wird, die Pastoral des Rufens und die Verantwortung der Laien, befähigt durch Taufe und Firmung. Hier wird eine Kirche der Nähe ermöglicht, mit authentischen Zeuginnen und Zeugen. Das ist eine vernetzte Kirche, verbindend und doch nicht bindend geknüpft.
Nur wer selber begeistert ist, kann andere mitreißen. Das widerspricht jeglicher Planungslogik in deutschen (und vermutlich auch anderer Länder) Diözesen. Barack Obama hat die amerikanische Präsidentenwahl gewonnen, weil es ihm gelungen ist, die Politik zur Sache der Bürgerinnen und Bürger zu machen. Natürlich war das Internet hilfreich, Social Media, Web 2.0. Aber aus seiner Zeit als Streetworker und Communityorganizer wusste er vermutlich, dass sich Dinge zu ändern und entwickeln lassen, wenn alle mit im Boot sind, wenn alle bereit sind, den Staat, die res publica zu ihrer ganz eigenen Sache zu machen.
„Du bist Kirche! Auf Dich kommt es an!“ Das sind zweierlei Verpflichtungen. Für die Hauptamtlichen und besonders für leitende Hauptamtliche bedeutet das, Charismen wirklich anzuerkennen und fördern zu lernen. Und für jeden einzelnen Christ heißt das, sich in die Verantwortung nehmen zu lassen. Martin Buber hat einmal das elfte Gebot formuliert: „Du sollst Dich nicht vorenthalten!“ Sich nicht vorenthalten gilt für das Gebot der Nächsten- und der Gottesliebe. Und es gilt für alle in der Gemeinschaft der Glaubenden – ohne Ausnahme. Und es gilt in Sinn und Form. Was Kevin Kelley für das Netz beschreibt, ist die Frohe Botschaft seit zweitausend Jahren. Liebe ist gratis, better than free.
- Vgl. http://bewegliche-lettern.de/2009/08/kevin-kelly-besser-als-kostenlos-better-than-free/ am 22. Oktober 2010
- Rolf Zerfaß, Menschliche Seelsorge. Für eine Spiritualität von Priestern und Laien im Gemeindedienst, Freiburg u.a. 1985, 23-24.
- Wobei ich Versuche, im Web 2.0 pastorale Projekt aufzubauen, nicht kritisieren möchte. Vgl. dazu: Martin Lätzel, Freunde anstupsen. Pastoral und Social media?, in: Pastoralblatt 62 (2010), 242-246. Aber es reicht meines Erachtens nicht aus, n u r dort präsent zu sein. Und wenn, dann bedarf es auch hier der Personalisierung; es braucht Gesichter, die für das Facebook oder Twitterprofil stehen und bezeugen. Ein gutes Beispiel dazu liefert Dr. Werner Kleine, der die Citypastoral in Wuppertal leitet und dem es gelungen ist, die Themen seiner Arbeit mit seinem persönlichen Profil eindrucksvoll in diversen Social Media Networks zu verknüpfen.
- Zit. nach -Wort Nr. 40 vom 9. Oktober 2010, 3
- Gianni Vattimo, Jenseits des Christentums. Gibt es eine Welt ohne Gott?, München 2004, 42.
- Ebd. 17.
- Vgl. Franz Schregle, Pastoral in ländlichen Räumen – Wegmarkierungen für eine landschaftliche Seelsorge, Würzburg 2009, 171ff.
- Vgl. Reinhard Feiter / Hadwig Müller (Hg.), Was wird jetzt aus uns, Herr Bischof? Ermutigende Erfahrungen aus der Gemeindebildung in Poitiers, Ostfildern 2009.
- Albert Rouet, Auf dem Weg zu einer erneuerten Kirche, in: Ebd. 21., 17-42.
- Ebd. 22.
- Vgl. Serviteurs d’Evangile., Nr. 2226-2227. Einen ähnlichen Ansatz der Neustrukturierung unter Beibehaltung pastoraler Nähe verfolgt zurzeit das Bistum Lüttich (B). Dort regt die Diözese die Bildung von so genannten „Kontaktgruppen“ an. Deren Aufgaben bestehen im direkten Kontakt mit den Menschen der Ortsgemeinde, dem Knüpfen von Beziehungen, der Gestaltung des religiösen und solidarischen Lebens sowie der Sorge um ökonomische Angelegenheiten. Vgl. Église de Liége, Acta. Vikariat für die Pfarren: Die Kontaktgruppen, Lüttich – April 2004, 7.