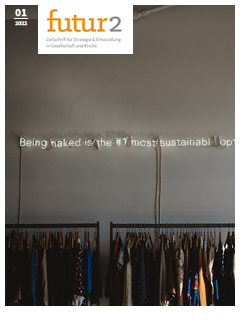Warum ändert sich nichts? Vermutungen über kirchliche Beharrungskräfte und ihre Überwindung
Frust gehört zu einem Grundgefühl in unserer Kirche. Warum das nicht (mehr) ankommt, was wir tun. Warum es immer weniger werden. Warum trotzdem mehr Arbeit anfällt. Es ist Sand im Getriebe. Warum ändert sich daran eigentlich nichts? Warum verpuffen die ganzen Kampagnen und Reformbemühungen? Warum bleiben die unzähligen Papiere, Beratungsprozesse und Think Tanks so wirkungslos?
Auf den verschiedenen Ebenen unserer Kirche wissen wir, wie hoch der Handlungsdruck ist – und in welche Richtung wir weiterdenken sollten. Es bleibt aber meist bei diesem Konjunktiv.
Natürlich tun sie das nicht. Aber am Grundgefühl ändern sie wenig. Wer länger ‚in dem Laden‘ arbeitet, sammelt eine gehörige Portion Frust. Weil sich zu wenig ändert. Warum ist das so?
An einem jedenfalls, so viel möchte ich vorab festhalten, liegt es nicht: An Erkenntnissen, Überlegungen und Ideen, an Beratungsprozessen, Symposien und Kongressen. Auf den verschiedenen Ebenen unserer Kirche wissen wir, wie hoch der Handlungsdruck ist – und in welche Richtung wir weiterdenken sollten. Es bleibt aber meist bei diesem Konjunktiv. Es mangelt nicht an Einsichten und Ideen, sondern an deren Umsetzung. Woran das liegen könnte, möchte ich im Folgenden erörtern – und am Ende schmale Schneisen in das Dickicht schlagen – Ideen, wie wieder Licht hindurchfallen könnte.
1) Pfadabhängigkeit. Beginnen möchte ich mit einem organisationstheoretischen Erklärungsmodell, dem der Pfadabhängigkeit. „Die Wandlungsfähigkeit von Organisationen wird systematisch überschätzt. … viele Publikationen schwärmen von ‚fluiden Unternehmen‘ und überhöhen das Internetzeitalter als Epoche organisationaler Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. So sympathisch diese Visionen sind, so neigen sie eben doch dazu, die systematischen Gegebenheiten von Institutionen falsch einzuschätzen.“1
Bewährte Praxis schränkt die Denkoptionen ein und verengt die Handlungsspielräume. Das imprägniert kirchliche Entscheidungsträger gegen wohlgemeinte Ratschläge des wachsenden Beraterschwarms.
Organisationen bleiben dagegen bei eingespielten Mustern: „Ein einmal eingeschlagener Weg – … ein etabliertes Geschäftsmodell … verfestigt sich und verengt zunehmend den Handlungsspielraum.“2 Bewährte Lösungen sind als solche auch nicht schlecht. Der Systemerhalt erfordert sie. Aber sie führen im Laufe der Zeit dazu, dass man andere Optionen nicht mal mehr prüft und so in eine Pfadabhängigkeit gerät, die bei sich rapide veränderndem Umfeld verheerende Folgen haben kann. Es sei hier nur an die Geschichte von Faber-Castell erinnert, die beharrlich an den Rechenschiebern festhielten: „Es werden immer wieder die gleichen Lösungen reproduziert, obwohl bessere Lösungen verfügbar wären“3 Es kommt zu einem Lock-In, einer strategischen Verriegelung, die auch durch einen x-beliebigen Tagesordnungspunkt auf einer Landeskirchenratssitzung, in dem man über Systemveränderungen debattieren möchte, nicht aufgebrochen werden kann. Der formale Rahmen einer solchen Sitzung, das Spiel der Akteure, der Duktus der Wortmeldungen – all das gleicht einem Bühnenstück, das immer und immer wieder aufgeführt wird – ganz egal, was inhaltlich vorgetragen wird.
Wie kommt es zu seinem solchen Lock-In? Dahinter steckt keine böse Absicht, kein reform-unfreundlicher Bischof, nicht der Widerstand des bornierten Establishments. Es sind oft die einzigen Muster, die den Handelnden zur Verfügung stehen! Die Pfadabhängigkeit stellt sich unbeabsichtigt und schleichend ein – durch permanente Wiederholung. Oft sind es kleine, zufällige Ereignisse, die so etwas begünstigen: ‚Der Bäcker in der Marienstraße hatte noch bis 19 Uhr offen. Dann habe ich eben das Brot dort gekauft und mache dies heute noch so.‘ Positive Rückkoppelungen (‚Meine Familie findet das Brot auch lecker.‘) oder Verstärkungen (‚Dort gibt es ein gutes Rabattsystem.‘) begünstigen die Einschränkung der Handlungsoptionen. Eine gewisse Dominanz von Lösungen verstärkt außerdem ihre Persistenz.
Bemerkenswert, dass es so etwas in der „idealisierten Welt der Rationalentscheidung gar nicht gibt, nämlich ein Festhalten an alten Lösungen, obwohl effizientere Alternativen möglich wären“4 Bewährte Praxis schränkt die Denkoptionen ein und verengt die Handlungsspielräume. Das imprägniert kirchliche Entscheidungsträger gegen wohlgemeinte Ratschläge des wachsenden Beraterschwarms.
Für die Reflexion pastoralen Agierens sollte seltener gefragt werden, was getan wird, sondern ob dies noch das Richtige ist.
2) Individuelle Trägheit. Dieser Punkt korrespondiert mit der ‚strukturellen Trägheit‘, wie die Pfadabhängigkeit auch genannt wird, und betrifft ähnliche Phänomene auf individueller Ebene. Da ist die Tendenz, beim Gewohnten zu bleiben und bei Veränderungsimpulsen auf emotionalen Widerstand zu gehen: „Das jetzt auch noch!“ Umstellungen sind anstrengend und fordern Energie. Man ist aber ermüdet und erschöpft. Und ich befürchte, dass viele Veränderungsstimuli gegen eine dicke Gummiwand bei kirchlich Mitarbeitenden prallen – und dort einfach veröden.
Das gibt man natürlich nicht zu, verschiebt das Ganze in eine AG oder zögert es hinaus („Wenn … erledigt ist, dann machen wir das mal!“). Auch inhaltliche Bedenken halte ich oft für eine Tarnung der persönlichen Schwerfälligkeit. Stützpfeiler dieses Phänomens sind zum einen unsere rechtliche, aber vor allem die finanzielle Sicherheit. Ich spüre Kolleginnen sagen: ‚Mein Gehalt kommt doch, pünktlich jeden Monat. Und mein Ruhestand ist auch nicht mehr weit: Was willst Du eigentlich?‘ Monetäre Sicherheit beruhigt und schläfert irgendwann ein.
Anstatt einer psychologischen Interpretation möchte ich hier eine theologische ins Spiel bringen: Karl Barth diagnostiziert eine anthropologische Trägheit, die versprochene Freiheit in Christus nicht zu ergreifen und „sich in der Niederung eines in sich verschlossenen Seins [zu] genügen“5 „Auch des Menschen Trägheit ist eine Gestalt seines Unglaubens“6, weil sie nicht der Aufrichtung des Menschen Jesu folgt und damit im Widerspruch zu der heiligenden Kraft Gottes steht.
Denn die Unterjüngung der Gemeinden, der Ehren- und Hauptamtlichen behindert Veränderungen. Neues hat es bei Überalterung schwer.
Der Mensch möchte in Ruhe gelassen werden. „Er hält die ihm in seiner Existenz angekündigte Erneuerung des menschlichen Wesens für unnötig.“7 Mündigkeit empfindet er als Zumutung und will sich stattdessen mit den Verhältnissen arrangieren. Man führt lieber ein „beschwerliches, aber auch bequemes, weil in sich gesichertes Sklavenleben“8, als selbst Verantwortung zu übernehmen.
Barth sieht eine protestantische (vielleicht auch deutsche?) Tendenz darin, diese Seite der menschlichen Schuld zu ignorieren – möglicherweise, weil hier etwas nicht geschieht. Wo es dagegen um den aktiven Menschen in seiner Hybris geht, der sich selber zum Aufrührer macht und herrschen will, da läuten die kleinbürgerlich-provinziellen Alarmglocken. Trägheit dagegen ist unverdächtiger.
Aber „der Mensch ist eben nicht nur Prometheus …, sondern … auch ganz einfach ein Faulpelz, ein Siebenschläfer, ein Nichtstuer, ein Bummler. Er existiert nicht nur in einem üblen Droben, sondern … auch in einem ebenso üblen Drunten. Er ist wie dort der Erniedrigung, so hier der Erhebung bitter bedürftig – und das im Blick auf seine Existenz und Lebenstat in ihrer Ganzheit.“9
Damit will ich nicht andeuten, dass die Mitarbeitenden in unserer Kirche faul sind. Sie machen eine ganze Menge; tagaus, tagein sind sie beschäftigt. Das Hamsterrad kennt jeder: Es geschieht viel vom selben, immer wieder. Und dabei kreist man um sich selbst. Für die Reflexion pastoralen Agierens sollte seltener gefragt werden, was getan wird, sondern ob dies noch das Richtige ist.
Wer leitet eine Kirche eigentlich? Und wie? Vielleicht kann man beschreiben, wer so ein System verwaltet. Aber wer es nachhaltig zu ändern vermag?
Die demografische Situation in unserer Kirche hätte eigentlich einen eigenen Punkt verdient. Denn die Unterjüngung der Gemeinden, der Ehren- und Hauptamtlichen behindert Veränderungen. Neues hat es bei Überalterung schwer. Doch ich behaupte, dass dieser Faktor nicht ursächlich, sondern nur verstärkend wirkt: Strukturelle und individuelle Trägheit sind ausgeprägter, ihnen kann noch schlechter begegnet werden.
Wenn mehr Pfarrerinnen im Ruhestand sind als aktiv, wenn das Durchschnittsalter der Mitglieder noch einmal 10 Jahre über dem der Gesellschaft liegt, provoziert dies schon die Frage, wie hier das eine Chance haben soll, wofür junge Menschen stehen: Fundamentalkritik und Neuanfang.
3) Steuerung komplexer Systeme. Für Veränderungen braucht es strategische Entscheidungen. Doch wer leitet die Kirche eigentlich? Und wie? Wer ist wofür verantwortlich zu machen? Das ist gar nicht so klar.
In diversen Spinnrunden werden oft ganze Füllhörner von Veränderungswünschen ausgeschüttet. ‚Wir müssten das – wir sollten das!‘ Und oft höre ich den verkappten Imperativ: ‚Macht doch mal!‘ Als wenn jemand einfach den Schalter umlegen könnte. Am besten ‚die da oben‘. Ich halte das für eine Projektion, eine gefährliche noch dazu.
Entscheidungen beruhen auf dem Konsensprinzip, deshalb fallen so wenige, die weh tun – also grundsätzliche.
Wer leitet eine Kirche eigentlich? Und wie? Vielleicht kann man beschreiben, wer so ein System verwaltet. Aber wer es nachhaltig zu ändern vermag? Ich weiß es nicht. Ich bin bisher nur so weit gekommen zu sagen, wer es nicht tut. Es ist nicht die Bischöfin, es ist nicht die Synode, es ist nicht die Kirchenleitung und auch nicht die Superintendentinnen. Es sind auch nicht Beschlüsse, Gesetzestexte und Gremien. Finanzen sind wichtig, aber ohne Menschen auch zahnlos. Es ist alles zusammen, so ein bisschen.
Landeskirchen lassen sich als polyzentrische Mehrebenensysteme beschreiben.10 Auf mehreren Ebenen existieren verschiedene Machtzentren. Dieses macht die Steuerung des Gesamten derart komplex und undurchschaubar, weil man Vorgänge tot legen kann, indem man sie von A nach B schiebt. Dann geht es beständig um das Austarieren der Gewalten, Interessen und persönlichen Präferenzen. Die Organverschränkung macht es kompliziert. Entscheidungen beruhen auf dem Konsensprinzip, deshalb fallen so wenige, die weh tun – also grundsätzliche. Diese sind strategisch unbedingt erforderlich. Im kirchlichen System haben Veto-Player leichtes Spiel und können mutige Schritte einfach blockieren – und damit triumphieren nicht selten niedere Beweggründe wie Neid, Narzissmus, Kränkung und sonstige Animositäten.
Das System blockiert sich häufig selbst – ganz unabhängig von den jeweiligen Akteuren. Einiges erinnert bei diesem Bild an die Europäische Union. Und richtig: Solange man einfach verwalten kann, läuft es einigermaßen gut, aber unter Veränderungsdruck wird die Dysfunktionalität eines solchen Systems frappierend offenbar.
Wie soll eine plural ausgerichtete Kirche, die Partizipation großschreibt, visionär und zielstrebig nach vorne geleitet werden?
4) Pluralität. Viele verschiedene Interessen, alle möglichen theologischen Richtungen und ethischen Grundüberzeugungen – die volkskirchliche Grundierung bleibt auch in einer kleinen Minderheitenkirche erhalten. Beschlüsse fallen nach dem Mehrheitsprinzip: Sie sind allerdings schon vorher so formuliert, dass sich niemand an ihnen stößt. Ecken und Kanten sind vorsorglich entfernt worden.
Jüngstes Beispiel: Die Verlautbarung der EKM-Landessynode zum Krieg in der Ukraine. Der Krieg wird verurteilt. Dieser Konsens, der ja auch eine breite gesellschaftliche Mehrheit findet, bestand unter den Synodalen. Aber wie damit umzugehen ist? Da tat sich die ganze Bandbreite auf. Von Pazifismus bis Lieferung schwerer Waffen – für alles gab es Befürworter. Insofern wird dieser Punkt im Papier einfach ausgelassen. Es wird lediglich festgestellt, dass dazu verschiedene Meinungen bestehen und der Wunsch nach Frieden alle eine.
Nun ist es wirklich eine hohe volkskirchliche Errungenschaft, dass man beieinander bleiben will. Aber: Wie soll eine plural ausgerichtete Kirche, die Partizipation großschreibt, visionär und zielstrebig nach vorne geleitet werden?
5) Enge Kirchenbilder. Die volkskirchliche Breite korrespondiert meiner Erfahrung nach nicht mit einer praktisch-theologischen Weite – sowohl bezüglich der Erfahrungen als auch der Kenntnisse. Hier herrscht eine beunruhigende Armut an Bildern, Vorstellungen und Erfahrungen – wie Kirche auch gehen kann.
Die meisten kennen nur die eigene, regionale Kirchenwirklichkeit. Praktika im Ausland? Infragestellungen aus der Ökumene? Inspiration aus Begegnungen mit Freikirchen? Gespräche mit weltlichen Organisationen mit ähnlichen Herausforderungen? Das alles findet viel zu selten statt. In welche Richtung sich Kirche entwickeln lässt – dafür fehlt vielen schlicht die Vorstellung. Die inneren Bilder, die Gerüche und der Geschmack, wie Kirche zu sein hat, sind durch unsere jahrhundertealte Tradition so verengt, dass wir auch gedanklich und emotional die Pfadabhängigkeit nicht aufbrechen können.Zuspruch von göttlichem Trost wirkt beklemmend und schnell aufgesetzt, merkwürdig aus der Zeit gefallen und übergriffig.
6) Verunsicherung und Zweifel. Ich beobachte eine tiefe Scham – ob bei Haupt- oder Ehrenamtlichen – von Gott zu reden und den eigenen Glauben zu thematisieren. Das Problem ist dabei weniger, dass man nicht weiß, wie es geht, als die Peinlichkeit, die mit der persönlichen Frage nach Gott assoziiert ist. Zuspruch von göttlichem Trost wirkt beklemmend und schnell aufgesetzt, merkwürdig aus der Zeit gefallen und übergriffig. So driften selbst die Zeugen am liebsten schnell wieder davon ab.
In Seelsorge-Settings gilt die Regel, Gott nicht ins Spiel zu bringen, wenn ihn das Gegenüber nicht zuerst benennt. Wenn das passiert, weicht man gern auf vorformulierte Worte aus: Gebete – Psalmen – Lieder. An sich ist das eine wunderbare Idee. Aber sind sie nicht persönlich untersetzt, können sie wie Floskeln wirken – und verstärken nur die Befremdlichkeit der Situation.
Im Newsletter unseres Gemeindedienstes war als Auftakt zu lesen: „Der Ausblick auf Ostern gibt Hoffnung, uns und der Welt.“ Es sind solche indikativischen Sätze, die in mir Beklemmungen auslösen. Klar, sie sind theologisch korrekt und viele Predigten sind voll von ihnen. Aber leider wirken sie für mich oft wie Ruinen. Sie strahlen nicht von innen und atmen Ängstlichkeit – als müsste man sich dies selber immer wieder sagen, um noch daran glauben zu können.
Aktionismus dominiert unser Handeln. Eine Kampagne jagt die nächste. Mit eigenen Anstrengungen wollen wir uns aus dem Sumpf ziehen. Vielleicht ist das alles ein Widerhall unseres Zweifels …
Die Boten Gottes sind selbst weitgehend verunsichert. Ich halte den Zweifel deshalb für einen der ungehobenen Schätze in Kirche und Theologie. Wer redet schon darüber unter den Hauptamtlichen? Mit der Ordination sollte das Bekenntnis doch spätestens feststehen. Anstellung und Verantwortung zementieren die einmal gewonnenen Glaubenssätze: „Wir müssen Antworten geben. Dafür werden wir bezahlt.“ Profichristen können sich keine Zweifel leisten.
Und wie sieht es im Herzen wirklich aus? Welche Worte berühren unsere eigene Sehnsucht noch? Wenn wir uns darüber austauschten, gewönnen wir eine neue Ehrlichkeit. So entstünde ein Raum der Freiheit und eine Vollmacht für das, was wir dann zu sagen haben. Ich glaube, unser kirchliches Zeugnis muss noch über den Jordan gehen.
7) Die Frage nach dem Subjekt. Eigentlich ist es eine protestantische Ur-Feststellung, die in Diskussionen schon den Rang einer Plattitüde einnimmt, weil jeder innerlich nickt und im Alles-klar-Modus innerlich abwinkt: „Kein Mensch baut die Kirche, sondern Christus allein. Wer die Kirche bauen will, ist gewiß schon am Werk der Zerstörung.“11 Aber handeln wir danach? Planen wir das ein? Baut unsere Kybernetik auf dieser Voraussetzung auf? Nach meiner Erfahrung nicht. Aktionismus dominiert unser Handeln. Eine Kampagne jagt die nächste. Mit eigenen Anstrengungen wollen wir uns aus dem Sumpf ziehen. Vielleicht ist das alles ein Widerhall unseres Zweifels bzw. der theologischen Austrocknung, dass doch mehrheitlich das Gefühl herrscht: ‚Wir müssen es richten und die Dinge in die Hand nehmen.‘ Ich vermute, dass wir uns in Reformanstrengungen, Erprobungen und Kirchenentwicklung schnell übernehmen, wenn wir diese theologische Selbstverständlichkeit vergessen. Denn es ist nicht nur eine Frage des Kausalzusammenhangs, sondern des Überlebens: Folgen wir Gottes Handeln? Oder denken wir dann doch, weil wir so smart sind, Gott müsste unserem folgen und bestätigen, was wir so alles machen? Vielleicht ist auch das ausbleibende Handeln Gottes bzw. die fehlende Erfahrung dieses Handelns der Grund, warum sich so wenig verändert.
Kirche wird indirekt, subversiv und kreativ gesteuert. Mit einer großen Portion Gelassenheit. Diese Kunst müssen wir noch stärker lernen – und praktizieren.
Erfahrungen von Dysfunktionalitäten und ausbleibenden Veränderungen führen zu Frust. Dieser Frust kann eine zynische Form annehmen und zu innerer Emigration führen. Dann ist er Teil eines Ausbrennens und lähmt. Eine energetische Variante von Frust kann allerdings auch zur Triebfeder von Veränderungen werden. Ratlosigkeit lässt ausprobieren und wird so kreativ. Genau dieses erlebe ich an vielen Stellen. Menschen haben erkannt: ‚Depressionen und Trauer führen auch nicht weiter. Wir gehen spielerisch mit den Blockaden um.‘
Und das funktioniert. Erprobungsräume beruhen auf diesem Prinzip. Neue Ansätze in Kirchengemeinden auch. Nicht selten starten sie neu, neben den eingetretenen Pfaden und folgen anderen Logiken (ad 1). Verheißungsvoller ist es, mit denen voranzugehen, die etwas wollen – und sich nicht an denen abzuarbeiten, die blockieren (ad 2). Institutionen bieten immer Nischen. Ihre Stabilität ermöglicht, im Windschatten der Aufmerksamkeit etwas aufzubauen. Und Verantwortliche lassen sich durchaus dafür gewinnen, solche kritischen Ränder zuzulassen und sogar zu fördern (ad 3). Wenn man volkskirchliche Weite ernst nimmt, ermöglicht sie durchaus profiliertes Arbeiten – allerdings neben anderen (ad 4). Studienreisen, Praktika und Narrative zeigen einen starken Effekt auf verengte Leitvorstellungen (ad 5). Ehrlichkeit und Authentizität schaffen eine Atmosphäre, in der Ängste und Zweifel geäußert werden können (ad 6). Gebet, Besinnung und theologische Grundsatzarbeit orientieren theologische Fehlstellungen (ad 7).
Sicherlich hätten diese Punkte eine ausführlichere Schilderung verdient. Sie sollen nur andeuten: Auf die lähmenden Blockaden kann man reagieren, meist erfolgt dies kreativ, voran tastend, um die Ecke denkend und durch das Einspielen einer Außenperspektive. Kirche lässt sich nicht steuern wie ein Auto, Visionen nicht eins zu eins umsetzen. Kirche wird indirekt, subversiv und kreativ gesteuert. Mit einer großen Portion Gelassenheit. Diese Kunst müssen wir noch stärker lernen – und praktizieren.
- Georg Schreyögg, In der Sackgasse. Organisationale Pfadabhängigkeit und ihre Folgen, in: Organisationsentwicklung 1(2013), 21-30, hier 21.
- Ebd.
- A.a.O., 22.
- Ebd.
- Barth, Karl, Kirchliche Dogmatik IV,2, 423.
- A.a.O., 455.
- A.a.O., 458.
- Ebd.
- A.a.O., 454.
- Ich danke Jürgen Gimmel für diese Interpretation.
- Bonhoeffer, Dietrich, Predigten – Auslegungen – Meditationen, Bd. 1: 1925-1945, hg. v. Otto Dudzus, München 1984, 375f.