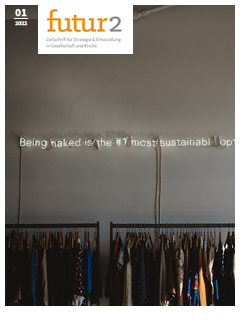Staying with the trouble. Theologie der Diversität im Anthropozän
Die moderne westliche Denktradition, die gerade auch in ihren Abgrenzungen eng mit christlichen Narrativen verflochten ist, hat viele positive Errungenschaften hervorgebracht: liberale Demokratien, individuelle Freiheiten (auch Religionsfreiheit), Wohlstand und Menschenrechte. Zugleich wissen wir heute aber um die damit verbundenen Ungerechtigkeiten und Widersprüche. Globaler Kapitalismus und christliche Mission sind aufs engste mit dem Kolonialismus und dessen Macht-, Denk- und Ausbeutungsmustern verbunden. Der Lebensalltag in Deutschland ist jenseits aller guten Absichten unentrinnbar Teil einer Lebensweise, die als „das Andere“ deklarierte Menschen, Tiere und planetare Ressourcen für das Funktionieren der eigenen Normalität ausbeutet. Nicht zuletzt aufgrund digitaler Medientechnologie wissen viele Menschen um all das und entwickeln vernünftige, auf Transformation und Veränderung ausgerichtete Haltungen.
Trotzdem bleibt der Eindruck, dass zu viel einfach so bleibt, wie es ist. Wie kommt man vom Wissen ins Handeln, und in welches Handeln? Armin Nassehi versteht das seit einiger Zeit als soziologische Wendung der Theodizee-Frage1: von „wie kann ein guter Gott das Böse zulassen“ zu „wie kann die Menschheit so viel Leid zulassen, wo sie doch so viel über die Ursachen und deren Lösung weiß.“ Autoritäre Regierungen, neoimperiale Kriege, globale Ungleichheit und die planetare Klimakrise stellen die alte Frage nach Gottes Handlungsmacht heute als immanentes Problem der Handlungsmacht des Menschen angesichts unberechenbarer Komplexität von Gesellschaft und den damit verbundenen Ökosystemen. Nassehi meint, heute werde die Handlungsmacht der Menschen überschätzt und die Komplexität der global verflochtenen Gesellschaft unterschätzt. Dipesh Chakrabarty geht hier noch einen Schritt weiter und bezeichnet unsere Lage als „planetar“ verflochten.2 Denn das Globale einer anthropozentrischen (und kapitalistischen) Globalisierung müsse heute mit dem Planetaren (Bruno Latour spricht auf ähnliche Weise vom „Terrestrischen“3) als das ganz Andere der geologischen Tiefenzeiten, der Kohlenstoffkreisläufe und ökosystemischen Kippunkten zusammengedacht werden.
Die Handlungsmacht der Menschen wird überschätzt und die Komplexität der global verflochtenen Gesellschaft unterschätzt.
An dieser Stelle bekommt das interdisziplinäre Gespräch von Praktischer Theologie mit den Sozial- und Kulturwissenschaften nicht allein handlungsbezogene, sondern zugleich epistemologische Bedeutung für Theologie und Kirche. Dort herrscht überwiegend die hart errungene, theologisch aufgeklärte Vorstellung, die soziale Welt baue sich vor allem aus den begründeten Absichten und der Handlungsmacht freier Subjekte auf, so wie Gott vor allem mit dem persönlichen Glauben oder der Konfessionszugehörigkeit der Einzelnen verbunden wird (methodischer Individualismus). Und eben nicht nur dort: Wie oft kommen einem Texte, Keynotes und Talks zu Gesellschafts- und Klimawandel selbst ein wenig vor wie Predigten, die primär das Gewissen der Einzelnen ansprechen sollen? Doch die auf Vernunft, Bewusstsein und Intentionalität der Person abzielenden Appelle betreffen eben nur einen Teil der Wirklichkeit. Wie Harald Welzer schreibt, „der weitaus größere Teil unserer Orientierungen, der über Routinen, Deutungsmuster und unbewusste Referenzen – soziologisch gesprochen: über den Habitus – organisiert ist, bleibt davon völlig unberührt“4. Es ist deshalb nicht immer hilfreich, wenn die Klimakrise in pastoralen Zusammenhängen auf individuelle moralische Entscheidungen reduziert wird. Es geht um einen politischen Struktur- und Kulturwandel, bei dem bereits die Rahmenbedingungen den Einzelnen im Alltag ermöglicht, Teil der Lösung zu sein. Damit wird es zu einer sehr umfassenden und auch empirischen Frage „was eine Transformation der mentalen Infrastrukturen eigentlich bedeutet“5, wie es also zu kollektiv wirksamen Musterunterbrechungen kommen kann.
Als Theologe beschäftige ich mich zwar grundsätzlich mit Diskursen und Praktiken katholischer Theologie und Kirche, tue das aber mit dem weiten Horizont, wie diese verwoben sind in die „Ereignisse[n], Bedürfnisse[n] und Wünsche[n], die es zusammen mit den übrigen Menschen unserer Zeit teilt“ und was in dieser Verwobenheit mit der ganzen Schöpfung dann wohl „wahre Zeichen der Gegenwart […] Gottes sind“ (GS 11). Wobei „gaudium et spes“ hier treffend vorsichtig formuliert, nämlich jede zu einfache Identifizierung von Gott und Welt meidend, es handle sich um ein gemeinsames „Bemühen“ im Vertrauen (Glauben), dass Gottes Geist den Erdkreis erfüllt – Gott also mit der ganzen Schöpfung in Verbindungen steht.
Die ontologische Unterscheidung von Natur und Kultur führt nicht weiter, wenn uns im Meer unser Mikroplastik entgegenkommt.
Genau hier aber zeichnen sich große Umbrüche ab. Seit einigen Jahren bezeichnet „Anthropozän“ die naturwissenschaftliche „Einsicht, dass der Mensch tiefgreifend und im globalen Maßstab die Ökologie des Planeten verändert“6. Seit der Erfindung des Feuers und der Sesshaftigkeit, seit der Industrialisierung, seit der globalen Freisetzung atomarer Radioaktivität, seit der Entdeckung von Mikroplastik im pazifischen Mariannengaben (die Definitionen sind hier verschieden), ist der Mensch zu einem Faktor in den kosmischen Zeitverläufen planetarer Entwicklung geworden. Die ontologische Unterscheidung von Natur (als durch Gesetze festgelegt) und Kultur (als Ergebnis menschlicher Entscheidungsfreiheit) führt dann nicht weiter, wenn uns im Meer unser Mikroplastik entgegenkommt und Naturkatastrophen nicht mehr ohne menschlichen Einfluss analysiert werden können. Für die Theologie heißt das etwa: Die scholastische Unterscheidung zwischen „malum physicum/naturale“, als menschenunabhängiges und nur auf Gott als Schöpfer (Theodizee) zurechenbares Übel, und dem „malum morale“, als Schuld rein menschlicher Freiheit, geht an der Problemlage vorbei.
Anthropozän bedeutet, im Bereich der Natur(wissenschaften) konstitutiv mit dem Faktor Mensch zu rechnen und im Bereich des Menschen konstitutiv mit dessen nicht-menschlichen Vorrausetzungen und Verbindungen zu Mikroben, Pflanzen, Tieren, Atmosphären etc. Thomas Ruster fasst die anstehenden, theologischen Musterunterbrechungen so zusammen:
„Die Störungen, die aus dem Anthropozän auf die Theologie eindringen, können nicht mehr in der Form der Unterscheidung zwischen dem guten und allmächtigen Schöpfergott auf der einen Seite und den durch die Sünde des Menschen verursachten Übeln und Leiden auf der anderen Seite verarbeitet werden. Gott ist nicht unbehelligt von Übeln des Anthropozän. Und auch nicht unbeteiligt an ihrer Entstehung, jedenfalls wenn man die Schöpfungserzählungen der Bibel so interpretiert wie bisher. Auch die exklusive Unterscheidung zwischen den Menschen und den übrigen Geschöpfen ist nicht mehr praktikabel. Der Mensch steht der Natur nicht gegenüber wie das Politbüro den Wirtschaftsbetrieben. Die Schöpfungstheologie muss transformiert werden.“7
Ruster nennt einige weitere Unterscheidungen, deren orientierende Kraft als kategoriale Einteilungen erlischt: Schöpfer/Geschöpf, Transzendenz/Immanenz, Gott/Mensch (als Krone der Schöpfung), Geist/Materie. „Die Orientierung, die diese Unterscheidungen einst gaben, hilft nicht mehr, die Welt zu verstehen. Die Aufgabe der Transformation in der Theologie geht sehr weit.“8
Die Theologie ist dabei weder allein, noch auf verlorenem Posten. Die Ansätze eines „Neuen Materialismus“ etwa bei Bruno Latour, Donna Haraway, Karan Barad oder Rosi Braidotti gehen basal von hybriden Verbindungen aus, von Verflechtungen, Netzwerken und Dynamiken, in denen Menschen wie auch nicht-menschlichen Akteuren Handlungsmacht (Agency) zugesprochen wird. Donna Haraway schreibt in „Staying with the trouble“: „Wir alle auf Terra leben in unruhigen Zeiten, in aufgewirbelten Zeiten, in trüben und verstörenden Zeiten. […] Die Aufgabe besteht darin, sich entlang erfinderischer Verbindungslinien verwandt zu machen und eine Praxis des Lernens zu entwickeln, die es uns ermöglicht, in einer dichten Gegenwart und miteinander gut zu leben und zu sterben.“9 Die Musterveränderung eines planetaren ökologischen Denkens lautet: Wir müssen nicht die Natur retten, sondern unser Verhältnis zu ihr verändern, so etwa Mithu Sanyal.
In all dem „trouble“ war und ist das kirchliche Christentum nicht nur Teil der Lösung, sondern auch Teil des Problems: Teil der ökologischen Krise mit dem hierarchisch missverstandenen Schöpfungsauftrag, sich die allein für den Menschen als Krone geschaffene Erde untertan zu machen, und Teil des Aufstiegs von kolonialem Kapitalismus mit dem imperial verstandenen Missions- und Wachstumsimperativ von Mt 28,19, zu allen Völkern zu gehen und alle Menschen zum kirchlichen Glauben zu bekehren. Pastorale Transformation heißt deshalb nicht einfach „mehr desselben“, sondern Selbsttransformation der christlichen Tradition hin zu vielfaltsfreundlichen Ideen des Zusammenlebens verschiedener Menschen untereinander und mit allen nicht-menschlichen Wesen und Dingen.Wir müssen nicht die Natur retten, sondern unser Verhältnis zu ihr verändern.
Dazu wären aber vor allem jene kirchlichen Einheits- und Reinheitsmuster zu unterbrechen, die das heute notwendig vermischte, verbundene und ereignishafte Denken und Handeln oft blockiert haben.10 Wenn ich bei Vorträgen oder Gesprächen im kirchlichen Rahmen auf gelebte Vielfalt hinweise, dann erlebe ich fast automatisch die Reaktion: Aber wo bleibt dann die Einheit? Fällt dann nicht alles auseinander? Ist dann alles erlaubt? Vielfalt wird katholisch oft als Abfall von der richtigen Ordnung der Dinge verstanden – es bringt einfach viel durcheinander.
Richtig ist sicherlich, dass es hier um existenzielle Kontraste geht, die man nicht einseitig auflösen kann. Das Leben ereignet sich in der Spannung von Einheit und Vielfalt, von Ordnung und Chaos, von Eindeutigkeit und Mehrdeutigkeiten. Die Kirche löst diese Spannungen aber zu oft in nur eine Richtung auf. Einheit, Eindeutigkeit und Ordnung scheinen unproblematische (Ideal)Zustände zu sein, während mit Vielfalt, Mehrdeutigkeit und Vermischungen irgendetwas nicht stimmen kann.
Das Leben ereignet sich in der Spannung von Einheit und Vielfalt, von Ordnung und Chaos, von Eindeutigkeit und Mehrdeutigkeiten. Die Kirche löst diese Spannungen aber zu oft in nur eine Richtung auf.
Den hier zentral anstehenden Musterwechsel bringen neuere Lesarten vom Turmbau zu Babel noch einmal theologisch auf den Punkt. Babel gilt weithin als Symbol für den Fluch der Vielfalt als Wirrnis. Die Geschichte aus Genesis 11 beginnt damit, dass Menschen an einem festen Ort lebten und eine einheitliche Sprache hatten: „Dann sagten sie: Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis in den Himmel! So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen“ (V. 4). Traditionell steht die Höhe der Turmspitze für die Anmaßung der Menschen, wie Gott sein zu wollen. Gott bestraft die Menschen für ihre vertikale Hybris „nach oben“, in dem er eine ideale Einheit und Ordnung zerschlägt, sie über den ganzen Globus und in viele Sprachen verstreut. Die Menschheit ist seither dazu verdammt, ihrer ursprünglichen, idealen Einheit nostalgisch nachzutrauern: paradise lost, welcome to Babel.
Zunächst hatte der Bibelwissenschaftler Jürgen Ebach im Kontext der Globalisierungsdebatte aber noch einmal genauer gefragt: Warum greift Gott hier überhaupt ein? Und dann zeigt sich, Gott scheint wegen der Höhe des Turms gar nicht so besorgt und auch nicht, dass die Menschen ihm seinen Rang streitig machen könnten.11 Es wird erzählt, wie Gott herabsteigt, sich das alles ansieht und sagt: „Seht nur, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle. […] Und der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde.“ Der kritische Punkt in der Erzählung liegt in der Einheit und Einheitlichkeit, mit der sich das Volk „einen Namen machen will“, sich also als machtvolles Zentrum versteht. Gott vervielfacht die Sprachen und zerstreut die Menschen über die Regionen der Erde weniger als Strafe, sondern um die gottgewollte Vielfalt der Schöpfung neu zu bestätigen: Das ist der Punkt! Aus biblischer Perspektive liegt das Problem in dem, was uns katholisch so erstrebenswert scheint: alles in ein stabiles Einheits- und Ordnungskorsett zu stecken, in eine Sprache, auf einen einzigen, homogenen Ort, also die horizontale Hybris „zentralistischer Einheit“ der „Menschenkinder“.
Marianne Moyaert begründet mit dieser Lesart der Babel-Erzählung ein diversitätsfreundliches Verständnis von interreligiösem Dialog. Dem traditionellen Verständnis ist die babelhafte Vielfalt der (Welt)Religionen ein Ärgernis, zumal wenn man diese als quasi unübersetzbare „religiöse Sprachen“ versteht. Moyaert greift die gerade skizzierte Sicht von Babel als ein Segen von Diversität auf und schreibt: „Indeed, Babel shows itself to be a blessing both for creation and for intercultural and interreligious communication.“12 Das scheint in der traditionellen Lesart paradox, macht heute aber Sinn. Für Moyaert ist Babel nicht das Ende der Kommunikation im Chaos, sondern der Beginn: Jetzt müssen und können Menschen beginnen zu übersetzen, miteinander das Leben neu auszuhandeln und die verschiedenen Regionen des ganzen Planeten zu bewohnen. Dabei sind Einheit und Vielfalt nicht per se gut oder schlecht, beides kann destruktiv sein. Problemtisch aber ist es, wenn Einheit mit Macht hergestellt werden soll auf Kosten des Vielfältigen. „The unity of humanity, that comes about at the cost of its cultural diversity is disagreeable to God. God´s intervention implies that linguistic and cultural diversity is part of the human condition, which is blessed by God.”13 Die Zeichen und Spuren Gottes finden sich deshalb nicht allein in der eigenen, abgeschlossenen religiösen Identität, die im Babel-Narrativ ja gerade aufgebrochen wird, sondern im Dazwischen, im scheinbar Anderen und Unverständlichen.
Der in Ghana geborene, in England studierte und in den USA lehrende Emmanuel Lartey liest die Bestätigung von Diversität im Babel-Narrativ wiederum als post- und dekoloniale Theologie. Gott greift ein, um Vielfalt zu ermöglichen, denn die „göttliche Absicht, die hinter der Diversität aller Schöpfung steht, war in Gefahr geraten: die Existenz von ‚gegenseitigen Kontrollen‘ oder ‚geteilter Macht‘, von vielen verschiedenen Stimmen, die gehört werden können, und von einer Vielzahl möglicher Kulturen, die angenommen werden können“14. Der aus westlicher Perspektive lange erstrebenswerte Zustand von Einheitlichkeit verbindet sich in der Perspektive des Globalen Südens mit Strukturen und Erfahrungen der Kolonialisierung. Eine einheitliche Sprache und Lebensweise war in Babel für viele verschiedene Menschen verbindlich, so wie die europäischen Kolonisatoren ihre Sprache, ihre Lebensweise und ihre christliche Religion den Regionen des Südens aufgezwungen haben.
„Einfach gesagt: Gott bevorzugt die Vielfalt. […] Gott bleibt nicht tatenlos angesichts der hegemonialen Kontrolle durch irgendeine menschliche Gemeinschaft. […] So können wir die postkoloniale Absicht Gotte als solche vielleicht am klarsten in der Verwirrung (babel) der Sprachen jenes Volkes erkennen. Die Sprache, eins der hervorragendsten Merkmale von Kultur und Politik, wird diversifiziert, und wird als solche zum Symbol für Gottes konterhegemoniale und pluralisierende Aktivität.“15
Um einen für Menschen bewohnbaren Planeten zu bewahren, darf Theologie wohl nicht mehr zuerst von den Bedürfnissen des Menschen allein ausgehen. Nötig wird die Weiterentwicklung der modernen anthropologischen Wende zu einer kommenden umfassenderen, planetaren Schöpfungstheologie. Die wird nicht mehr als göttlich-kausale Ordnungstheorie und nicht mehr anthropozentrisch gedacht werden dürfen. Anders als das Globale bezieht das Planetare geohistorische Horizonte, Biodiversität und alles Materielle mit ein (Chakrabarty). Nicht nur der Mensch allein ist Ebenbild Gottes (ohne selbst Gott zu sein), die ganze Schöpfung ist es. Staying with the trouble führt zu einer erneuerten Theologie der Diversität und Verbundenheit im Anthropozän.Nicht nur der Mensch allein ist Ebenbild Gottes, die ganze Schöpfung ist es.
- Vgl. Armin Nassehi, Unbehagen. Theorie der überforderten Gesellschaft, München 2021.
- Vgl. Dipesh Chakrabarty, Das Klima der Geschichte im planetaren Zeitalter, Berlin 2022, hier v.a. Kap. 3 und 8.
- Vgl. Bruno Latour, Das terrestrische Manifest, Berlin 2018 und die theologische Auseinandersetzung von Christian Bauer, Theologie der Erde? Umrisse einer terrestrischen Rede von Gott, in: Daniel Bogner / Michael Schüßler / ders. (Hg.), Gott, Gaia und eine neue Gesellschaft. Theologie anders denken mit Bruno Latour, Bielefeld 2021, 115-160.
- Harald Welzer, Selbst denken. Eine Anleitung zum Widerstand, Franlfurt/M. 2013, 64f.
- Welzer, Selbst denken, 65.
- Eva Horn / Hannes Bergthaller, Anthropozän zur Einführung, Hamburg 2019, 9.
- https://www.feinschwarz.net/2021-das-transformationsjahr/.
- https://www.feinschwarz.net/2021-das-transformationsjahr/.
- Donna Haraway, Unruhig bleiben. Die Verwandschaft der Arten im Chtuluzän, Frankfurt/M. 2018, 9.
- Vgl. dazu Regina Ammicht Quinn, Ordnungen und das Außer-Ordentliche. Die Diversität von Lebensformen und Identitäten als Frage nach Reinheit, in: ZPTh, 37 (2017), H. 2, 115–128, online: URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6:3-zpth-2017-21245.
- Vgl. Marianne Moyaert, A „babelish World” (Genesis 11, 1-9) and its Challenge to Cultural-Linguistic Theory, in: Horizons 36 (2009), H. 2, 1-20, 11.
- Moyaert, A „babelish“ World, 9.
- Moyaert, A „babelish“ World, 18.
- Emmanuel Lartey, Der postkoloniale Gott. Ein Paradigmenwechsel für die Praktische Theologie, in: SaThZ 19 (2015), 9-23, 2015, 11.
- Lartey, Der postkoloniale Gott, 12.