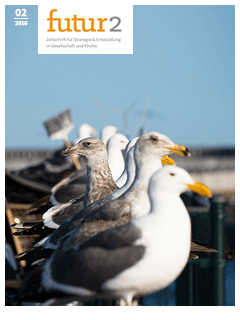Ausgestoßen aus der Gemeinschaft – Formen und Funktionen der Exkommunikation in mittelalterlichen Gesellschaften
Abbruch sozialer Bindungen
Im Christentum spielt die Gemeinschaft der Gläubigen eine zentrale Rolle, ja man kann sie sogar als Wesenselement des christlichen Glaubens bezeichnen. In der Tradition christlicher Kommunitäten steht jedoch auch das gegenteilige Verfahren – die Ausgrenzung aus der Gemeinschaft, die Exkommunikation. In den Gesellschaften des Mittelalters erfolgte sie dann, wenn ein Gläubiger gegen die Normen der Religion verstoßen hatte. Der Missetäter wurde vom gemeinsamen Gebet und allen heilsspendenden Handlungen ausgeschlossen. Ebenso galt für alle Christen ein Kontakt- und Verkehrsverbot. In diesem Zusammenhang ist bereits die Semantik des Worts Exkommunikation (lat. excommunicatio) bemerkenswert. Dieser Terminus, der erstmals im 4. Jahrhunderts belegt ist, stellt das Gegenteil von Gemeinschaft (communio) und wechselseitiger Interaktion (communicatio) dar, also jener Begriffe, die soziale Bindungen und Handlungen zum Ausdruck bringen. Die einschlägigen Sammlungen des Kirchenrechts seit dem 11. Jahrhundert weisen ganz konkret darauf hin, dass mit Worten, durch das Gebet, mit Speisen und Trinken sowie durch den Kuss (gemeint ist der Friedenskuss) „kommuniziert“ werden könne. Das Kommunikationsverbot ist also nicht im modernen Sinne auf einen verbalen Informationsaustausch reduziert, sondern umfasst alle wichtige Aktivitäten, durch die die religiöse Gemeinschaft begründet wurde.
Eine wichtige Funktion erfüllte der Ausschluss vom gemeinsamen Speisen und Trinken. In vielen menschlichen Gemeinschaften steht das Speisen und Trinken metaphorisch für die Begründung und Aufrechterhaltung sozialer Bindungen. Oftmals begründete das gemeinsame Mahl nicht nur den Zusammenhalt einer Gruppe, sondern es hielt ihn in regelmäßigen Abständen aufrecht. Die Grundlage für diese Sanktionsmaßnahmen im Rahmen der Exkommunikation findet sich im Matthäusevangelium (Mt 18, 15–18). Wer sich eines Fehlverhaltens schuldig gemacht und trotz zweimaliger Ermahnung unter vier Augen und nochmaliger Zurechtweisung im Beisein der gesamten Gemeinde keine Besserung erkennen lässt, solle wie ein „Heide und Zöllner“ behandelt, d. h. der christlichen Kommunität verwiesen werden. Eine ähnliche Vorstellung der Zurechtweisung, die eine Besserung des Delinquenten zum Ziel hat, ist in den Paulusbriefen zu fassen. Hier findet sich nicht nur der Ausschluss aus der Tischgemeinschaft, sondern ebenso die Möglichkeit der Reintegration (1 Kor 5,9–11; 2 Thess 3,14; 2 Kor 2,5–11; 2 Thess 3,6–15). Dass der Exkommunizierte aus der Speisegemeinschaft ausgeschlossen werden sollte, diente daher nicht seiner ‚Aushungerung’, sondern war Ausdruck seiner Isolation.
In den Gesellschaften des Mittelalters erfolgte Exkommunikation dann, wenn ein Gläubiger gegen die Normen der Religion verstoßen hatte.
Stufen der Exklusion
Bereits seit Papst Gregor dem Großen († 604) unterschied man zwei Arten der Exklusion: die die „medizinale oder kleinere Exkommunikation“ und die „mortale oder größere Exkommunikation“. Erstere hatte insofern einen medizinalen Charakter, als sie zum einen den Delinquenten zur Besserung und Genugtuung anhalten, ihn also ‚heilen‘ und in die Glaubensgemeinschaft zurückführen sollte. Zum anderen wurde sie zum Schutz vor Ansteckung im Sinne der moralischen Unversehrtheit der übrigen Christen verhängt. Diese Maßnahme konnte jedoch nur dann greifen, wenn zuvor sämtliche Formen von Ermahnung und Zurechtweisung ausgeschöpft waren, so dass die Exkommunikation nicht nur wegen eines Delikts selbst, sondern auch wegen der Widerspenstigkeit des Missetäters erfolgte. Der Delinquent sollte zunächst im Geheimen zurechtgewiesen, dann vor Zeugen getadelt und zuletzt in der Versammlung der Kirche öffentlich zur Rede gestellt werden. Wenn der Missetäter diese drei Ermahnungen negierte, sollte er aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Daher war die Exkommunikation das letzte Mittel der Zurechtweisung, wenn alle anderen Maßnahmen versagten. Ziel der „medizinalen Exkommunikation“ war die „Heilung“ des Delinquenten, also die Reintegration in die Gemeinschaft. Sie konnte dann erfolgen, wenn sich der Ausgeschlossene gefügig gezeigt und die erforderliche Genugtuung in Form von Bußleistungen erbracht hatte.
Die „mortale oder größere Exkommunikation“, die auch als Anathem bezeichnet wurde, sollte hingegen zum unwiderruflichen Ausschluss führen.
Die „mortale oder größere Exkommunikation“, die auch als Anathem bezeichnet wurde, sollte hingegen zum unwiderruflichen Ausschluss führen. Die Rede ist hier von der „tödlichen“ Exkommunikation, weil dem Missetäter so die Aussicht auf ein ewiges Leben versagt werden und er sofort dem ewigen Seelentod zum Opfer fallen sollte. Diesem Verfahren liegt die Vorstellung zugrunde, dass der Tod nicht nur ein biologisches Phänomen ist, sondern ebenfalls durch die kulturelle Praxis einer Gesellschaft bestimmt wird. So stirbt ein Mensch als physisches Individuum den biologischen Tod; gleichzeitig stirbt er als Mitglied einer sozialen Gemeinschaft. Biologischer und sozialer Tod können dabei deckungsgleich sein, aber auch auseinander treten. Und zwar dadurch, dass einerseits biologisch Lebende wie bereits Verstorbene behandelt werden können, indem jegliche Bindung zu ihnen abgebrochen wird. Andererseits kann aber auch der physische Tod als vermeintliche Zäsur ignoriert und die Verbindung mit den Verstorbenen weiterhin aufrecht erhalten werden, so dass die Lebenden und die Toten eine Gemeinschaft bilden. Diese Gemeinschaft nach dem Tod konkretisierte sich in den mittelalterlichen Jahrhunderten vor allem durch das Gebetsgedenken, das integrativer Bestandteil der Frömmigkeitspraxis war.
Riten und Symbolik
Sie hielten brennende Fackeln oder Kerzen in den Händen, die sie während der Zeremonie zu Boden warfen oder sogar mit den Füßen austraten.
In den Sammlungen des frühmittelalterlichen Kirchenrechts findet sich der Hinweis, dass beim Ausspruch dieser „tödlichen“ Exkommunikationssentenz um den Bischof zwölf Priester standen. Sie hielten brennende Fackeln oder Kerzen in den Händen, die sie während der Zeremonie zu Boden warfen oder sogar mit den Füßen austraten. An dieser Stelle ist der Hinweis wichtig, dass Sterbenden, die nicht exkommuniziert waren, eine brennende Kerze in die Hand gegeben wurde. Dieser Brauch, der ursprünglich aus der klösterlichen Sterbekultur stammt, symbolisierte die Hoffnung auf das ewige Leben. Die Kerze war sinnfälliger Ausdruck der Vorstellung, dass der physische Tod eine Durchgangsstation auf dem Weg des Daseins bildete, das im Idealfall im ewigen Leben endete. Die Zerstörung der Kerze bei der Exkommunikation war daher insofern einem ähnlichen Denken verpflichtet, als sie die Aussicht auf das ewige Leben vernichtete und dies sinnfällig mit der Auslöschung des Lebenslichts zum Ausdruck brachte. Die Kerzen spielten indes nicht nur bei der Exkommunikation, sondern auch im Rahmen der Rekonziliation eines Sünders eine wichtige Rolle. Seine Wiederaufnahme in die Gemeinschaft konnte – etwa bei der öffentlichen Buße – dadurch erfolgen, dass man die Kerze in seiner Hand wieder anzündete. Die nun wieder brennende Kerze symbolisierte die Rückkehr zum Leben und die Wiederaufnahme in die heilspendende Glaubensgemeinschaft. Wie zentral das Auslöschen der Kerze für das Verständnis der Exkommunikation war, belegt die Tatsache, dass diese Handlung erstmals in den Sammlungen des frühmittelalterlichen Kirchenrechts begegnet und bis ins 14. Jahrhundert belegt werden kann. Ausschließlich für die spätmittelalterlichen Jahrhunderte überliefert ist schließlich eine weitere Form, die auf die visuelle Wahrnehmung ausgerichtet ist: das Werfen von Steinen beim Ausspruch der Exkommunikation. Hier liegt die Interpretation nahe, dass eine symbolische Parallele zur Todesstrafe der Steinigung gezogen wurde, die im Alten Testament vor allem für Delikte vorgesehen war, die sich gegen Gott selbst richteten – wie etwa Gotteslästerung (Lev 24.14; 1 Kön21, 10-14) oder Götzendienst (Dtn 17,4).
Über den Tod hinaus
Mit dem Verlust des Begräbnisses war auch das Band zwischen den Lebenden und Toten gerissen.
Die „mortale oder größere Exkommunikation“ ging jedoch noch einen Schritt weiter. Denn dem so Bestraften wurde nach seinem Tod die christliche Bestattung versagt. Mit dem Verlust des Begräbnisses war auch das Band zwischen den Lebenden und Toten gerissen. Diese Gemeinschaft nach dem Tod zielte vor allem auf das Gebetsgedenken ab, das ein wesentlicher Bestandteil der mittelalterlichen Frömmigkeitspraxis war. In den Klöstern wurden etwa entsprechende Verzeichnisse derjenigen angelegt, für deren Seelenheil der Konvent zu beten hatte. Bezeichnenderweise nannte man diese Codices in einigen Klöstern „Buch des Lebens“ (Liber vitae), und zwar analog zur Vorstellung, dass Gott ein ähnliches Buch führe. Nach der Offenbarung des Johannes seien im göttlichen Liber vitae diejenigen verzeichnet, die die ewige Seligkeit nach ihrem Tod erwarte. Dieses Buch solle beim Jüngsten Gericht aufgeschlagen werden, und diejenigen, deren Name nicht in diesem Buch stehe, sollten der ewigen Verdammnis anheimfallen. (Offb 20,12 ff.) Der Transfer dieser Vorstellung in die Praxis des Gebetsgedenkens ist naheliegend. Wer aus der christlichen Kommunität ausgeschlossen war, dessen Hoffnungen auf einen Vermerk im göttlichen Lebensbuch reduzierten sich ebenso. Daher wurde im Rahmen der Exkommunikationssentenzen immer wieder in den düstersten Farben auf das drohende Bestattungsverbot Bezug genommen. Es ging dabei weniger um das Schicksal des Körpers, der auf diese Weise zweifellos entehrt wurde. Denn der christliche Friedhof war kein bloßes Leichenfeld, sondern vor allem ein sakraler Ort. Die Stätte wurde durch den Bischof geweiht, der Gott bat, nach der Wiedervereinigung von Leib und Seele, also beim Jüngsten Gericht, den dort Ruhenden die ewige Glückseligkeit zu schenken. Eine Person, die ohnehin bereits dem ewigen Seelentod verfallen war, hatte somit kein Anrecht auf diese Stätte, ja sie hätte den Ort durch ihre Anwesenheit sogar entweiht. „Sie sollen bestattet werden, wie ein Esel bestattet wird, und auf einem Misthaufen auf dem Angesicht der Erde liegen … “1 so formuliert es etwa Regino von Prüm im frühen 10. Jahrhundert. Sein Sendhandbuch war für die Pfarrvisitation und die bischöfliche Gerichtsbarkeit konzipiert, so dass hier detaillierte Vorlagen für die Durchführung des Ausschlusses zu finden sind. Über die Missetäter sollten ebenso alle Flüche kommen, „die der Herr durch Mose dem Volk, das das göttliche Gesetz übertreten hatte, androhte … .“2 Gemeint war damit die Ankündigung vom Fluch Gottes im alttestamentarischen Buch Deuteronomium. Es verwundert kaum, dass dieser Text bei der Verhängung der Exkommunikation stets eine zentrale Rolle spielte, wenn es um die Konsequenzen des Fehlverhaltens ging. Oftmals wurde explizit auf seinen Inhalt verwiesen: „Wenn Du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn, deines Gottes, und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte (…), so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen.“ (Dtn 28, 15) Es folgt eine Summe tödlicher Krankheiten und Seuchen wie Pest und Pocken, Naturkatastrophen wie Dürre und Missernten; genannt werden alle erdenkbaren Formen von Krieg und damit verbundener Gewalttaten, Vertreibung und Enteignung. Und schließlich kommt in diesem Kontext auch das entehrende Schicksal zur Sprache, das den Leib des Verfluchten erwartet: „Deine Leichname werden zum Fraß werden allen Vögeln des Himmels und allen Tieren des Landes, und niemand wird sie verscheuchen.“ (Dtn 28, 26). In einigen Fällen wurde auch der Psalm 109 gebetet: der „Ruf zu Gott gegen erbarmungslose Widersacher“.
„Tödliche“ Exkommunikation als Drohkulisse
Mit der Androhung des ewigen Seelentods wurde eine möglichst imposante Drohkulisse aufgebaut, um einen Missetäter zum Einlenken zu bewegen.
Obwohl die „tödliche“ Exkommunikation der Theorie nach keine Rückkehr in die christliche Kommunität zuließ, zeigt ihre praktische Anwendung, dass es stets Fälle gab, in denen die Missetäter im Rahmen einer Kirchenbuße dennoch wieder in die Gemeinschaft aufgenommen wurden. Die ewige Ausgrenzung, die durch eine unterlassene Bestattung zum Ausdruck kommen sollte, war eher die Ausnahme denn die Regel. Warum diese drastischen Sanktionen artikuliert, aber selten durchgesetzt wurden, ist eine Frage, die auf unterschiedlichen Ebenen beantwortet werden kann. Mit der Androhung des ewigen Seelentods wurde eine möglichst imposante Drohkulisse aufgebaut, um einen Missetäter zum Einlenken zu bewegen. Pointiert könnte man also formulieren, dass es in der Praxis weniger um die ewige Verdammnis ging, sondern darum, Handlungsdruck auf den Exkommunizierten auszuüben und ihn in letzter Konsequenz wieder der Gemeinschaft zuzuführen. Dass dabei die menschlichen Sanktionen nicht deckungsgleich mit dem göttlichen Strafmaß sein mussten, hat bereits Augustinus formuliert. Denn er gibt zu bedenken, dass es durchaus auch menschliche Unwissenheit sein könne, die eine Person aus dem Lebensbuch ausstreiche. Es bestand also immer ein gewisses Restrisiko, was die tatsächliche Berechtigung dieser Maßnahmen auf Erden betraf. Daher oblag trotz aller menschlicher Sanktionsmaßnahmen die letzte Entscheidung über das Schicksal der Ausgegrenzten bei Gott.