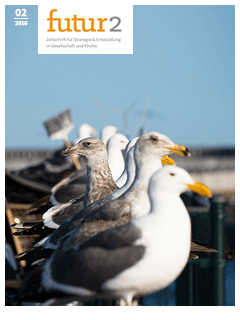Spuren suchen und sichtbar machen – eine Aufgabe interkultureller Organisationsentwicklung
Die Bibel ist über weite Strecken ein Flüchtlingsbuch.1 Sie erzählt von Menschen, die auf der Flucht waren, sind oder sein werden. Die biblische Antwort auf die Fluchtthematik ist ein konsequentes Einstehen für den Schutz von Menschen – und die sich daraus ergebenden gesellschaftlichen, sozialen und theologischen Weiterentwicklungen und Umformungen bestehender Umstände und Gemeinschaften. Beide Schritte, die Hilfe für die Fliehenden und die Veränderung von Strukturen und Systemen, gehören im biblischen Verständnis unauflöslich zusammen. Sie sind für die innere Landkarte von Menschen, die sich auf die Bibel als Urkunde ihres Glaubens berufen, eine entscheidende „Wertebrille“2.
Die Bibel ist über weite Strecken ein Flüchtlingsbuch.
Wie können diese Einsichten praktische Konsequenzen in der Institution Kirche und im alltäglichen Gemeindealltag hervorbringen? Wie können sie so fruchtbar gemacht werden, dass in der von Modernisierungsprozessen geprägten Gegenwart die Frage der Zugehörigkeit nicht mehr allein an quantitativ feststellbaren Merkmalen festgemacht wird, sondern „das Bewusstsein für eine fluide oder punktuelle ‚Mitgliedschaft‘ wächst“ und „Perspektiven für neue Partizipations- und Aktionsmodelle von Kirche“ entstehen.3
„Wir sind nur der Anfang“, prophezeit der Pastor seiner Gemeinde, „in wenigen Jahren wird es in jeder größeren und kleineren Stadt Gemeinden geben, die sich interkulturell öffnen.“ Ohne Zweifel sind die Veränderungen in seiner Gemeinde unüberseh- und -hörbar. Die Predigt wird simultan ins Persische übersetzt, die Lesungen sind mindestens zweisprachig, nach dem Gottesdienst hört man beim Kirchkaffee Arabisch, Englisch, Deutsch und Farsi. Und doch hadern Teile der Ursprungsgemeinde mit der Entwicklung: „Wir sind ihm jetzt wohl gar nicht mehr wichtig“, wird hinter vorgehaltener Hand geflüstert, bevor es auf der Gemeindeversammlung zu lautstarken Protesten einiger Gemeindeglieder und der Androhung von Gemeindeaustritten kommt.
Beide Schritte, die Hilfe für die Fliehenden und die Veränderung von Strukturen und Systemen, gehören im biblischen Verständnis unauflöslich zusammen.
Auch wenn Kirchengemeinden idealerweise bewegliche Systeme sein sollten (1. Kor 12; Röm. 12, 4ff.), in denen nach Möglichkeit verschiedene Milieus beheimatet sind, die man wiederum mit unterschiedlichen Angeboten erreichen kann, so stellen sie in Wirklichkeit doch oft überschaubare, soziale Einheiten mit fester Sozialstruktur dar: Die jeweiligen Konzepte von ‚Lebenslage‘ und ‚Lebensstruktur‘ sind bekannt, im besten Fall schätzt man sich, notfalls erträgt man sich. Eine neue Situation entsteht hingegen, wenn solche relativ festen Einheiten – technisch gesprochen – nicht nur um einzelne Elemente, sondern um ganze Komponenten erweitert werden sollen, wie z.B. afrikanische Migranten mit pfingstlerischer Tradition, russischsprachige Aussiedler mit glaubenskonservativem Hintergrund, Angehörige orientalischer Kirchen mit aktuell erlittenen Verfolgungstraumata oder muslimische Konvertiten auf den ersten Schritten in eine neue religiöse Identität.
Solange diese Gruppen ein Eigenleben führen und sich beispielsweise nach dem Gottesdienst der Ursprungsgemeinde in eigenen Veranstaltungen treffen, gibt es nur die ‚klassischen‘ Reibungspunkte: unterschiedliche Verständnisse von Termin- und Zeitabsprachen, andere Einschätzungen zu Fragen von Lautstärke, Ordnung oder Beaufsichtigung von Kindern. Deutlich schwieriger wird es, wenn diese unterschiedlichen Gruppen sich stärker zueinander verhalten wollen – oder müssen.
Der Kirchengemeinderat diskutiert aufgrund der hohen Heizkosten eine Winterkirche im Gemeindesaal. „Für die dreißig bis fünfzig Gemeindeglieder, die regelmäßig zum Gottesdienst kommen, reicht der Saal vollkommen aus – und deutlich wärmer als die Kirche ist er auch“, argumentiert der ehrenamtliche Vorsitzende des Finanzausschusses. „Aber was ist mir der westafrikanischen Gemeinde“, gibt die Gemeindepastorin zu bedenken, „wo bleiben dann die zwei- bis dreihundert Ghanaer, die jeden Sonntagnachmittag in der Kirche bunte, bewegungsintensive und lautstarke Gottesdienste mit Band und anschließendem Essen feiern? Die passen auf keinen Fall in den Saal!“
In dieser Situation sind Entscheidungen gefordert, die für die weitere Entwicklung der inneren und äußeren Verfasstheit von Gemeinden wesentliche Bedeutung haben.
In dieser Situation sind Entscheidungen gefordert, die für die weitere Entwicklung der inneren und äußeren Verfasstheit von Gemeinden wesentliche Bedeutung haben: Aus nachvollziehbaren Gründen könnten sich Kirchengemeinderäte mit dem Hinweis auf die großen organisatorischen, finanziellen, theologischen und kulturellen Hürden dafür entscheiden, sich auch in Zukunft auf ihre klassische Klientel zu beschränken und die Vermietung an Gastgemeinden zu beenden. Um dieser Konfrontation zu entgehen, könnten sie auch versuchen, einen finanziellen Ausgleich für die Benutzung der Kirche zu erwirken, der die realen Kosten abbildet. Oder sie könnten sich dafür entscheiden, in einen Prozess einzutreten, der ein gemeinsames Miteinander im Sinne einer „Formierung inklusiver Gemeinden“4 mit verschiedenen Kulturen, Frömmigkeitsstilen und Gemeindebildern unter einem Dach möglich macht.
Auch wenn die Vision inklusiver Gemeinden der oben beschriebenen theologischen Wertebrille am nächsten kommen mag, so ist dieser Weg doch alles andere als selbstverständlich. Denn an kaum einer anderen Stelle wird die Differenz zwischen theologischem Anspruch und gemeindlicher Wirklichkeit so deutlich wie an der Frage, was wir voneinander erwarten können und dürfen – und zwar nicht nur in kultureller, sondern auch in persönlicher, finanzieller, heimatverbundener und traditioneller Hinsicht. Allerdings kann es dabei passieren, dass sich Argumentationslinien auf ungeahnte Weise verschieben: Bislang Kirchenferne könnten die Kerngemeinde dazu auffordern, sich auf biblische Grundüberzeugungen zu besinnen, Schätze zu teilen, Fremde aufzunehmen und kirchliche Organisationsform den aktuellen Herausforderungen anzupassen. Gleichzeitig könnten diejenigen, die in den letzten Jahren in unzähligen Sitzungen über Strukturreformen, Mitteleinsparungen und Gemeindezusammenlegungen um das Überleben ihrer Gemeinde gerungen haben, darauf hinweisen, dass sie das Erkämpfte jetzt nicht einfach aufs Spiel setzen wollen für unüberschaubare Veränderungen.
Auch wenn die Vision inklusiver Gemeinden der oben beschriebenen theologischen Wertebrille am nächsten kommen mag, so ist dieser Weg doch alles andere als selbstverständlich.
Die interkulturelle Herausforderung von Kirche wird also nicht unbedingt nur an der Stelle virulent, an der wir sie gegenwärtig vielleicht als erstes erwarten würden: In der Begegnung mit Geflüchteten und Migrierten. Es kann auch passieren, dass sie von Menschen an Gemeinden herangetragen werden, die vielleicht zu den Kirchensteuerzahlenden gehören, sich aber nicht unbedingt ihrer Ortsgemeinde verbunden fühlen; oder von Menschen, die der vereinsmäßigen Struktur von Gemeinde nichts abgewinnen können, wohl aber vielgestaltig-bunte Gottesdienste schätzen.
Die Grundvoraussetzung, um interkulturelle Kontexte nicht als Bedrohung, sondern als Herausforderung zu erleben, ist ein guter Zugang zum „Eigenen“ sowie gleichzeitig die Bereitschaft und Fähigkeit, fremde Werte und innere Landkarten anderer Menschen neugierig, in engagierter Neutralität zu erkunden und positiv zu konnotieren.5 Schließlich braucht es zum Eintritt in einen interkulturellen Dialog die Bereitschaft aller Beteiligten, den jeweiligen GesprächspartnerInnen zumindest aus ihrer Kultur heraus positive Gründe für ihr Handeln zu unterstellen. So kann es gelingen, vom ‚Behandeln‘ der anderen zum ‚Verhandeln‘ mit ihnen zukommen.
Sonntagmorgen. Der Küster schließt die Kirche auf und erstarrt vor Schreck. Ein langer Ölfilm zieht sich vom Altar bis zu dem Verschlag unter der Treppe, in dem die afrikanische Gastgemeinde ihre Utensilien lagert. Hektische Telefonate gehen hin und her, bis die Ursache geklärt ist: Während des Nachtgottesdienstes der afrikanischen Pfingstgemeinde ist versehentlich der Inhalt einer Salbölflasche in das portable Lesepult gelaufen und beim Abbau unentdeckt einmal durch die Kirche getragen worden. Trotz aller Reinigungsversuche bleibt ein langer, dunkler Streifen auf dem Kirchenboden zurück.
So wie BewohnerInnen eines Hauses oder einer Wohnung ihr eigenes Selbstverständnis, ihre kulturellen Überzeugungen und ihre gesellschaftliche Stellung in die Ausstattung ihres Domizils eintragen, so hinterlässt auch das Selbstverständnis einer Gemeinde, ihr Frömmigkeitsprofil, ihre soziale Zusammensetzung und ihre theologische Ausrichtung Spuren in ihrer Organisation nach innen und ihrer Darstellung nach außen. Bezogen auf Kirchengebäude ließe sich zugespitzt sagen, dass Gemeinden Abbilder ihrer Kirchen sind – zumindest was die Spuren ihrer Benutzung angeht. In einer doppelten Funktion verweisen die Spuren, die Gemeinden in ihren Kirchengebäuden hinterlassen, zum einen auf die Gemeinde selbst, die sich in ihr zusammenfindet und zum anderen auf Christus als den Grund ihres Glaubens, den sie auf ihre je eigene Art im Gottesdienst und Gemeindeleben als gegenwärtig erleben wollen.6
Das Spurenmodell … löst darüber hinaus auch den Grundsatz interkultureller Kommunikation ein, eine lernende Kirche zu werden, indem sie unterschiedlich geprägte Menschen weder dem Primat einer Frömmigkeitstradition oder Gemeindeorganisation unterwirft noch einen statischen Traditions- oder Bekenntnisbegriff zum Maß möglicher Gemeinsamkeiten erklärt.
Dieses ‚Spurenmodell‘ vereint zwei theologische Denkfiguren in sich, die für eine interkulturelle Gestaltung von Gemeinden hilfreich sein können: Zum einen den Vorbehalt, dass alles menschliche Handeln immer nur hin- bzw. verweist auf den Grund des Glaubens und niemals dessen vollständiges Abbild sein kann.7 Zum anderen die Bestätigung, dass selbst Spuren ausreichen, um von ihnen aus eine Ahnung von etwas Größerem zu bekommen und in den Machtbereich von dessen Kraft und Ausstrahlung einzutreten.8 Der erste Vorbehalt trägt in alle religiösen Vollzüge inklusive ihrer baulichen Ausdrucksformen eine für das interkulturelle Gespräch hilfreiche Depotenzierung ein, ohne sie damit abzuwerten. Die zweite Bestätigung spricht beiden Größen wiederum eine eigene Dignität zu, ohne sie damit absolut zu setzen.
Der Ist-Zustand von Gemeinden ist entsprechend dieses ‚Spurenmodells‘ ein Wegsymbol für die Suche nach einer Form, die dem jeweiligen theologischen und kulturellen Selbstverständnis gerecht wird. Er bildet keine unabänderliche Norm, sondern drückt die Sehnsucht aus, dass die Geschichte Gottes mit den Menschen in und durch ihn eine Fortführung finden kann. Entscheidet sich eine Gemeinde für den Weg einer interkulturellen Öffnung, so ergreift sie damit eine der Chancen, die als Kennzeichen der Postmoderne schon vor zwanzig Jahren beschworen wurde und bis jetzt Theorie zu bleiben schien9: Die Möglichkeit, innerhalb der Individualisierung von Lebenswelten den eigenen Erzählstrang, mit dem man sich in die große Erzählungen des Christentums einträgt, stärker in Richtung biblischer Grunderfahrungen zu gewichten und ihn damit seinem ursprünglichen Sinn gemäß kreativ fortzuschreiben. Darin liegt die doppelte Chance, einerseits die Erinnerung an die überlieferte Geschichte des Glaubens lebendig wachzuhalten und sie andererseits als Angebot fruchtbar zu machen, dass Kirchennahe und -ferne, Neuhinzukommende oder sich vorsichtig Wiederannähernde sie mit ihrem eigenen Leben fortschreiben können.
Die gegenwärtig zu beobachtende Ausdifferenzierung von Lebenswelten wird auch im kirchlichen Bereich dazu führen, dass sich Gemeinden noch stärker profilieren werden. Die interkulturelle Öffnung von Kirche wird dabei eine Profilbildung (neben anderen) sein. Das oben eingeführte Spurenmodell kann den schon vielerorts stattfindenden praktischen Schritten der interkulturellen Öffnung Orientierung bieten. Das Spurenmodell ist nicht nur auf der Bildebene ganz nah an der zentralen biblischen Thematik von Flucht und der organisatorischen Wandelbarkeit religiöser Organisationsformen. Es löst darüber hinaus auch den Grundsatz interkultureller Kommunikation ein, eine lernende Kirche zu werden, indem sie unterschiedlich geprägte Menschen weder dem Primat einer Frömmigkeitstradition oder Gemeindeorganisation unterwirft noch einen statischen Traditions- oder Bekenntnisbegriff zum Maß möglicher Gemeinsamkeiten erklärt.10
Das Spurenmodell geht davon aus, dass alle, die sich mit ihrem Leben in die christliche Großerzählung einschreiben, Spuren darin hinterlassen … Sie bilden miteinander ein Netz aus Glaubenserfahrungen und Lebensgeschichten.
Das Spurenmodell geht davon aus, dass alle, die sich mit ihrem Leben in die christliche Großerzählung einschreiben, Spuren darin hinterlassen. Diese Spuren sind bei genauer Wahrnehmung im Handeln der Beteiligten beobachtbar. Zusätzlich finden sie ihren Ausdruck in der Art und Weise ihrer gemeinsamen Organisation. An manchen Stellen sind diese Spuren flüchtig, an anderen verdichtet. Sie bilden miteinander ein Netz aus Glaubenserfahrungen und Lebensgeschichten.11 Das Besondere dieses Netzes besteht darin, dass die Intention, aus der heraus es entsteht – also die Glaubensbewegung – eine Verbindung eingeht mit dem Weg, den es geht – also die Lebensbewegung. In dieser Kombination kann es in großer Vielfalt gleichzeitig von einem gemeinsamen Ausgangspunkt, einem ähnlichen Weg und einem verbindenden Ziel zeugen. Differenzen müssen dabei kein Grund sein, die so entstehende Gemeinschaft infrage zu stellen. Zum einen, weil es niemals einen einheitlichen Idealzustand von Kirche gab und entsprechend auch in Zukunft nicht geben wird, zum anderen, weil Pluralität und Dynamik von Anfang an Kennzeichen der Kirche und Ausdruck ihrer Lebendigkeit waren.12
- Vgl. Polak, R., Migration als Lernort für globales Zusammenleben in Verschiedenheit, in: Pastoraltheologische Informationen, 34. Jg., 2014, 205-220, 217: „Judentum und Christentum sind migratorische Religionen“.
- Thomas Hegemann, Cornelia Oestereich: Einführung in die interkulturelle systemische Beratung und Therapie, Heidelberg 2009, 64.
- Ebd.
- Werner Kahl: Vom Verweben des Eigenen mit dem Fremden. Impulse zu einer transkulturellen Neuformierung des evangelischen Gemeindelebens, Hamburg 2016, 174.
- Hegemann, Oestereich, Einführung, 64.
- Vgl. Klaus Raschzok: „… an keine Stätte noch Zeit aus Not gebunden.“ (Martin Luther). Zur Frage des heiligen Raumes nach lutherischem Verständnis, in: Kirchen. Raum. Pädagogik, hrsg. von Sigrid Glockzin-Bever, Horst Schwebel, Münster 2002, 99-113, 108.
- Vgl. Sönke Lorberg-Fehring: Kirche als Zeugnis für das Heilige, in: Praktische Theologie. Zeitschrift für Praxis in Kirche, Gesellschaft und Kultur, 42. Jg., 2007, 59-68.
- Vgl. Rainer Maria Rilke: Archaischer Torso Apollos, in: Ders., Sämtliche Werke. Erster Band, Frankfurt a. M. 1955, 557: Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, / darin die Augenäpfel reiften. Aber / sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, / in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt, sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug / der Brust dich blenden, und im leisen Drehen / der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen / zu jener Mitte, die die Zeugung trug …
- Albrecht Grözinger: Die Kirche – ist sie noch zu retten? Anstiftungen für das Christentum in postmoderner Gesellschaft, Gütersloh 1998, 9.
- Vgl. Schönemann: Gestaltung kirchlicher Transformationsprozesse: „Das Ziel ist, lernfähig für die unterschiedlichen Ausprägungsformen des Evangeliums innerhalb und außerhalb der verfassten Kirche zu werden. Ziel ist auch, die unterschiedlichen Arten und Weisen der Menschen, nach Sinn zu suchen, mit der christlichen Botschaft von Gottes Gegenwart in Kontakt zu bringen und beides dadurch lebensweltlich weiterzuentwickeln. Eine lernende Kirche ist (sprechende) Botschafterin des Evangeliums, indem sie (hörende) Kundschafterin nach den Facetten des Lebens der Menschen ist. Eine lernende Kirche sorgt sich um eine fruchtbare Einheit von Sprechen und Hören.“
- Vgl. Raschzok: „… an keine Stätte noch Zeit aus Not gebunden.“, 108.
- Vgl. EKD Text 124: Ökumene im 21. Jahrhundert. Bedingungen – theologische Grundlegungen – Perspektiven, hrsg. Von Kirchenamt der EKD, Hannover 2015, 36: „Nicht die Verständigung ist die Voraussetzung der Gemeinschaft, sondern die von Gott geschenkte koinonia ist die Voraussetzung der Verständigung.“ Siehe auch: http://www.ekkw.de/media_ekkw/downloads/ekkw_texte_150909_zuwanderergemeinden_in_der_ekkw.pdf.