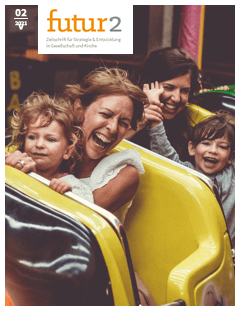Aufbruch zwischen Hoffen und Bangen
„Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde! … Da ging Abram, wie der HERR ihm gesagt hatte.“ (Gen 12,1+4)
Was lässt Menschen aus dem Gewohnten, aus ihrer Heimat aufbrechen?
Eine Berufung ist entweder eine Evolution oder eine Revolution
Konkret aufbrechen, auf einen Weg zu einem äußeren Ziel hin, oder innerlich aufbrechen auf einen Weg der Veränderung? Oft motivieren uns dabei eher die Härten des Lebens als die Verheißungen. Das steckt auch bereits im Wort „Aufbruch“. Da muss etwas Hartes aufbrechen, sei es eine Schale, damit das Küken aus dem Ei schlüpfen kann, oder ein Samenkorn, damit der Keimling und die kleinen Wurzeln anfangen können zu wachsen. In uns muss etwas Verhärtetes aufgebrochen, durchbrochen werden, ehe Neues werden kann. Kein Aufbruch ohne Widerstände. So war es sicher auch bei Abraham und Sara. Und so war es, als ich mich entschieden habe, in ein Kloster einzutreten. Eine unserer Kandidatinnen sagte einmal sehr treffend: „Eine Berufung ist entweder eine Evolution oder eine Revolution.“ Meine war eindeutig eine Revolution, sie überraschte zunächst einmal mich selbst und dann auch alle Menschen, die mich kannten…
Führt die vertraute Lösungsstrategie nicht zum gewünschten Ergebnis, dann liegt der Fehler – so meinen wir – darin, dass wir uns einfach noch nicht genug angestrengt haben
Zugleich ist das Thema „Aufbruch“ ein Sehnsuchts-Thema und mit starken Hoffnungen verbunden.
Viele Menschen träumen vom Aufbruch, von Veränderungen in ihrem Leben. Viele Organisationen und Institutionen befassen sich damit, auch die Kirchen. Bei der von Papst Franziskus gerade eröffneten „Weltsynode“ geht es darum, beim „Synodalen Weg“ genauso. Ob Strukturwandel in der Kirche, Pastoraler Zukunftsweg oder wie auch immer die Projekte und Prozesse heißen, sie alle sollen Aufbruch und Veränderung bewirken. Warum verändert sich dann so wenig? Dazu eine kleine Geschichte:
Unter einer Straßenlaterne steht ein Betrunkener und sucht und sucht. Ein Polizist kommt daher, fragt ihn, was er verloren habe, und der Mann antwortet: „Meinen Schlüssel“. Nun suchen beide. Schließlich will der Polizist wissen, ob der Mann sicher ist, den Schlüssel gerade hier verloren zu haben, und jener antwortet: „Nein, nicht hier, sondern dort hinten – aber dort ist es viel zu finster.“
Wir Menschen haben die fatale Neigung, bei Problemen und Konflikten mit Feuereifer immer wieder dieselbe „Lösung“ zu versuchen, auch dann, wenn längst klar ist, dass das so nicht funktioniert
Dies ist eine der Geschichten, die Paul Watzlawick in seinem Buch „Anleitung zum Unglücklichsein“ als Aufhänger nutzt. Er fährt dazu ironisch fort: „Der Vorteil ist nämlich, dass eine solche Suche zu nichts führt, außer ‚mehr desselben‘, nämlich nichts. Hinter diesen beiden einfachen Worten ‚mehr desselben‘, verbirgt sich eines der erfolgreichsten und wirkungsvollsten Katastrophenrezepte…“ Es geht um eine Strategie, die wir auch in der Kirche perfekt beherrschen. Führt die vertraute Lösungsstrategie nicht zum gewünschten Ergebnis, dann liegt der Fehler – so meinen wir – darin, dass wir uns einfach noch nicht genug angestrengt haben. Wir Menschen haben die fatale Neigung, bei Problemen und Konflikten mit Feuereifer immer wieder dieselbe „Lösung“ zu versuchen, auch dann, wenn längst klar ist, dass das so nicht funktioniert.
Der Aufbruch ins wirklich Neue birgt immer ein großes Risiko
In Beziehungen führt dies zu kaum lösbaren Konflikten. Da sucht z.B. der Eine mehr Nähe und die Andere braucht mehr Rückzug. Auf der einen Seite wird dann die Suche nach Nähe intensiviert und der Rückzug auf der anderen Seite intensiviert sich ebenfalls … Wer sich die tragische Komik dieses „Mehr-desselben“ nicht vorstellen kann, braucht nur einige von Loriots Sketchen anzuschauen. Sie sind deshalb so lustig, weil sie diese Mechanismen so treffend-überzeichnet entlarven. Wenn wir uns darauf fixiert haben, dass ein Raum nur durch diese eine Türe zu verlassen ist, werden wir es mit wachsender Energie und oft auch mit Verbissenheit immer wieder versuchen, auch wenn diese eine Türe geschlossen ist und es gleich daneben eine andere gibt. Ob Problemlösungen, Aufbrüche oder Veränderungsprozesse im persönlichen oder im institutionellen Leben, wohl dem, der bei sich selbst erkennt: Ja, ich spiele gerade „Mehr-Desselben“!
Wer aufbricht ins Unbekannte, heraus aus dem Gewohnten, macht sich auf einen weiten Weg mit Höhen und Tiefen, mit Versuch und Irrtum
So seltsam es klingen mag, der Kern des Problems liegt darin, dass Neues nun mal eben neu ist. Absurd? Keineswegs. Wer wachen Auges durch die Welt geht, erkennt leicht und hoffentlich auch bei sich selbst, wie grandios Watzlawicks Problemanalyse ist.
Der Aufbruch ins wirklich Neue birgt immer ein großes Risiko. Ängste, Unsicherheit, Zweifel und Fragen sind da ganz normal. Es fehlt die Möglichkeit, Schritte vorherzusehen, Entwicklungen vorauszusagen, sich ein Bild des Zieles zu haben. Denn: Das Neue ist nun mal eben neu. Es lässt sich ohne Wagnis nicht erreichen. Wer aufbricht ins Unbekannte, heraus aus dem Gewohnten, macht sich auf einen weiten Weg mit Höhen und Tiefen, mit Versuch und Irrtum. Er wird es nicht leicht haben, die anderen, die sich mit ihm auf den Weg gemacht haben, „bei der Stange“ zu halten. Auf anfanghafte Begeisterung folgt, wenn das gewünschte Ziel nicht schnell erreicht wird, Ernüchterung, Ermüdung und Widerstand. Im Changemanagement nennt man diese Phase „dark night of the innovator“ – „dunkle Nacht des Erneuerers“. Genau das ist es: Der Schlüssel muss im Dunkeln gesucht und gefunden werden. Daran führt kein Weg vorbei.
Vielleicht zählt dies zum Erschütterndsten an der Corona-Krise, zu merken wie schnell die für sicher gehaltenen Landkarten unseres Lebens ihre Bedeutung verloren haben
Wie aber finden wir Orientierung auf dem Weg? Normalerweise durch eine Landkarte, denn auch ein Navigator ist nichts anderes als das. Wer einmal alte Landkarten angeschaut hat, sei es eine antike Karte der damals bekannten Welt oder erste Karten der „Neuen Welt“ Amerika, und sie mit späteren Karten vergleicht, sieht, wie Landkarte und Wirklichkeit sich immer mehr annähern. Ich staune darüber, wie die frühen Entdecker angesichts der gewaltigen Unterschiede zwischen Landkarte und Wirklichkeit überhaupt ein Ziel erreicht haben. Oft genug war es, wie bei der Entdeckung Amerikas, dann ja auch ein ganz anderes Ziel als das, was sie eigentlich erreichen wollten.
Wir alle haben solche, oft unbewussten, inneren „Landkarten“ vom Leben, von der Wirklichkeit, von uns selber, von unserem Weg, unserem Ziel. Wir brauchen sie, um Orientierung zu haben. Wir passen unsere Landkarten wieder und wieder an das an, was wir vom Leben und unserer Welt erfahren, entdecken oder glauben. Solche „Landkarten“ sind ganz normal und notwendig, aber sie bergen, solange sie unbewusst bleiben, auch eine Gefahr:
Eine Landkarte ist etwas, das auf etwas anderes hindeutet, und ihr Sinn besteht allein in dieser Fähigkeit. […] Indem wir die Landkarten mit dem Territorium verwechseln, haben wir auch ihre Nützlichkeit fast gänzlich zunichte gemacht. Unsere Landkarten sind Fiktionen … Und so nützlich diese Fiktionen auch sein mögen, sie führen zu unsäglicher Verwirrung, wenn man sie für Fakten nimmt. […] Haben wir die Beschreibungen der Welt erst als die Wirklichkeit selbst akzeptiert, gelingt es nur noch unter allergrößten Schwierigkeiten, an diesen Beschreibungen vorbeizuschauen. Unsere Augen kleben sozusagen an den Landkarten, und so können wir gar nicht mehr bemerken, was eigentlich geschieht. (Ken Wilber)
Wir brauchen beides, die Bereitschaft im Dunkeln zu suchen und zugleich unsere Landkarten immer wieder zu hinterfragen …
Was für eine entlarvende Analyse für unsere Situation, ganz gleich, ob es sich um persönliche, gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche oder auch kirchliche „Landkarten“ handelt. Vielleicht zählt dies zum Erschütterndsten an der Corona-Krise, zu merken wie schnell die für sicher gehaltenen Landkarten unseres Lebens ihre Bedeutung verloren haben? Werden nicht gerade auch in der Kirche traditionelle Formen und Deutungsmuster – also religiöse Landkarten – mit Wahrheit und Wirklichkeit gleichgesetzt? Da erleben Menschen deren drohenden Verlust als existentielle Katastrophe, die mit allen Mitteln verhindert werden muss. Zugleich werden wir von immer mehr Menschen, besonders solchen, die sich mit denselben Landkarten längst nicht mehr zurechtfinden, eindringlich, kritisch, ja (an)klagend gefragt nach unserer Wirklichkeit, nach dem, was wir wirklich leben.
Kurz vor meinem Eintritt ins Kloster lernte ich – eher zufällig – einen erfahrenen Mönch kennen. Er fragte mich, was ich denn so vorhätte, und leicht verlegen gestand ich, ich wolle ins Kloster eintreten. Da schaute er mich intensiv an und sagte zu mir: „Ja, tun Sie das. Aber rechnen Sie damit, dass alles ganz anders ist.“ Da ich ja auch selbst von meinem Schritt überrascht war, antwortete ich, ich hätte schon gemerkt, dass es ganz anders sei. Und er: „Ja, und in fünf Jahren ist es nochmal anders und in zehn oder zwanzig Jahren noch ganz anders.“ Dieser Satz hat mich durch viele Krisen meines Lebens begleitet: Es ist alles ganz anders. Denn er hat mir dabei geholfen, meine Landkarten zu hinterfragen, mich von der Wirklichkeit immer wieder überraschen und befreien zu lassen.
Wir brauchen beides, die Bereitschaft im Dunkeln zu suchen und zugleich unsere Landkarten immer wieder zu hinterfragen, um mutig und effektiv aufzubrechen, realistisch, zwischen Hoffen und Bangen…