
Praxis
Mögliche Geschäftsmodelle der nächsten Kirche
Erste Ergebnisse der Befragung von Fach- und Führungskräften beider großen Kirchen
Einleitung
Die Kirchen in Deutschland befinden sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Das seit Jahrhunderten existierende Parochialprinzip ist trotz massiver Anzeichen fortschreitender Erosion weiterhin das dominante Strukturprinzip kirchlichen Handelns. Es folgt flächendeckend einem einheitlichen Paradigma: Die Kirchengemeinde (bzw. Pfarrei) ist als rechtlich selbstständige territoriale Einheit für die seelsorgliche Betreuung ihrer Mitglieder und deren Organisation zuständig.
Die Gesellschaft ist – getrieben durch die technologische Entwicklung – in einem rasanten Wandel begriffen, der nicht ohne Auswirkungen auf die Kirchen bleibt. Insbesondere die fortschreitende Individualisierung und die Pluralisierung der Lebensformen tragen zu einem massiven Relevanzverlust der Kirchen und ihrer Botschaft bei. Der kontinuierliche Verlust an Mitgliedern und Nutzer:innen kirchlicher Angebote und der substanzielle Rückgang personeller und finanzieller Ressourcen bedrohen die Landeskirchen und Diözesen existenziell. Sie lassen zugleich den Schluss zu, dass über kurz oder lang das Parochialprinzip nicht mehr aufrechterhalten werden kann und darüber hinaus grundsätzlich die Menschen heute darüber nicht mehr erreicht werden können.
Karl Gabriel fordert für eine pluriformen Gesellschaft eine pluriforme Praxis von Religion, sofern sie gesellschaftlich relevant bleiben soll. Die Kirchen stehen vor der Herausforderung neue, plurale Formen – oder Geschäftsmodelle – zu entwickeln, die besser auf die Menschen eingehen und nachhaltig sind, insofern, als sie – basierend auf der christlichen Botschaft – den Menschen und der Gesellschaft Nutzen stiften und die die Ressourcen, die dazu benötigt werden, selbst generieren.
Da solche Ansätze nicht aus dem Bestehenden hergeleitet werden können und zugleich kontinuierlich organisatorische Entscheidungen (z. B. hinsichtlich des Ressourcenansatzes) getroffen werden müssen, wächst die Bedeutung von Ansätzen, die es ermöglichen, Geschäftsmodelle im kirchlichen Kontext systematisch zu analysieren und auf ihre Zukunftstauglichkeit hin einzuschätzen. Es werden fundierte Modelle und Kriterien benötigt, um zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen, die theologisch, organisatorisch und unternehmerisch begründet sind.
Fragestellung
Die zentrale Fragestellung der durchgeführten Studie lautet: Welche kirchlichen Geschäftsmodelle werden als zukunftstauglich wahrgenommen, und welche Kriterien sind für diese Einschätzung maßgeblich?
Dabei geht es konkret um:
- Die Identifikation von Geschäftsmodellen, die aus Sicht von Fach- und Führungskräften als zukunftstauglich gelten.
- Die Identifikation der Kriterien, die zur Einschätzung der Zukunftstauglichkeit herangezogen werden und deren Einfluss.
- Das Aufdecken von Unterschieden zwischen offen benannten Wichtigkeiten von Kriterien und ihrer faktischen prädiktiven Relevanz, die sie auf die Einschätzung der Zukunftstauglichkeit von Geschäftsmodellen haben.
- Die Untersuchung der Relevanz individueller Vorlieben auf die Beurteilung der langfristigen Erfolgsaussichten von Geschäftsmodellen.
Im vorliegenden Beitrag werden erste Ergebnisse der Studie vorgestellt, die sich auf die Einschätzung der Geschäftsmodelle auf Dimensionsebene konzentrieren. Die weiterführenden Analysen, insbesondere zu den Modellen und den Unterschieden zwischen subjektiver Wichtigkeit und prädiktiver Relevanz, werden in späteren Veröffentlichungen behandelt.
Geschäftsmodelle und ihre Relevanz für die Zukunft der Kirche
Social Ecclesiopreneurship: Anleihen aus dem Social Entrepreneurship für kirchliches Handeln
Die Kirchen stehen vor der Herausforderung, sich neu erfinden zu müssen. Hierbei könnten Anleihen an das Konzept des Social Entrepreneurship hilfreich sein, das beschreibt, wie mit unternehmerischem Denken und Handeln soziale und ökologische Probleme gelöst werden. Man könnte einen solchen Ansatz „Social Ecclesiopreneurship“ nennen. Social Ecclesiopreneure verfolgen eine ähnliche Mission wie Social Entrepreneure, jedoch mit einem besonderen Fokus auf die Entwicklung von neuen Formen, die einen erkennbaren Bezug zum Evangelium haben und Kirche in neuer Gestalt lebendig werden lassen.
Social Ecclesiopreneurship kombiniert daher einen nächstenliebenden und gemeinwohlorientierten Ansatz mit unternehmerischen Methoden, um nachhaltige Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu finden und individuellen Nutzen zu spenden. Diese Herangehensweise integriert wie im Social Entrepreneurship drei wesentliche Dimensionen: die unternehmerische, die gesellschaftliche und die Governance-Dimension.
Gesellschaftliche Dimension
Die gesellschaftliche Dimension fokussiert sich auf die Schaffung von sozialem Mehrwert und die nachhaltige Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Ziel ist es, durch innovative Projekte positive Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken. Zentraler treibender Gedanke ist die Nächstenliebe, wie sie im Gleichnis vom barmherzigen Samariter dargestellt wird. Die Frage „Wer ist denn mein Nächster?“ zeigt, dass Nächstenliebe nicht durch religiöse, kulturelle oder geografische Grenzen eingeschränkt wird. Die umfassende Perspektive bedeutet, dass die gesamte Menschheitsfamilie im Fokus eines möglichen Engagements steht. Social Ecclesiopreneure betrachten es als ihre Verantwortung, sich für Menschen einzusetzen, unabhängig von deren Herkunft oder Hintergrund, um so einen Beitrag zu einer gerechteren und nachhaltigeren Welt zu leisten.
Governance-Dimension
Die Governance-Dimension stellt den notwendigen kritischen Bezug zu den Grundüberzeugungen (hier: die Frohe Botschaft) und dem ursprünglichen Auftrag (hier: dem Sendungsauftrag) her. Es geht darum, langfristige Wirkung und Nachhaltigkeit der Projekte im Sinne der Mission sicherzustellen. Daher werden steuernde und kontrollierende Mechanismen entwickelt, die sicherstellen, dass die angestrebte Wirkung erreicht und mögliche Gewinne und Ressourcen reinvestiert werden, um die ursprüngliche Mission zu unterstützen und zu vermeiden, dass davon abgewichen wird und andere, etwa gewinnorientierte, Ziele verfolgt werden. Transparenz und Partizipation sind hier zentral: Entscheidungen werden unter Einbeziehung der Zielgruppen, der Engagierten und Mitarbeitenden getroffen. Eingeschlossen in die Überlegungen zu Transparenz und Partizipation ist auch die Prävention von Machtmissbrauch.
Unternehmerische Dimension
Die unternehmerische Dimension des Social Ecclesiopreneurship legt den Schwerpunkt auf die Anwendung unternehmerischer Methoden und Innovationspraktiken, um kirchliche Projekte und Initiativen voranzubringen. Social Ecclesiopreneure entwickeln neue Geschäftsmodelle, um neue Arten des Kircheseins hervorzubringen und nachhaltig betreiben zu können. Dabei setzen sie auf Kreativität, experimentelles Vorgehen, Lernen und effiziente Ressourcennutzung. Es geht darum, attraktive und wirkungsvolle Projekte zu entwickeln, die sich auch finanzieren lassen. Social Ecclesiopreneure identifizieren Bedürfnisse und Chancen in einem spezifischen Kontext und entwickeln ko-kreativ Lösungen, die einen Mehrwert für die Beteiligten schaffen.
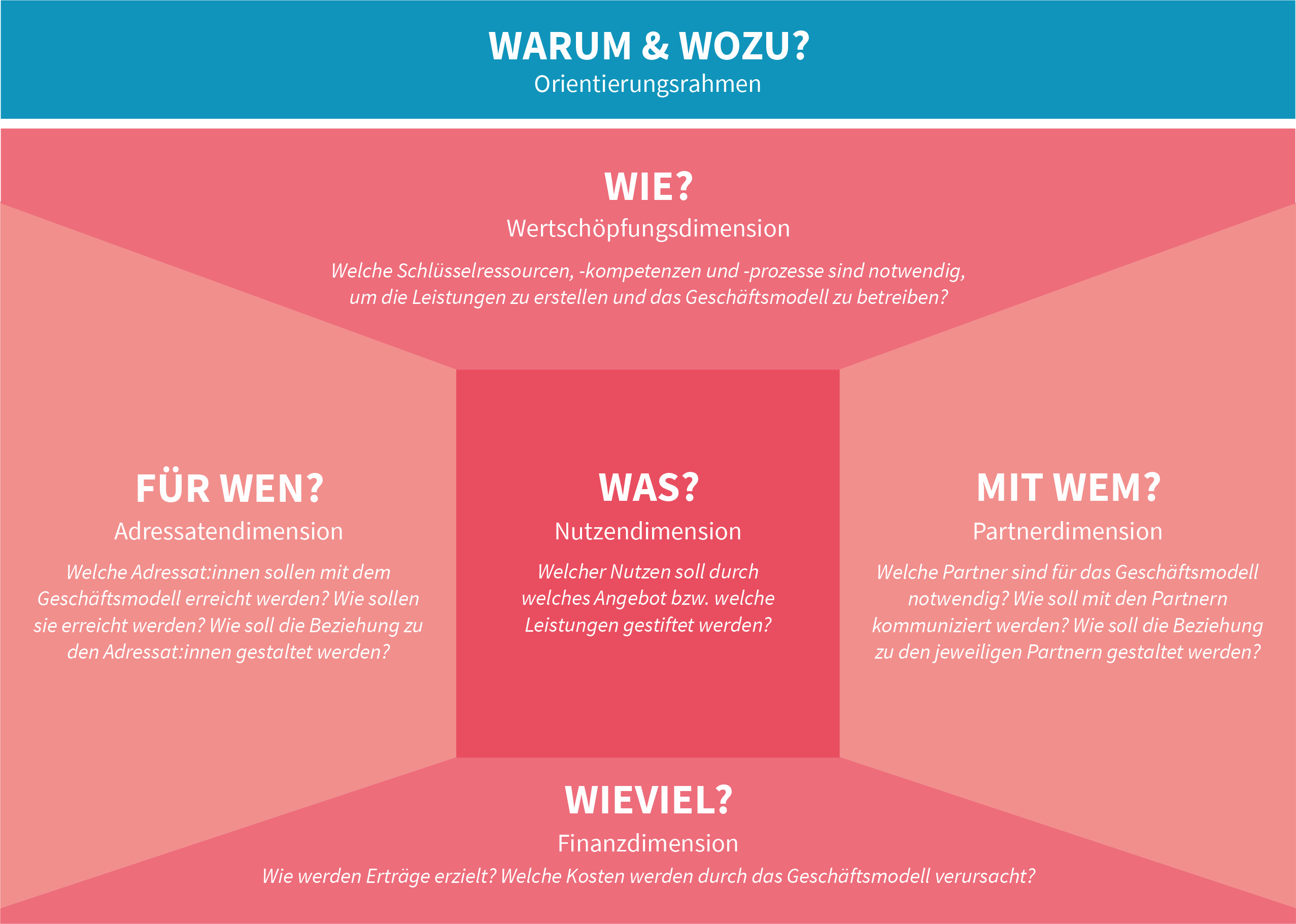
Orientierungsrahmen
Der Orientierungsrahmen dient der inhaltlichen Fokussierung im Sinne der Gemeinwohlorientierung und der Gouvernance-Dimension. Hier werden Aussagen zum Purpose des Projekts, zu den Entwicklungsaufgaben und zum angestrebten gesellschaftlichen Nutzen getroffen.
Adressatendimension
In der Adressatendimension werden die Zielgruppen beschrieben sowie die Kanäle, über die sie erreicht werden können. Zudem wird festgehalten, wie die Adressatenbeziehungen gestaltet werden. Diese Dimension ist wichtig, um die Bedürfnisse und Erwartungen der Zielgruppen zu verstehen und passende Kommunikations- und Interaktionsstrategien zu entwickeln.
Nutzendimension
Nutzen kann man nicht „liefern“, sondern lediglich ein Nutzenversprechen abgeben. Der Nutzen entsteht erst dadurch, dass der Anbietende seine Ressourcen einbringt und partnerschaftlich mit Adressat:innen an der Wertschöpfung teilhat. In der Nutzendimension wird auch festgehalten, was konkret getan wird, um den Nutzen zu stiften, also bspw. konkrete Angebote und Leistungen.
Partnerdimension
Hier wird analysiert, welche Partner:innen für das Geschäftsmodell notwendig sind und wie die Zusammenarbeit mit diesen Partnern gestaltet werden soll. Eine starke Partnerschaftsstrategie kann entscheidend für den Erfolg und die Skalierbarkeit eines Geschäftsmodells sein.
Wertschöpfungsdimension
Die Wertschöpfungsdimension untersucht die Schlüsselressourcen, -kompetenzen und -prozesse, die notwendig sind, um die Leistungen zu erstellen und das Geschäftsmodell zu betreiben.
Finanzdimension
Diese Dimension fokussiert sich auf die wirtschaftlichen Aspekte des Geschäftsmodells. Denn auch wenn die gesellschaftliche Wirkung im Vordergrund steht, ist klar, dass entstehende Kosten getragen werden müssen. Daher wird in dieser Dimension die Frage nach den Kosten und Erträgen beantwortet. Ein solides Finanzmodell ist notwendig, um die notwendigen Mittel zur Umsetzung der Ideen zu sichern.
Methodik
Ansatz zur Messung der wahrgenommenen Zukunftstauglichkeit kirchlicher Geschäftsmodelle
Die Zukunftstauglichkeit kirchlicher Geschäftsmodelle ist keine objektiv messbare Größe, sondern eine subjektive Zuschreibung, die von den Wahrnehmungen, Erfahrungen und Überzeugungen der Beurteilenden geprägt ist. In der vorliegenden Studie wird die Zukunftstauglichkeit als die Fähigkeit eines Geschäftsmodells definiert, in einem sich wandelnden gesellschaftlichen und kirchlichen Kontext längerfristig relevant, wirksam und tragfähig zu bleiben. Diese Einschätzung basiert auf einer multidimensionalen Bewertung, die sowohl theologische, gesellschaftliche als auch unternehmerische Aspekte berücksichtigt.
Das Modell weist eine kompositionelle Struktur auf, die davon ausgeht, dass die Gesamteinschätzung der Zukunftstauglichkeit durch die Gewichtung und Bewertung einzelner Dimensionen erklärt werden kann. Es integriert drei zentrale Dimensionen, die jeweils für wesentliche Aspekte kirchlicher Geschäftsmodelle stehen. Jede Dimension wurde in der empirischen Untersuchung durch mehrere Merkmale operationalisiert1.
Die Theologische Dimension erfasst, wie das Geschäftsmodell Glauben erfahrbar macht und spirituelle Tiefenerlebnisse ermöglicht.
Die Gesellschaftliche Dimension fokussiert sich auf die gesellschaftliche Wirkung eines Geschäftsmodells, etwa die Förderung des Gemeinwohls.
Die Unternehmerische Dimension schließlich beinhaltet u. a. die wirtschaftliche Tragfähigkeit und Ausrichtung am Markt mit seinen Akteuren.
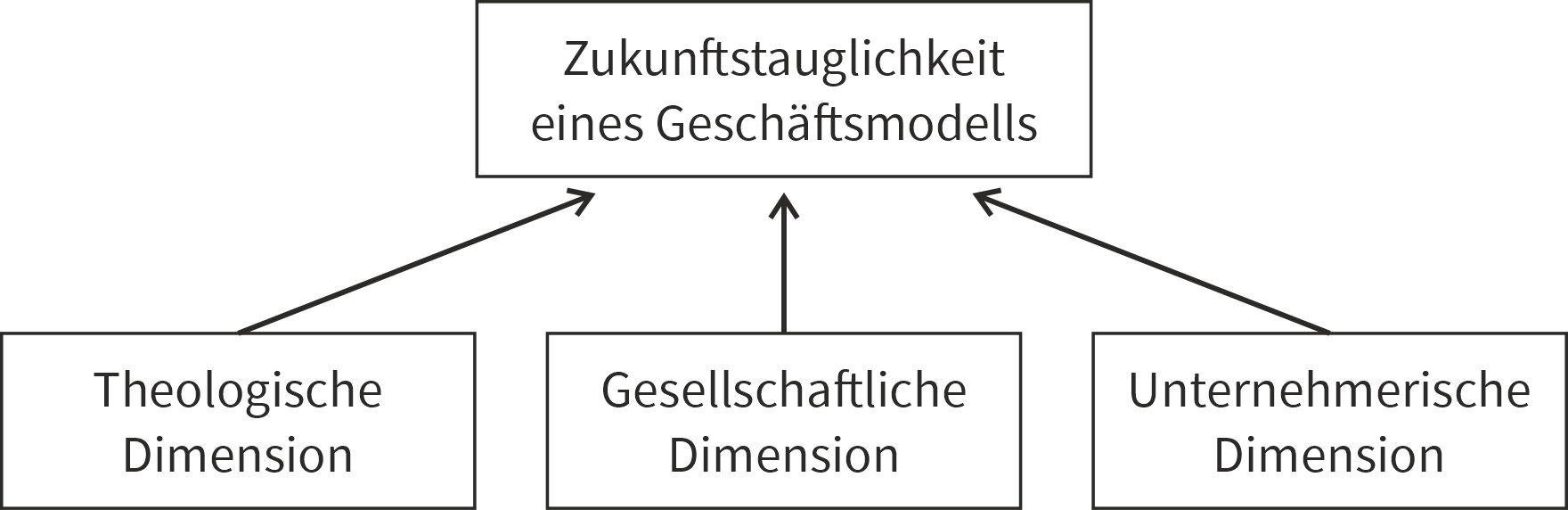
Untersuchungsdesign
Im Rahmen dieser Studie wurden Fach- und Führungskräfte der beiden großen Kirchen Deutschlands befragt. Die Befragung wurde von 27. September bis 10. November 2024 durchgeführt, insgesamt wurden gut 1.400 Personen per E-Mail zur Teilnahme eingeladen2
Zudem wurden alle 200 zum 8. Strategiekongress angemeldeten Personen gebeten, sich an der Befragung beteiligen, da sich dieser ebenfalls intensiv mit dem Thema der Befragung beschäftigt.
Die Befragung erfolgte online und war anonym angelegt. Weder der Zugang zum Fragebogen noch die gestellten Fragen lassen einen Rückschluss auf einzelne Teilnehmer:innen der Befragung zu.
Den Teilnehmenden wurden Kurzbeschreibungen von 14 verschiedene Geschäftsmodelle vorgelegt, die potenziell zukunftstaugliche Formen kirchlicher Organisation und Tätigkeit darstellen:
- Coworking-Space für soziale und kirchliche Innovation
- Diakonische Organisation
- Digitale Community
- Missionarische Bewegung
- Digitaler spiritueller Ort
- Pop-up Kirche als Urbane Intervention
- Ritualagentur
- Neue Form von Gemeinde
- Kunst- & Kultur-Kirche
- Präsenz in Shoppingmall
- Community Organizing
- Allmende/Commons
- Mobile Kirche
- Christliche:r Influencer:in
Diese Geschäftsmodelle wurden herangezogen, um die Bandbreite möglicher kirchlicher Innovationsansätze abzubilden, darunter sowohl klassischere als auch experimentellere Formen. Um die Befragten nicht zu überlasten und zugleich Verzerrungen in den Bewertungen zu minimieren, erhielt jede:r Teilnehmende zufällig 3 der 14 Geschäftsmodelle zur Beurteilung vorgelegt.
Um die Zukunftstauglichkeit der Geschäftsmodelle zu messen, wurden die drei zentralen Dimensionen – theologisch, gesellschaftlich und unternehmerisch – direkt abgefragt und zudem durch spezifische Merkmale operationalisiert.
Die Ausprägungen der Dimensionen wurden nacheinander abgefragt – zunächst zu den einzelnen Merkmalen, dann abschließend zur Dimension selbst. Die hier ausgewerteten Dimensions-Items lauteten:
Theologische Perspektive
Alles in allem: Das Projekt hat das Potenzial, Reich Gottes erfahrbar werden zu lassen.Gesellschaftliche Perspektive
Alles in allem: Das Projekt hat das Potenzial, im gesellschaftlichen Umfeld einen Nutzen zu erzeugen.Unternehmerische Perspektive
Alles in allem: Das Projekt hat das Potenzial, innovativ und wirtschaftlich tragfähig zu sein.Subjektiv wahrgenommene Zukunftstauglichkeit
Nach Abwägen aller Aspekte: Das Projekt ist tauglich, in Zukunft eine nachhaltige Ausdrucksform von Kirche zu sein.
Für jedes Item wurden die Teilnehmenden gebeten, ihre Einschätzung auf einer Likert-Skala von 1 („stimme gar nicht zu“) bis 6 („stimme voll & ganz zu“) abzugeben. Diese Skala erlaubt eine differenzierte Bewertung der Ausprägung jedes Items. Zudem wurde die Möglichkeit gegeben, „keine Antwort“ anzukreuzen.
Ergebnisse
Beteiligung und Stichprobenzusammensetzung
Insgesamt konnten 408 Fragebögen in die Auswertung einbezogen werden. Um die Anonymität der Antwortenden zu wahren, wurden lediglich drei zentrale Daten zur Person erfasst: Konfession, Geschlecht und Ebene (Obere/mittlere Führungsebene, Fachebene). Diese sozio-demographischen Daten sind auch geeignet, die Stichprobe zu beschreiben.
Die Stichprobe enthält 55 % römisch-katholische und 45 % evangelische Personen. 0,5 % gehören anderen Konfessionen an.
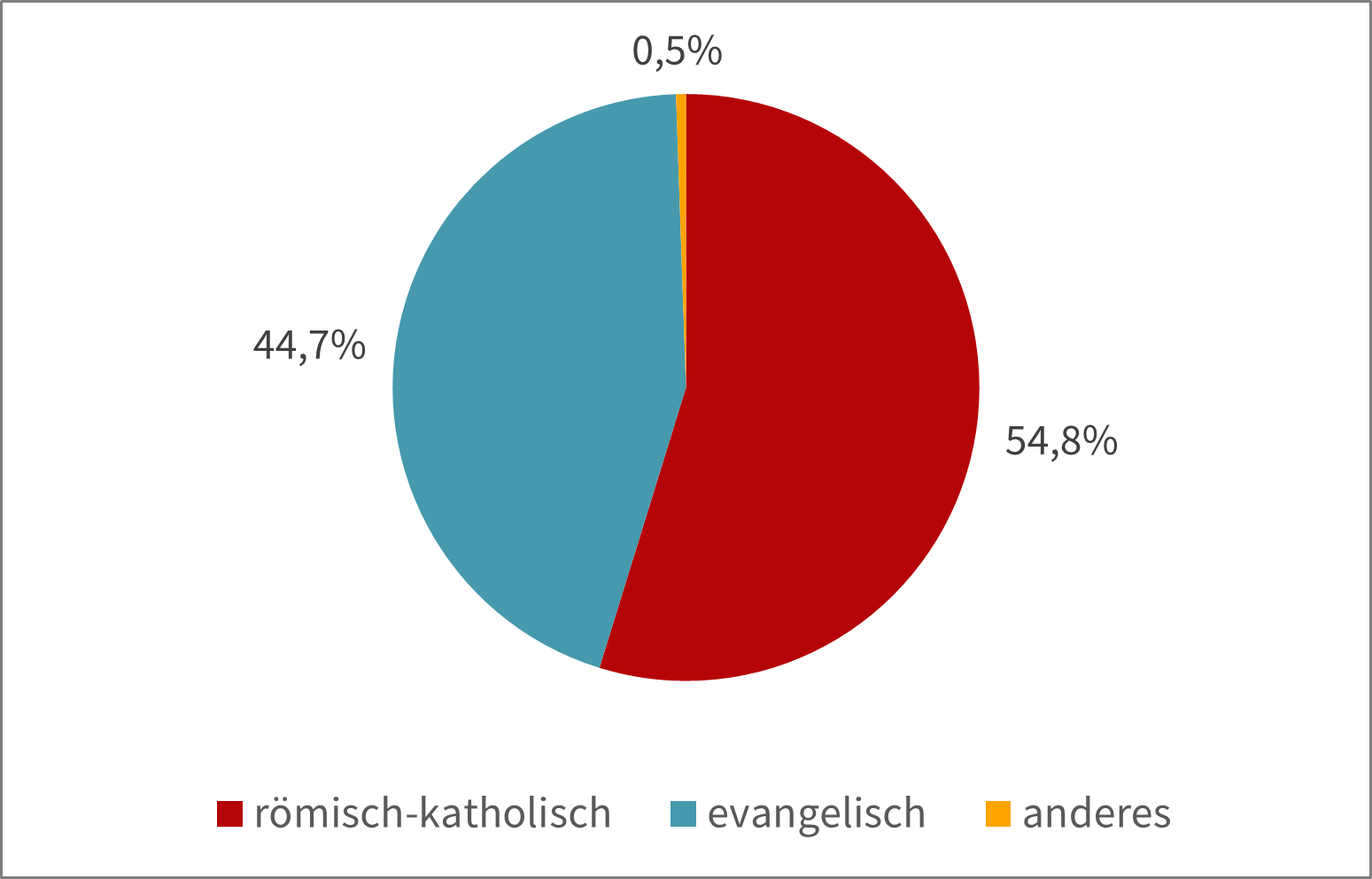
Von den an der Befragung Beteiligten identifizierten sich 53 % als männlich, 47 % als weiblich und 0,3 % als divers.
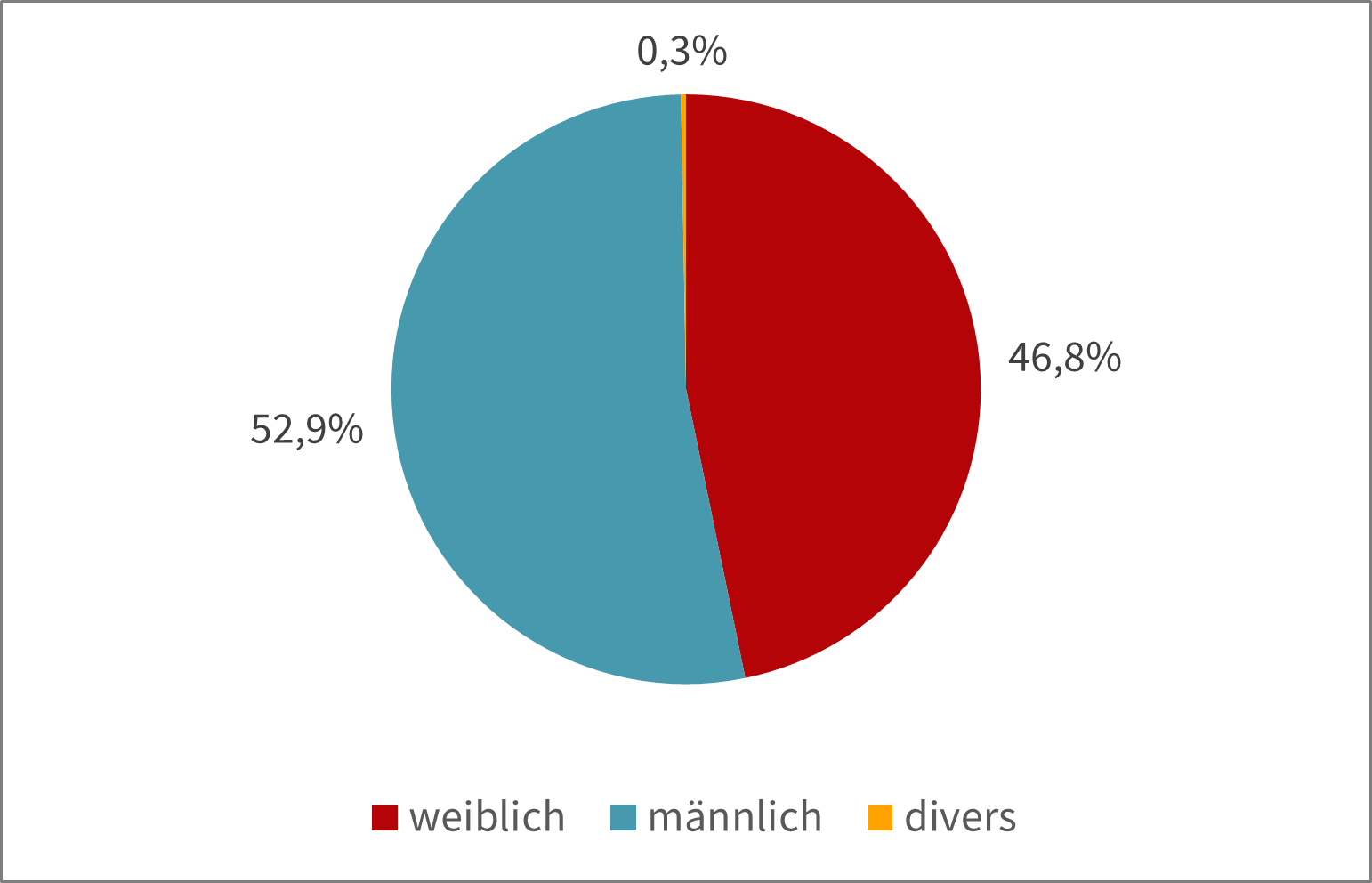
Mehr als die Hälfte der Befragten kommen aus der Kirchenleitung oder ihrer Verwaltung. Ein gutes Viertel entstammt der Seelsorge bzw. Pastoral.
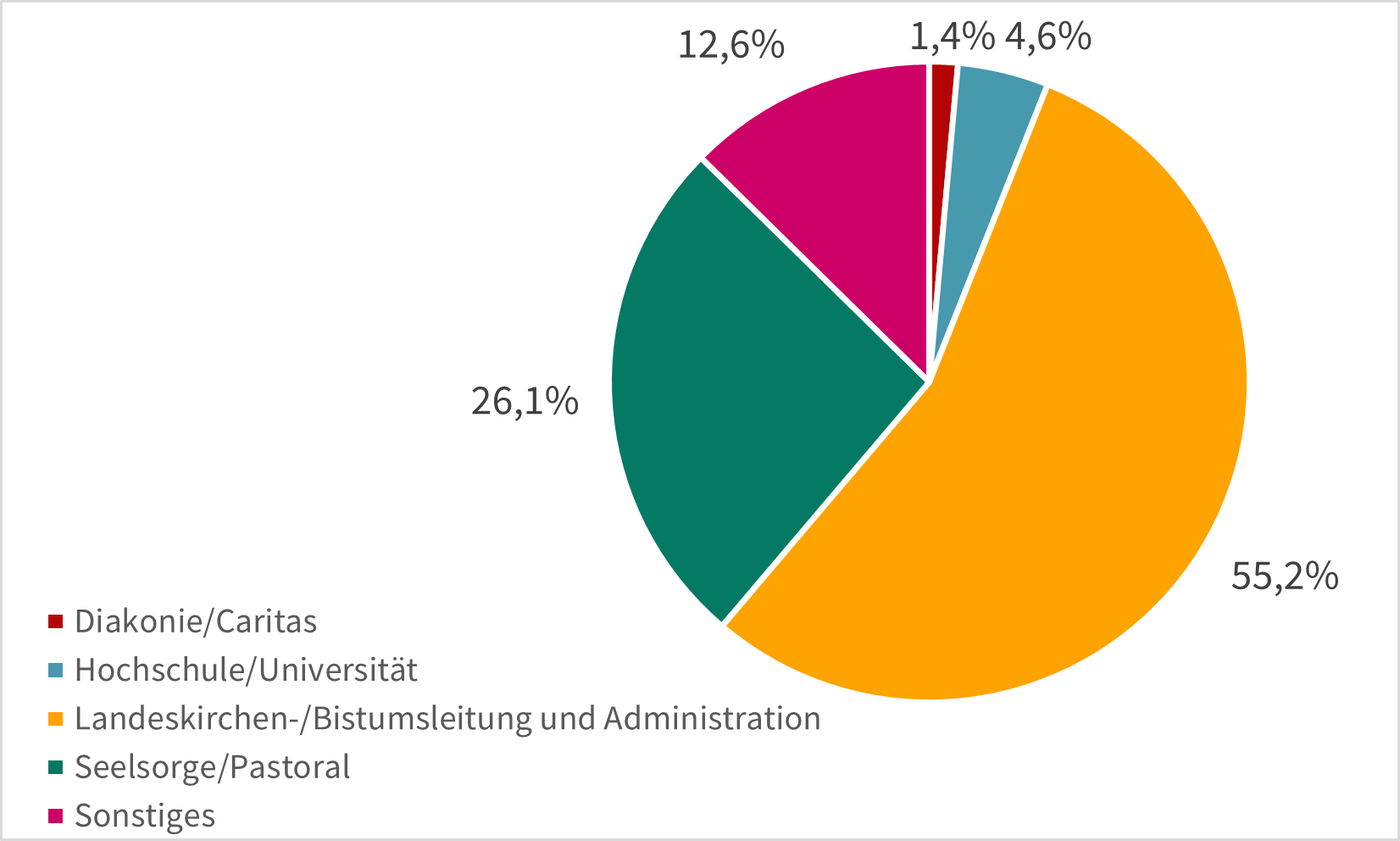
Von den an der Befragung Beteiligten gehörten 21 % zur oberen Führungsebene, 47 % zur mittleren Führungsebene und 30 % zur Fachebene.
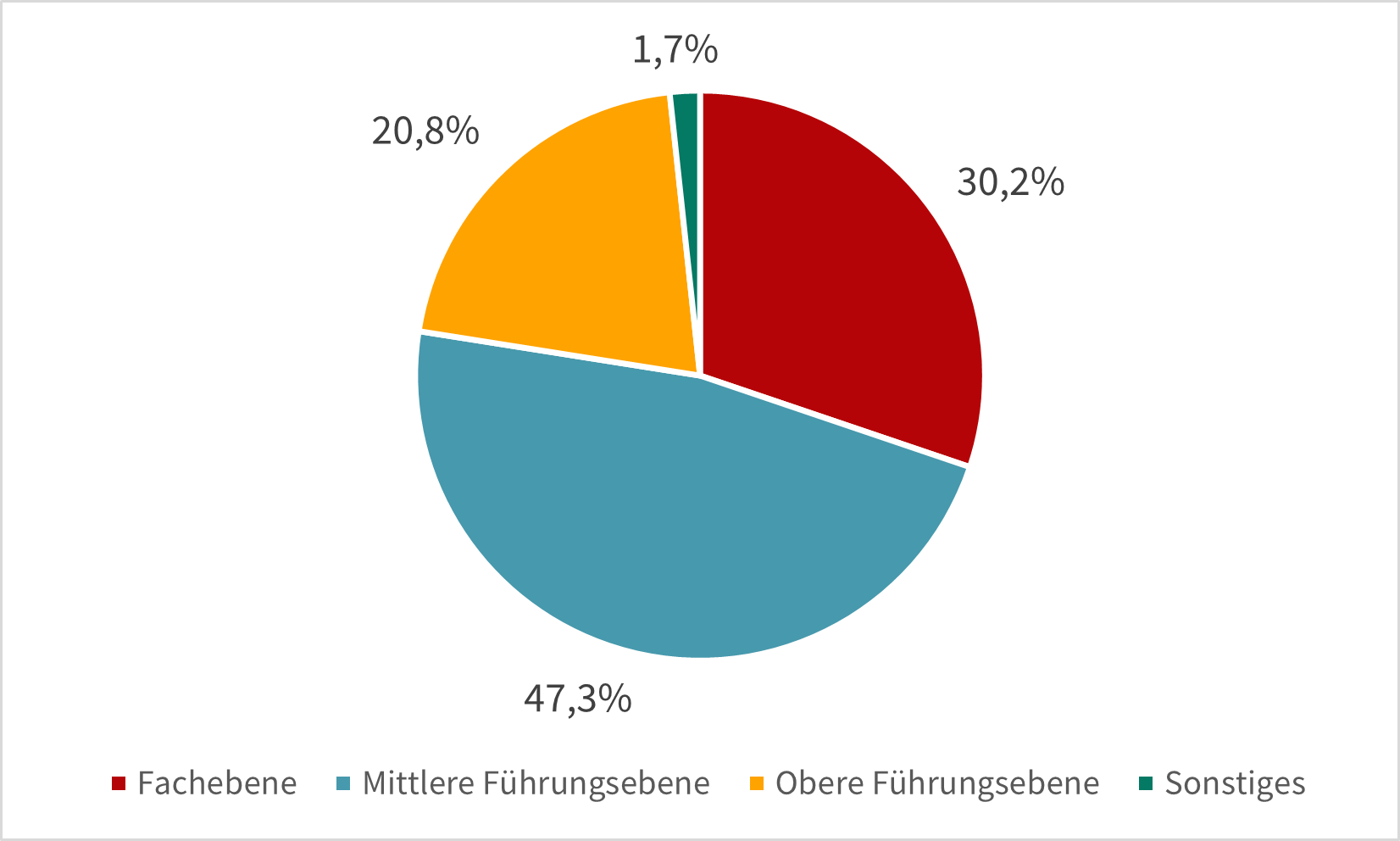
Subjektive Einschätzung der Tauglichkeit der Geschäftsmodelle
Im Folgenden werden je Geschäftsmodell die Ergebnisse (Mittelwerte) zu den Einschätzungen der Dimensionsfragen sowie die Gesamtbeurteilung der Zukunftstauglichkeit vorgestellt.
In der Befragung wurden die Geschäftsmodelle zufällig zugeordnet, es haben also nicht alle Teilnehmenden die gleichen Modelle beurteilt. Unterschiede in den Bewertungen können daher nicht nur auf die Modelle, sondern auch auf individuelle Wahrnehmungen, Vorerfahrungen oder Präferenzen der Beurteilenden zurückzuführen sein. Dadurch ergibt sich methodisch bedingt keine vollständige Vergleichbarkeit der Modelle.
Coworking-Space für soziale und kirchliche Innovation
Das erste Projekt ist ein kirchlicher Coworking-Space, der Sozialunternehmer:innen, Innovator:innen und kirchliche Mitarbeitende anspricht. Es bietet Infrastruktur für Projektentwicklung, Kooperationen und gesellschaftlichen Dialog sowie Kunst- und Kulturformate. Strategische Partner sind Social Impact Hubs und SEND e.V. Wichtige Ressourcen sind zentral gelegene Räume und Kompetenzen im Community- und Eventmanagement. Die Finanzierung erfolgt über kirchliche Mittel, Vermietung, Fördermittel, Fundraising und Veranstaltungsbeiträge.
N = 90
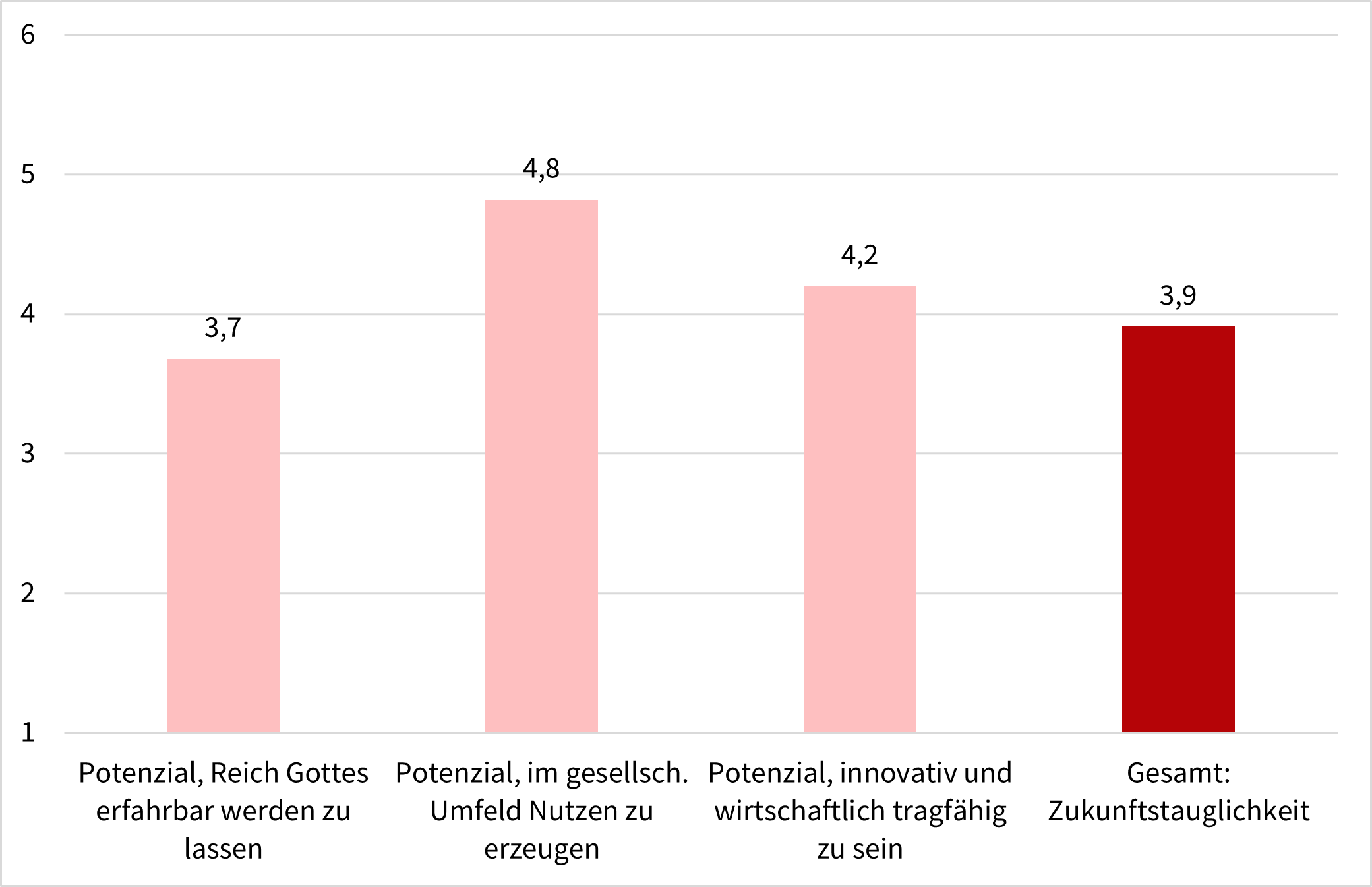
Diakonische Organisation
Diese Organisation mit 30 Einrichtungen reagiert mit sozialen Dienstleistungen, Bildungsangeboten und Projekten auf gesellschaftliche Herausforderungen. Sie unterstützt benachteiligte Menschen, fördert Gemeinschaft und persönliche Entwicklung und schafft Kontaktflächen mit dem Evangelium. Hauptpartner sind die öffentliche Hand, Stiftungen und kirchliche Netzwerke wie Fresh X. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch öffentliche Mittel, betriebliche Erträge und Spenden. Wichtige Ressourcen sind Immobilien, 400 Haupt- und 700 Ehrenamtliche sowie starke Netzwerke. Zu den Kernprozessen gehören der Betrieb der Einrichtungen, Fundraising und die Förderung der Mitarbeitenden. 55 % der Ausgaben entfallen auf Personal.
N = 82
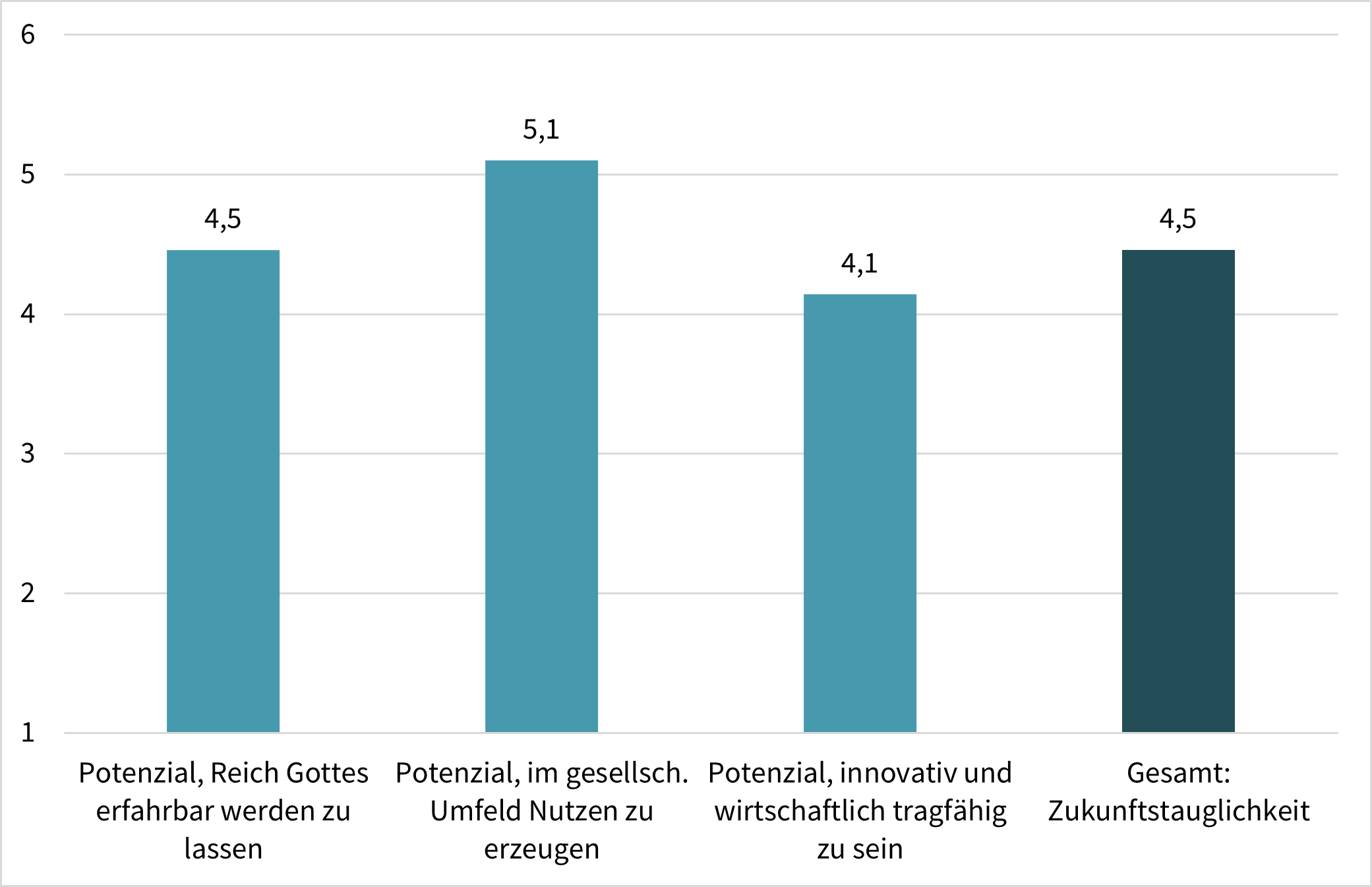
Digitale Community
Diese digitale Community schafft durch moderne Kommunikationswege einen inklusiven Raum für Glaubenserfahrungen und begleitet Menschen in ihrem Alltag. Sie richtet sich an jene, die sich in traditionellen Kirchen nicht zuhause fühlen, und bietet spirituelle Unterstützung, Gemeinschaft und kreative Angebote. Hauptplattformen sind WhatsApp und Instagram. Partner sind mehrere Bistümer und Landeskirchen. Wichtige Ressourcen sind digitale Infrastruktur und Mitarbeitende mit Kompetenzen in digitaler Kommunikation und spiritueller Begleitung. Die Finanzierung erfolgt über Trägerbistümer, Landeskirchen sowie Fördergelder.
N = 75
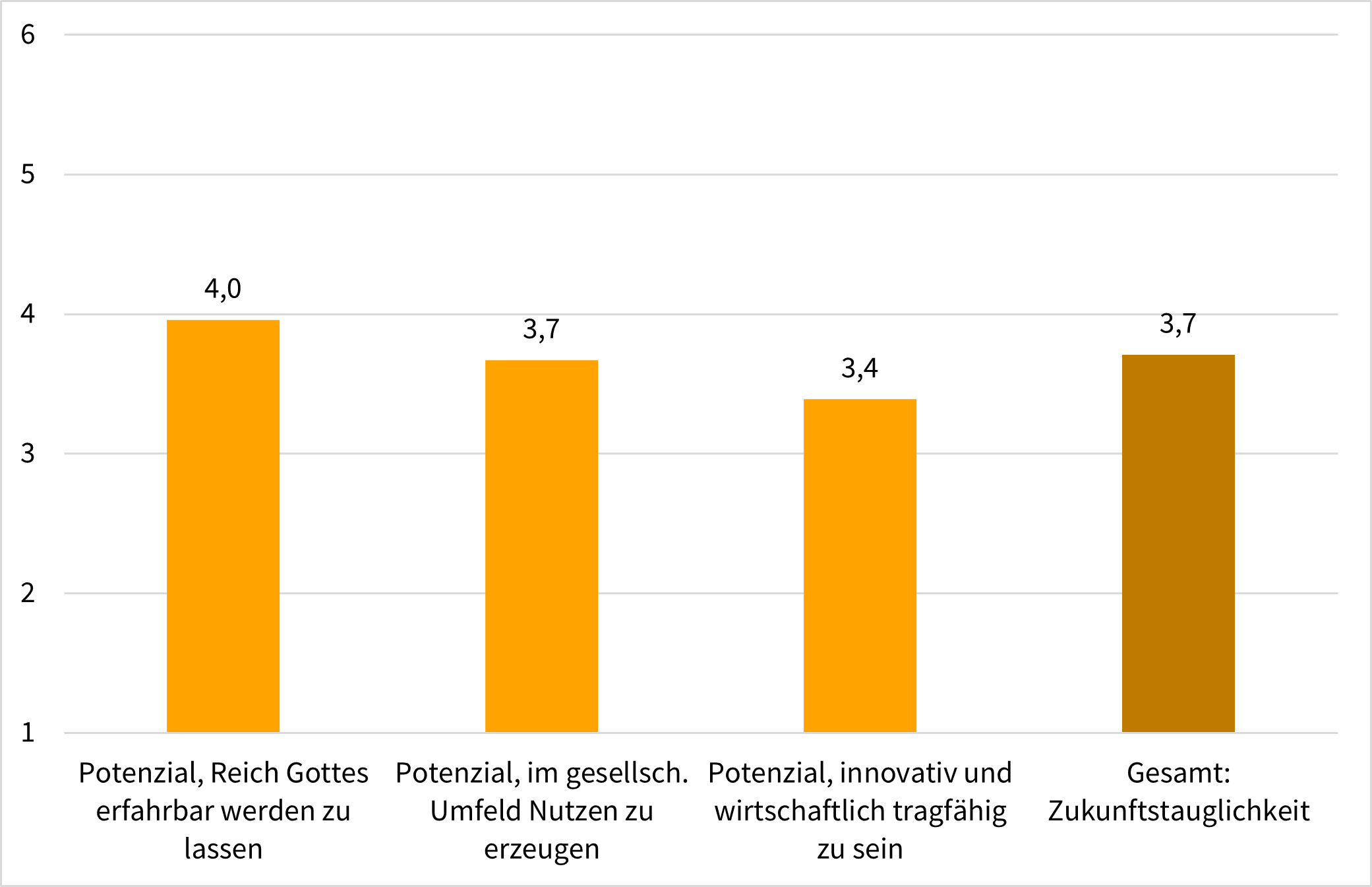
Missionarische Bewegung
Die Missionarische Bewegung richtet sich an Studierende, die nach Sinn, Gemeinschaft und Glauben suchen, und begleitet sie auf ihrem Glaubensweg. Ziel ist es, zukünftige Führungskräfte zu inspirieren und im Sinne der Nachfolge Jesu zu formen. Teams von Missionaren arbeiten an Universitäten mit Hochschulgemeinden und unter der Beauftragung des Bischofs. Wichtige Ressourcen sind Missionare mit Hochschulabschluss, Spendengelder und Materialien für Bibelgruppen. Die Finanzierung erfolgt überwiegend über Spenden, während die Hauptausgaben Gehälter und Campusaktivitäten betreffen.
N = 80
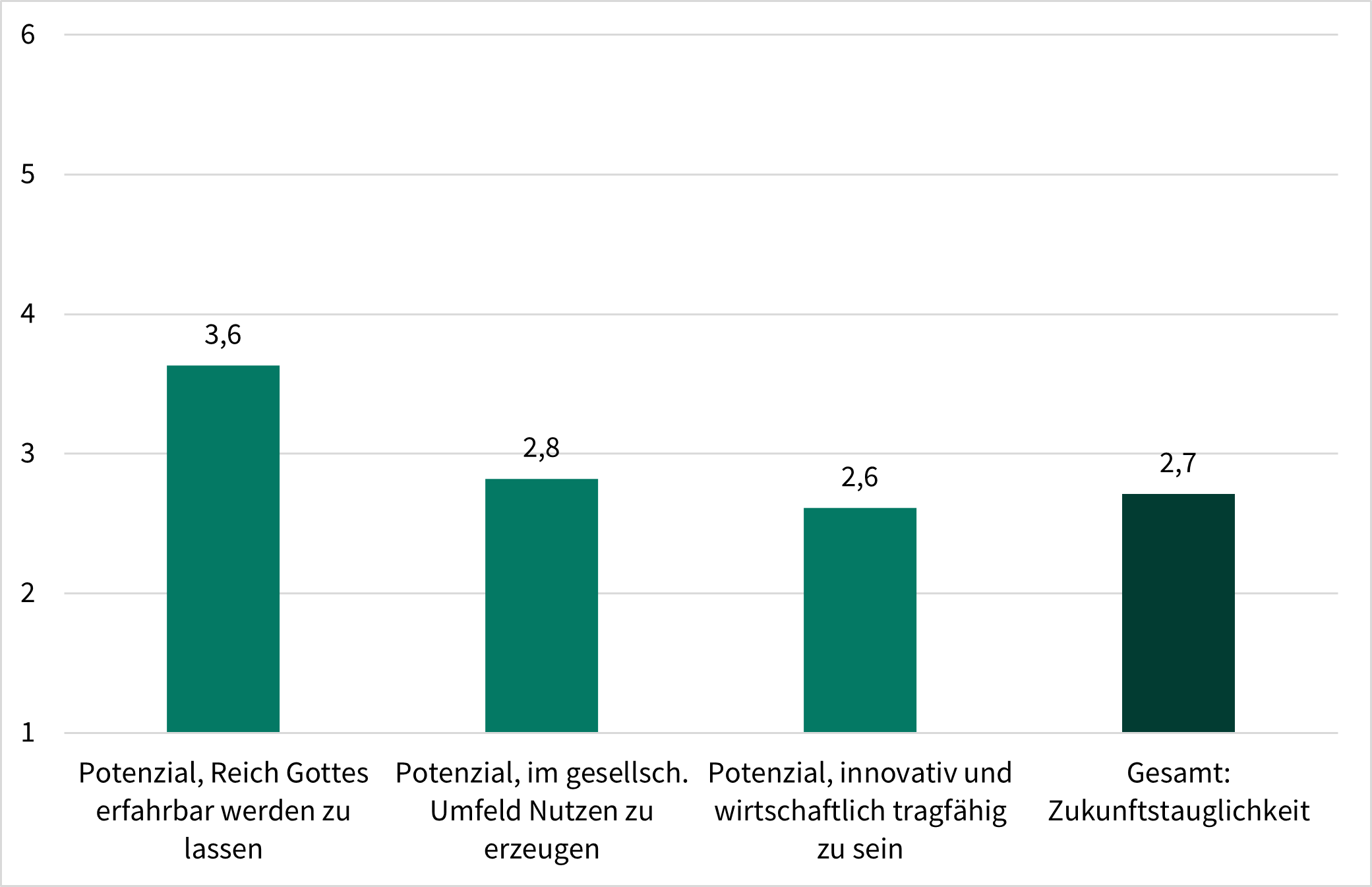
Digitaler spiritueller Ort
Dieser digitale Raum für Meditation und christliche Mystik vermittelt spirituelle Praktiken und ermöglicht gemeinsames Üben. Nutzer:innen können sich über eine kostenlose App informieren und Verbundenheit erfahren. Unterstützt wird ein erfahrungsbasierter Glaube, der innere Gelassenheit und persönliches Wachstum fördert. Das Projekt wird von einer evangelischen Kirche getragen und ist Teil der Fresh-X-Bewegung. Wichtige Ressourcen sind technisches Equipment, eine App und eine hauptberufliche Leitung. Einnahmen stammen aus Abos, Online-Kursen und Produkten, während die Kirche die Leitung finanziert.
N = 86
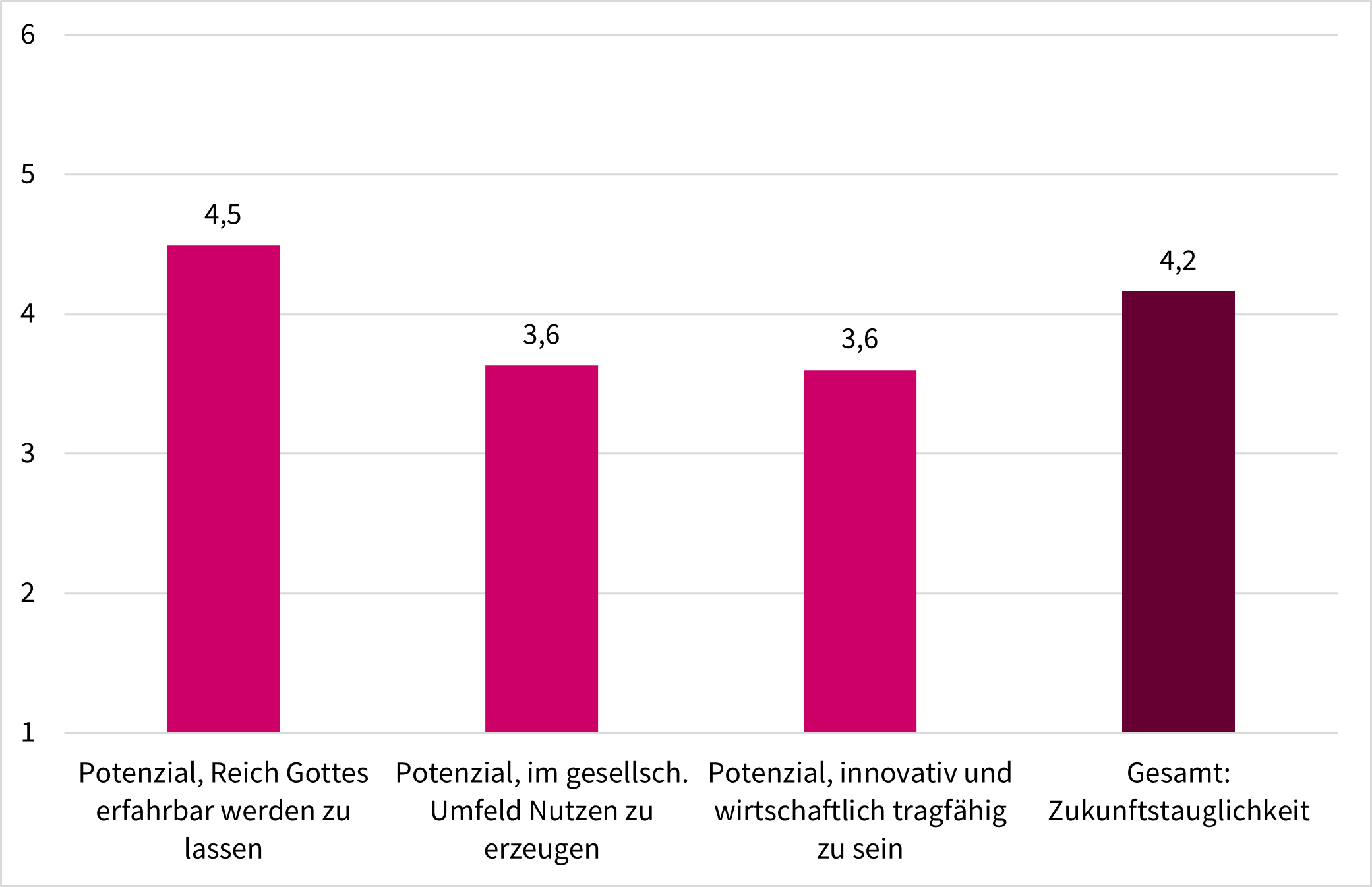
Pop-up Kirche als Urbane Intervention
Die Pop-up Kirche ist kein Gebäude, sondern ein Projekt und bringt durch überraschende Aktionen an Orten wie U-Bahn-Stationen oder Märkten religiöse Inhalte in den Alltag und ermöglicht spontane Begegnungen. Sie richtet sich an Menschen im öffentlichen Raum, die zufällig auf die Aktionen treffen, und vermittelt den christlichen Glauben durch Gespräche und symbolische Handlungen. Das Projekt wird von einer zentralen kirchlichen Stelle organisiert, die Aktionen entwickeln Teams von fünf bis acht Personen. Wichtig sind Kreativität, Kommunikationsfähigkeit und Kontextorientierung. Die Sachkosten, meist zwischen 100 und 300 Euro pro Aktion, trägt die Kirche, ebenso die Personalkosten; Einnahmen werden nicht generiert.
N = 81
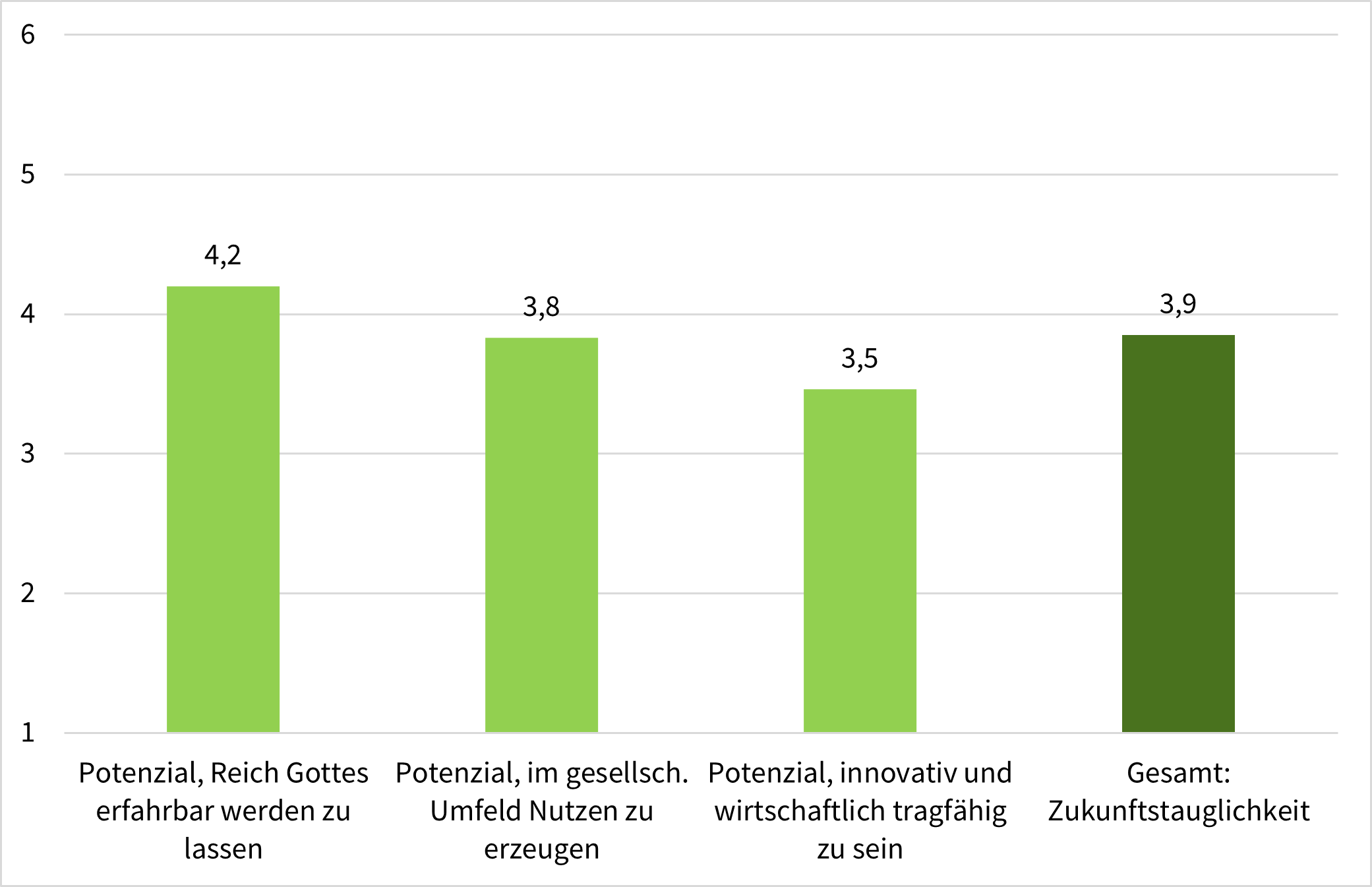
Ritualagentur
Die Ritualagentur begleitet Menschen in bedeutenden Lebensmomenten mit kreativen, lebensnahen und individuellen Ritualen, die traditionelle kirchliche Formen ergänzen oder ersetzen. Sie spricht insbesondere Menschen an, die spirituelle Begleitung suchen, aber mit klassischen kirchlichen Angeboten nicht übereinstimmen. Die Leistungen umfassen maßgeschneiderte Rituale wie Hochzeiten, Taufen und Bestattungen sowie Pop-up-Aktionen. Wichtige Partner sind Feierlocations, Medien und Bestatter:innen. Ressourcen sind ein Team aus hauptamtlichen Mitarbeitenden und Pastor:innen sowie technische Ausstattung. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch Kirchensteuermittel und Spenden.
N = 78
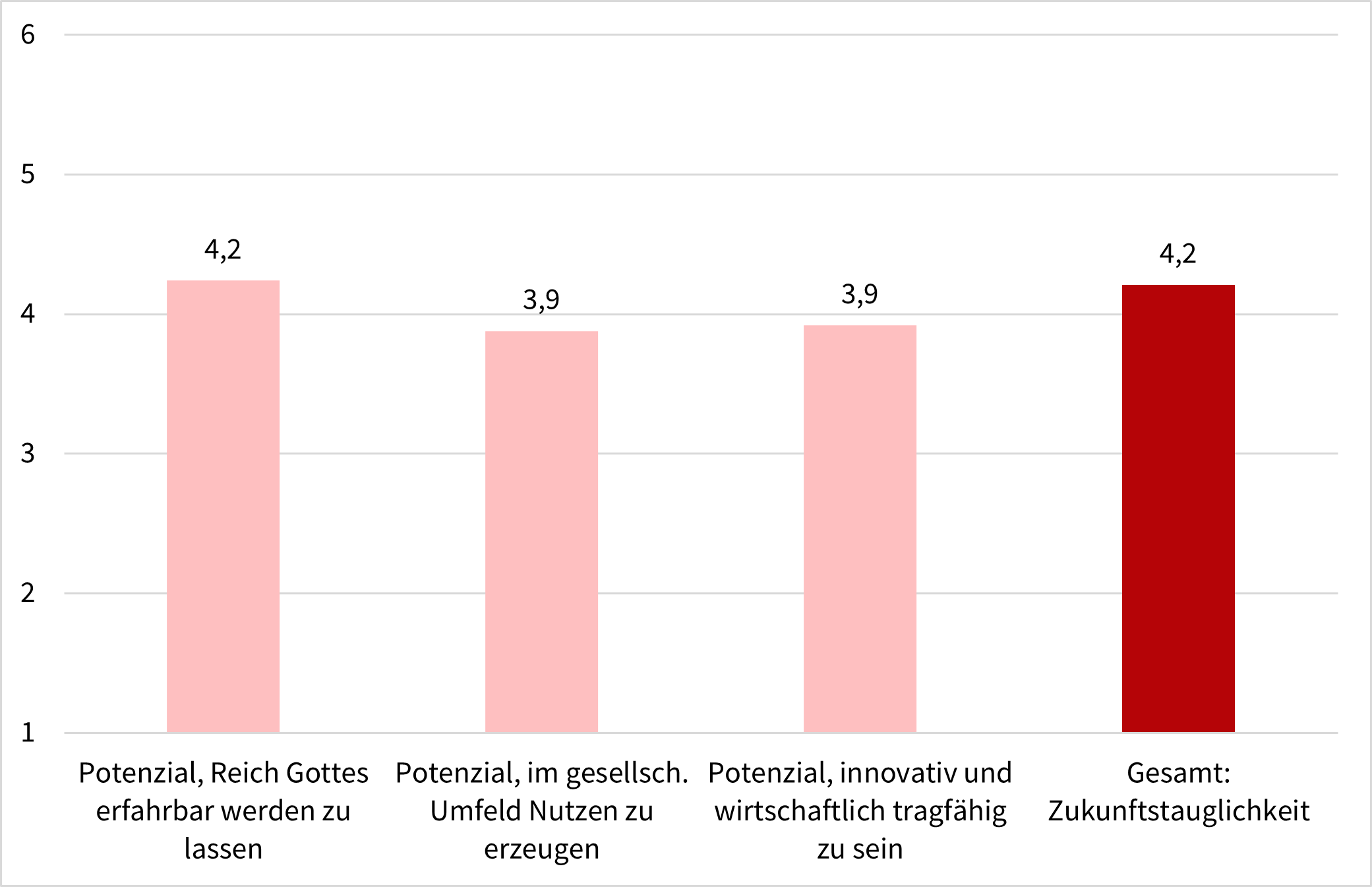
Neue Form von Gemeinde
Diese Plattform bietet spirituell Suchenden, die in traditionellen Strukturen keine Heimat finden, Inspiration, Begegnung und gemeinsames Engagement. Die Zielgruppe wird durch Netzwerke, hybride Gottesdienste und digitale Kanäle angesprochen. Angebote umfassen Gottesdienste in Eventlocations, diakonale Projekte und gemeinsames Lernen. Projekt H arbeitet mit städtischen Behörden, Vereinen und Initiativen zusammen. Ressourcen sind ein Team aus hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden sowie geeignete Räumlichkeiten. Die Finanzierung erfolgt über Spenden, Projektzuschüsse und Unterstützung durch Land, Stadt und Kirche, mit dem Ziel einer langfristigen Integration in den Regelbetrieb der Kirche.
N = 90
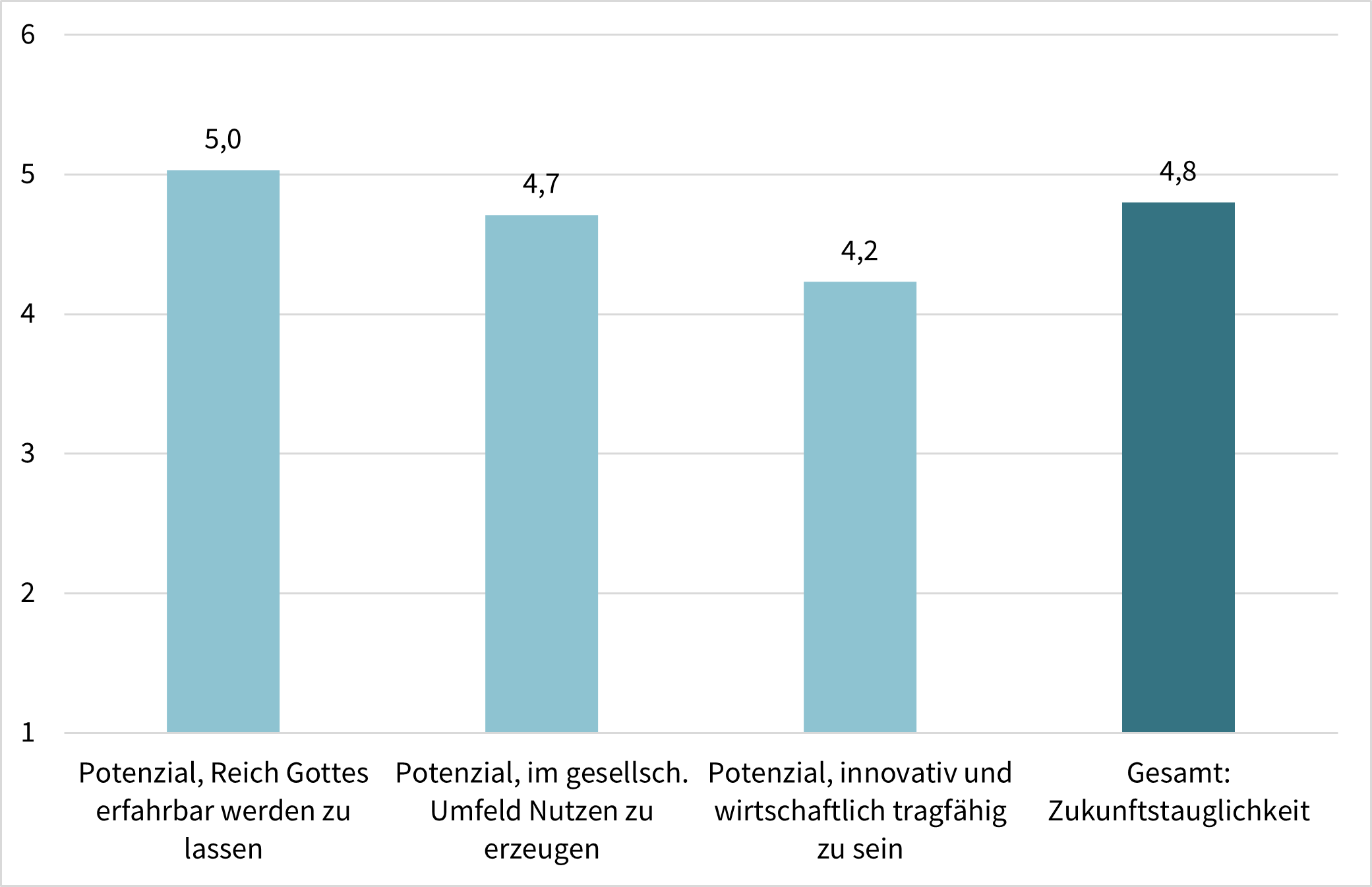
Kunst- & Kultur-Kirche
Dieser gemeinnützige Verein nutzt eine umgewidmete Kirche als Ort für Sinnsuche, Inspiration und gesellschaftliche Impulse. Mit Projekten an der Schnittstelle von Kulturerbe, christlichem Glauben und Kunst spricht das Projekt spirituell Suchende, kirchlich Engagierte sowie kommunale und kirchliche Institutionen an. Es arbeitet mit Kommunen, Unternehmen und Vereinen zusammen und dient dem Bistum als Experimentierort. Wichtige Ressourcen sind die kostenfrei bereitgestellten Gebäude, drei hauptberufliche Mitarbeitende und ehrenamtliches Engagement. Einnahmen stammen aus Spenden und Raumvermietung, um Personal- und Projektkosten zu finanzieren.
N = 59
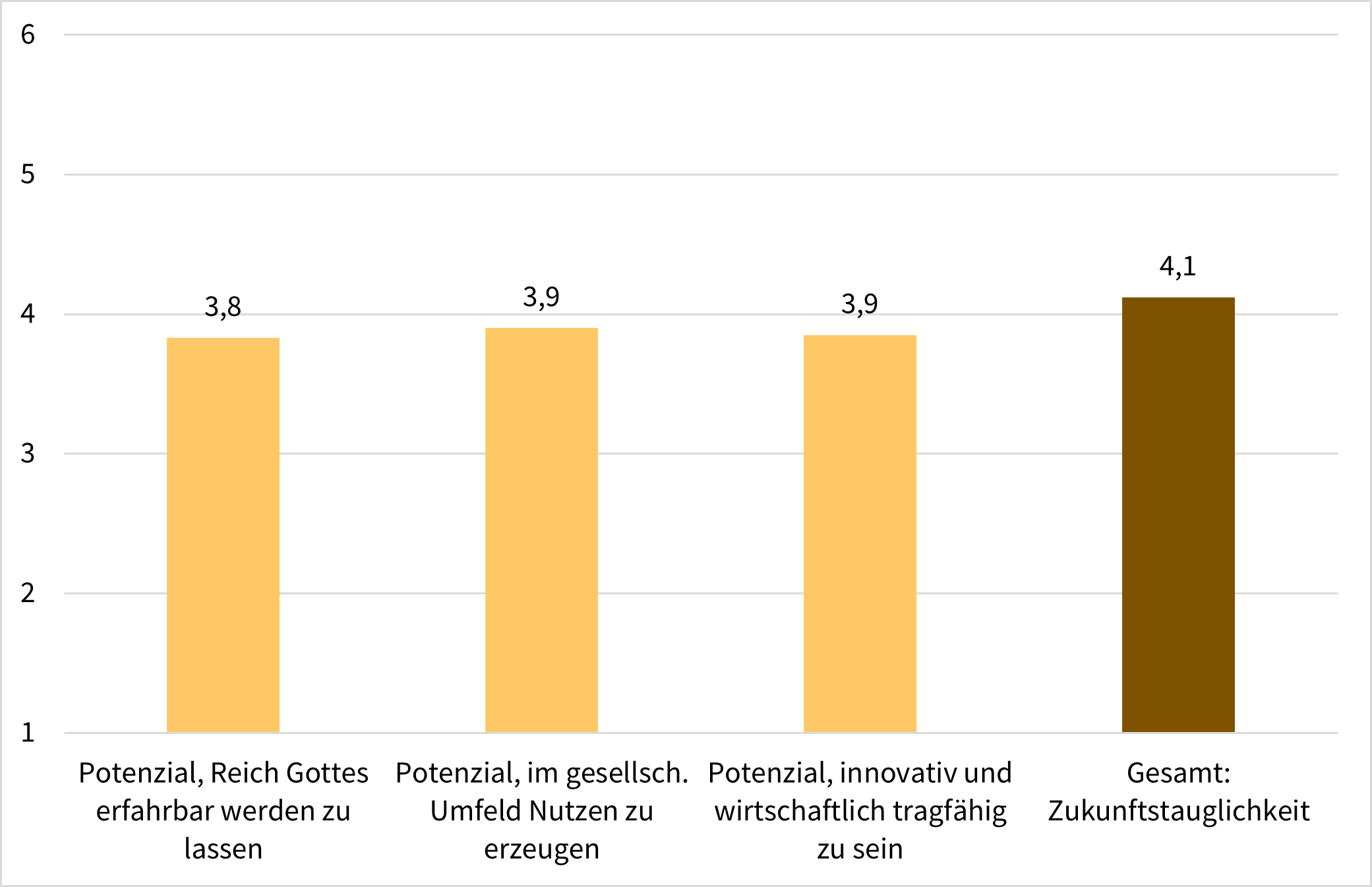
Präsenz in Shoppingmall
Dieses ökumenische Projekt betreibt ein Ladenlokal in einer Shoppingmall, das durch thematische Interaktionsflächen und Gesprächsmöglichkeiten Besucher:innen anspricht. Es bietet Raum für kreative Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und kirchlichen Themen, lädt zum Verweilen ein und ermöglicht Gespräche mit geschulten Ehrenamtlichen. Partner sind die evangelische und katholische Kirchengemeinde sowie der Mallbetreiber. Das Ladenlokal wird kostenfrei bereitgestellt, die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse, Spenden und Projektförderungen. Hauptressourcen sind 30 Ehrenamtliche und eine teilzeitbeschäftigte hauptamtliche Kraft.
N = 80
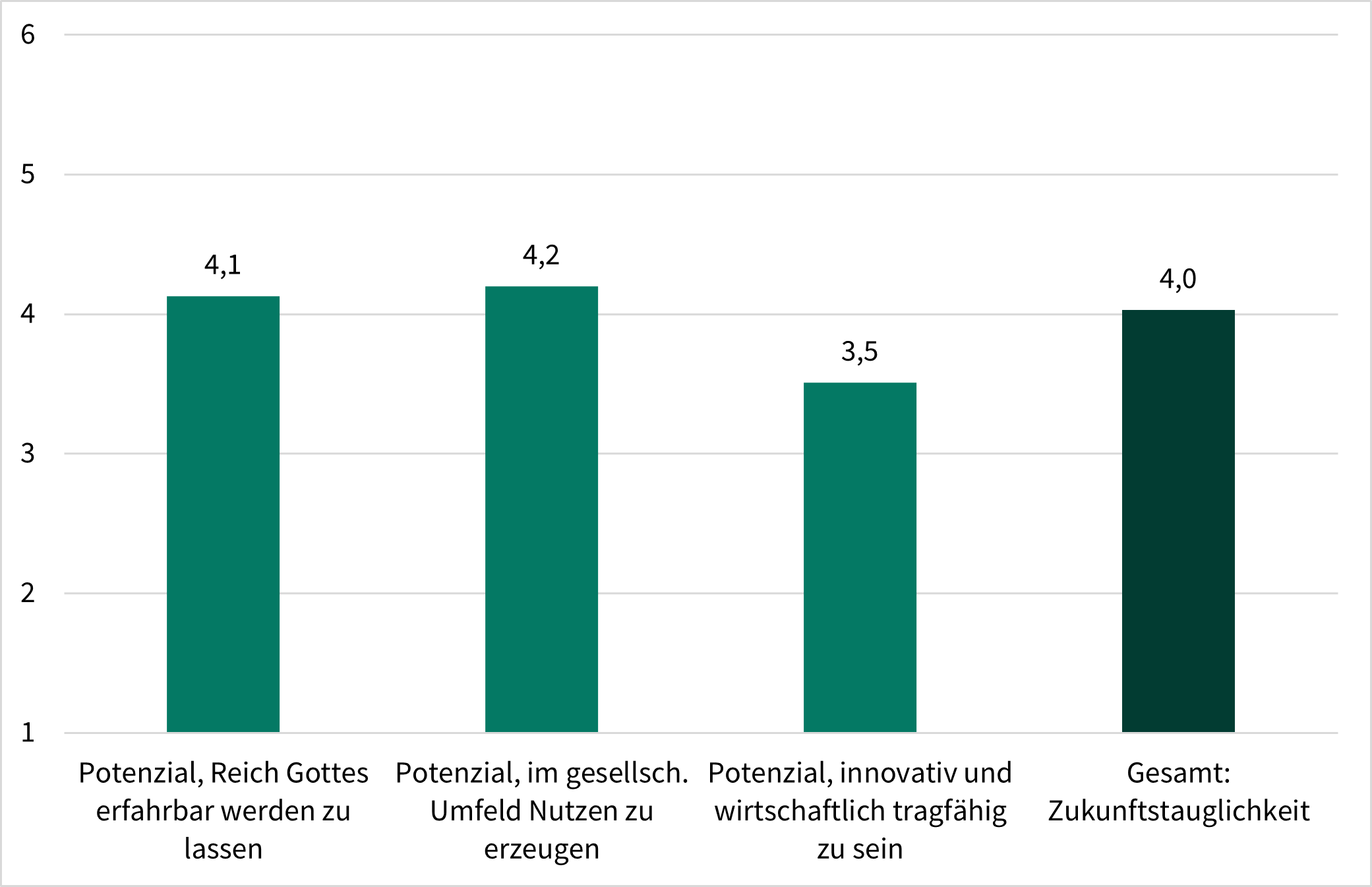
Community Organizing
Dieses projektbasierte Modell organisiert Gemeinschaft im städtischen Raum, um Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion zu verbinden und gemeinsam Lösungen für lokale Probleme zu entwickeln. Es schafft Begegnungsräume, stärkt Selbstermächtigung und fördert Projekte für Teilhabe, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Das Team besteht aus zwei haupt- und etwa 20 ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Berührungspunkte entstehen ereignishaft, z. B. durch ein Lastenrad, das im Quartier unterwegs ist. Partner sind Kommunen, Vereine und Kirchen. Die Finanzierung erfolgt über Kirchensteuern und Projektzuschüsse.
N = 84
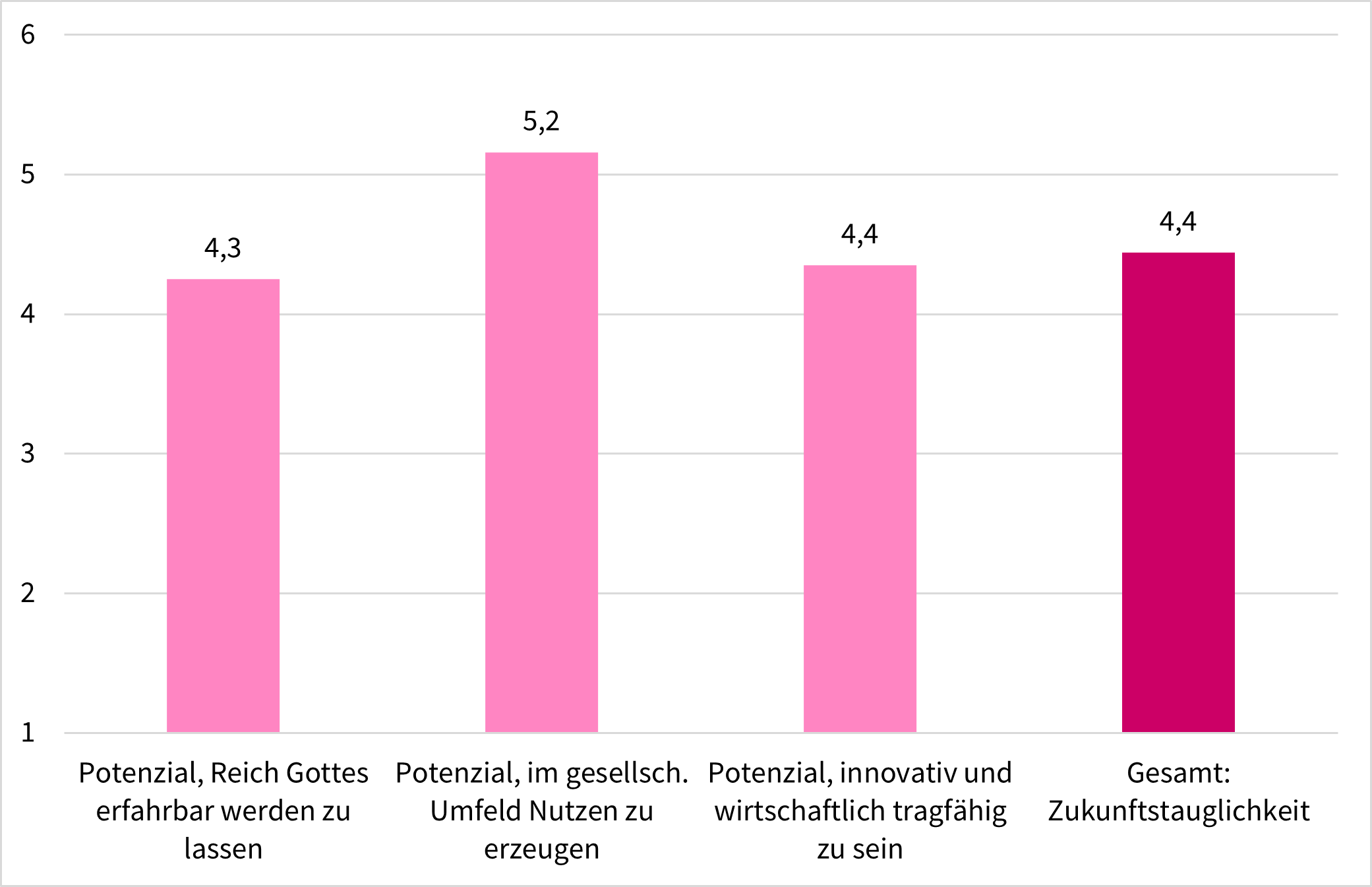
Allmende/Commons
Dieses Projekt öffnet eine Kirche mit zugehörigem Gelände für die Stadtgesellschaft und bietet Raum für soziale, kulturelle und künstlerische Projekte. Es richtet sich an Menschen und Gruppen, die gemeinsam Ideen entwickeln und umsetzen möchten. Zentrale Ressource ist das vielseitig nutzbare Kirchengebäude, kuratiert von zwei halbtags tätigen Fachkräften. Partner sind lokale Institutionen wie Museen, Behörden und Kulturschaffende. Die Finanzierung erfolgt durch das Bistum, kommunale Zuschüsse, Spenden und Raumnutzungsentgelte, um Personal- und Gemeinkosten zu decken.
N = 93
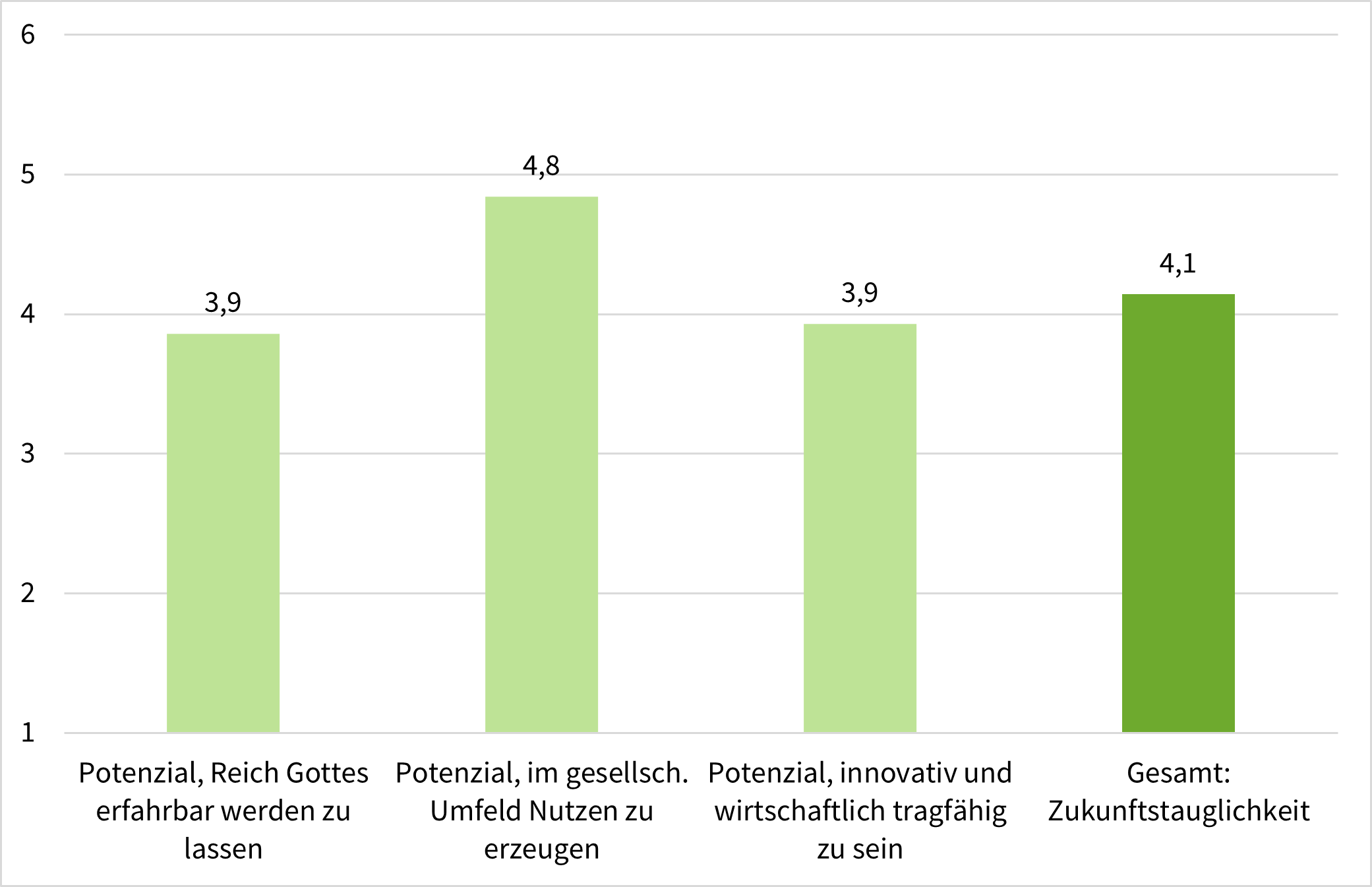
Mobile Kirche
Mit einem flexibel einsetzbaren Foodtrailer im Retro-Look bringt die Mobile Kirche punktuell christliche Botschaft und Begegnung in die Stadtgesellschaft. Je nach Anlass und Ort spricht das Projekt unterschiedliche Zielgruppen an, z. B. Besucher:innen von Stadtfesten oder Arbeiter:innen auf Baustellen. Der Trailer wird auch an kirchliche und soziale Organisationen sowie privat vermietet. Wichtige Ressourcen sind der Trailer, Material und 15 ehrenamtliche Mitarbeitende mit Kompetenzen in Organisation, Technik und Kommunikation. Die laufende Finanzierung erfolgt über Mieteinnahmen, Sponsoring und Spenden.
N = 86
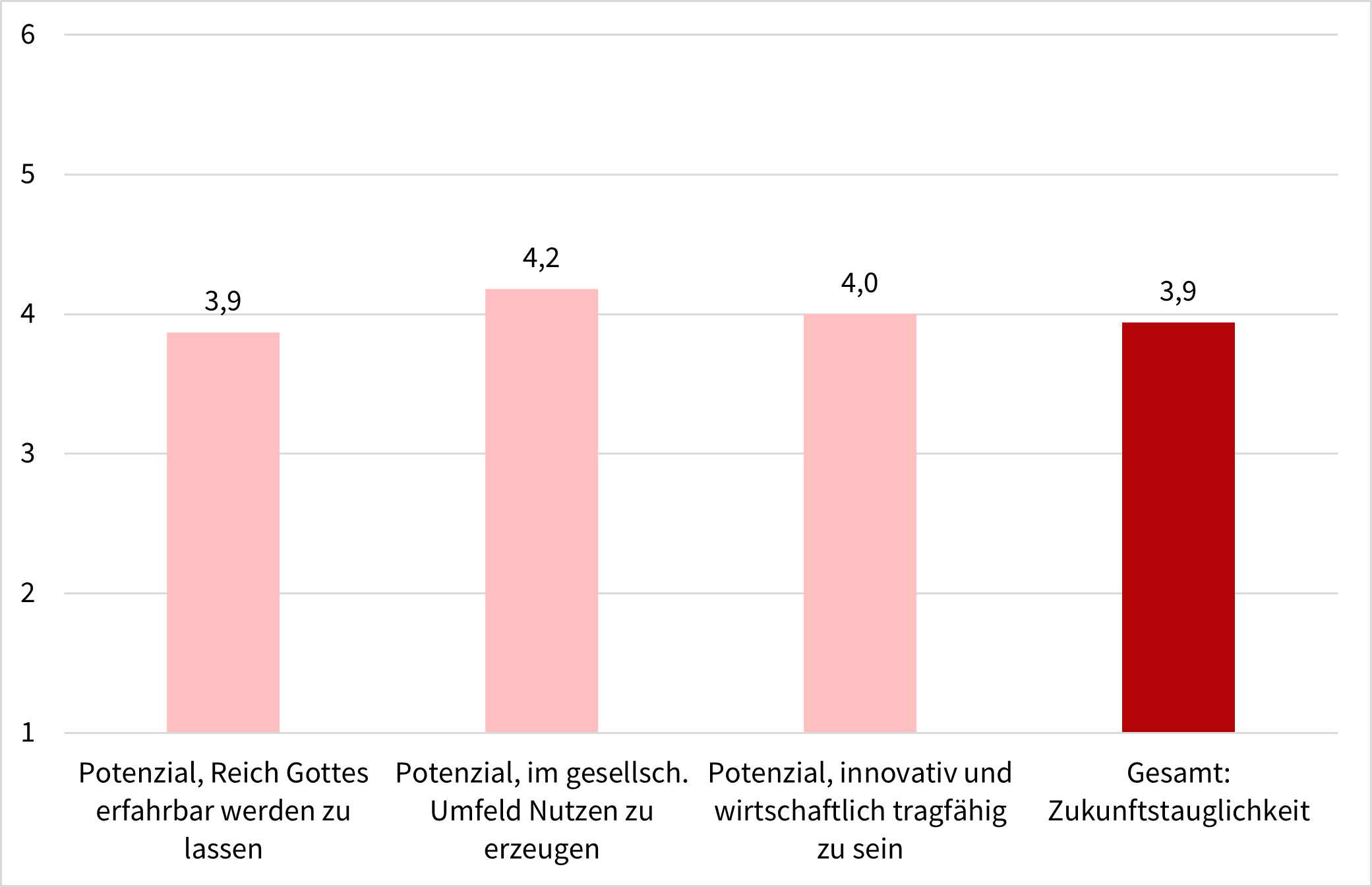
Christliche:r Influencer:in
Ein:e christliche:r Influencer:in nutzt digitale Plattformen wie TikTok, YouTube und Instagram, um christliche Botschaften authentisch und alltagsnah zu vermitteln. Die Zielgruppe besteht aus jüngeren Menschen, die spirituelle Orientierung und Austausch suchen. Inhalte umfassen Videos, Livestreams, Podcasts und Community-Events. Partner sind Plattformen, Verlage und kirchliche Organisationen. Wichtige Ressourcen sind technische Ausstattung, kreative und theologische Kompetenzen sowie Social-Media-Know-how. Einnahmen stammen aus Sponsoring, Spenden, Merchandising und Online-Kursen. Die Hauptausgaben entfallen auf Ausrüstung und Content-Produktion.
N = 81
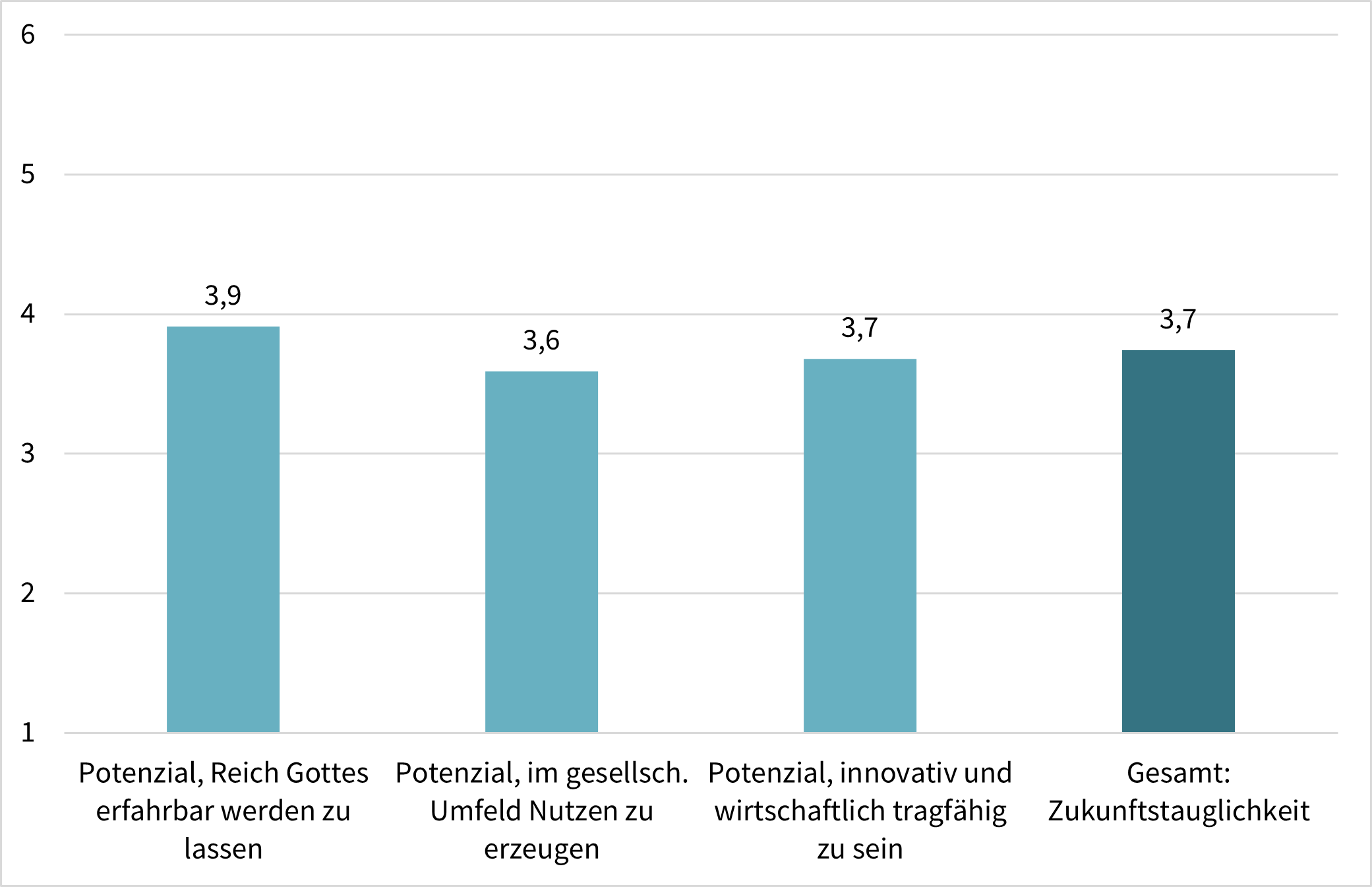
Zusammenfassende Betrachtung
Einschränkend muss beachtet werden: Die methodische Anlage, bei der Teilnehmende nur drei und zufällig ausgewählte Modelle bewerten, zeigt Unterschiede, die vermutlich nicht nur auf die Modelle, sondern auch auf subjektive Präferenzen zurückzuführen sind.
Gut abschneidende Modelle
Modelle wie „Neue Form von Gemeinde“, „Community Organizing“ und „Diakonische Organisation“ schneiden in allen Dimensionen gut bis sehr gut ab. Diese Modelle zeichnen sich durch eine starke Orientierung an den Bedürfnissen der Menschen, eine hohe Flexibilität und eine besonderes Augenmerk auf gesellschaftliche Wirkungen aus.
Bewährte Formen, neue Zielgruppen
Modelle wie die „Neue Form von Gemeinde“ und die „Diakonische Organisation“ zeichnen sich durch starke theologische Bewertungen aus. Sie verbinden Glaubenserfahrungen mit konkretem gesellschaftlichem Engagement und sprechen Zielgruppen an, die in traditionellen Formen weniger zu finden sind.
Hohe Relevanz der theologischen Dimension
Eine starke theologische Dimension ist kein automatischer Garant für Zukunftstauglichkeit, sie spielt aber in vielen Modellen eine zentrale Rolle. Sie ist deutlich von höherer Relevanz für die zugeschriebene Zukunftstauglichkeit als das Stiften von gesellschaftlichem Nutzen.
Digitalisierung
Modelle wie die Digitale Community und der:die christliche:r Influencer:in werden in der theologischen und gesellschaftlichen Dimension moderat bewertet. Dies zeigt Potenziale, aber auch Herausforderungen, digitale Angebote nachhaltig und wirksam zu positionieren. Dies könnte jedoch auch in den Präferenzen der Beurteilenden begründet sein.
Unternehmerische Tragfähigkeit als Herausforderung
Viele Modelle erhalten in der unternehmerischen Dimension niedrige Bewertungen – im Schnitt wird diese Dimension am niedrigsten eingeschätzt. Dies legt nahe, dass selbst bei innovativen Ansätzen für die Befragten oft keine nachhaltige wirtschaftliche Tragfähigkeit erkennbar ist.
Schwierigkeiten traditioneller Ansätze
Die Missionarische Bewegung erhält in allen Dimensionen vergleichsweise niedrige Werte. Dies könnte darauf hindeuten, dass stark missionarische Konzepte von den Befragten grundsätzlich kritisch gesehen oder heute als weniger anschlussfähig an die Lebensrealität vieler Menschen eingeschätzt werden.
Fazit
Die vorliegende Studie liefert erste Einsichten in die Analyse der Zukunftstauglichkeit kirchlicher Geschäftsmodelle, bietet aber zugleich Potenziale für vertiefte Auswertungen. Die in der Einleitung genannten Forschungsfragen markieren zentrale Themenfelder, die in weiteren Analysen detaillierter untersucht werden müssen:
Die vorliegende Studie liefert erste Einsichten in die Analyse der Zukunftstauglichkeit kirchlicher Geschäftsmodelle, bietet aber zugleich Potenziale für vertiefte Auswertungen. Die in der Einleitung genannten Forschungsfragen markieren zentrale Themenfelder, die in weiteren Analysen detaillierter untersucht werden müssen:
Unterschiede in Teilstichproben
Ein Auswertungsbedarf liegt in der Untersuchung von Unterschieden zwischen Teilstichproben. Dabei werden personenbezogene Merkmale wie der konfessionelle Hintergrund (evangelisch, katholisch) oder die Ebene (obere/mittlere Führungsebene, Fachebene) herangezogen werden. Eine solche Analyse wird zeigen, ob die Wahrnehmung der Geschäftsmodelle oder die Wichtigkeit von Beurteilungskriterien sich signifikant unterscheiden und worin der Unterschied liegt.
Vertiefung der Dimensionenanalyse
Während die Ergebnisse zeigen, dass die theologische Dimension einen starken Einfluss auf die wahrgenommene Zukunftstauglichkeit hat, bleibt die Interaktion zwischen den Dimensionen theologisch, gesellschaftlich und unternehmerisch offen. Eine detaillierte Analyse kann klären, wie die Dimensionen die eingeschätzte Gesamttauglichkeit beeinflussen. Zudem ist zu prüfen, welche Relevanz die einzelnen Merkmale der Dimensionen haben.
Direkte Bewertung der Wichtigkeiten von Kriterien und faktischen prädiktiven Relevanz
Der Zusammenhang und die Unterschieden zwischen direkt benannter Wichtigkeit der Kriterien und ihrer faktischen prädiktiven Relevanz in Urteilen zur Einschätzung der Zukunftstauglichkeit von Geschäftsmodellen sind hoch interessant können Aufschluss darüber geben, wie Urteile zustande kommen.
Einfluss individueller Vorlieben auf die Beurteilung der Geschäftsmodelle
Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass individuelle Präferenzen wie persönliche Erfahrungen oder Werte der Befragten eine Rolle spielen könnten. Dies ist genaue zu untersuchen.
Innovationsfähigkeit und wirtschaftliche Tragfähigkeit
Die unternehmerische Dimension weist in vielen Modellen Schwächen auf. Eine gezielte Analyse der wirtschaftlich erfolgreichsten Modelle könnte Handlungsempfehlungen liefern, wie kirchliche Organisationen ihre Geschäftsmodelle robuster gestalten könnten.
Entwicklung eines Instrumentariums zur Einschätzung von Geschäftsmodellen
Schließlich wäre ein praxistaugliches Instrumentarium zu entwickeln, das kirchlichen Organisationen bereits in frühen Phasen der Geschäftsmodellentwicklung zur Verfügung steht.

Praxis
Exnovation – Freiraum schaffen
Bedingung der Möglichkeit von Transformation – ein praktischer Zugang
Unsere Gesellschaft befindet sich in einem epochalen Umbruch. Für die Kirchen kommt hinzu, dass es ihnen kaum noch gelingt, ihre Botschaft und ihr Tun zu plausibilisieren. Sie verlieren dramatisch an Relevanz und in der Folge ihre Mitglieder und ihre finanzielle Basis. Beides, gesellschaftlicher Wandel und Verlust an Umweltreferenz, führen zunehmend zu Dissonanzen und Dysfunktionalitäten. Während der Anpassungsdruck steigt, zeigen zugleich Reformen innerhalb der bestehenden Organisationslogik keine nachhaltigen Effekte. Sie binden Ressourcen und haben lediglich kosmetischen Charakter. Die Kirchen müssten sich aber umfassend und grundlegend verändern, wenn sie sich Zukunft offenhalten wollen.
Herausforderung
Systeme können nicht maximal performen und zugleich optimal lernen – für beides muss hinreichend Raum sein; beides muss in einer guten Balance sein. Je mehr ein System seine Umweltreferenz verliert, desto höher wird das Risiko, den notwendigen Anpassungssprung nicht zu schaffen. Daher müssen die Kirchen ihre Aufmerksamkeit auf allen Ebenen sehr viel stärker als bisher auf Innovation und Transformation richten und die verbleibenden personellen und finanziellen Ressourcen – solange sie noch da sind – substanziell hierfür einsetzen.
Voraussetzung für die erfolgreiche Gestaltung nachhaltiger Innovations- und Transformationsprozesse ist jedoch, dass hierfür hinreichend Mittel zur Verfügung stehen. Kirche ist jedoch auf Stabilität programmiert. Die Bemühungen, die sich seit Jahren verstärkende Krise in den Griff zu bekommen, laufen meist nach alten Mustern ab: Sie dienen der Aufrechterhaltung der bisherigen Funktionalität, deren Output jedoch nicht mehr nachgefragt wird.
Gegenstand und Fragestellung
Doch wie kann das gehen: Ein Modell von Kirche, das volkskirchliche, das über Jahrzehnte erfolgreich war, grundlegend in allen seinen Facetten zu erneuern? Die Dinge, die man selbst als hauptberuflich oder ehrenamtlich Tätige gelernt, viele Jahre lang erfolgreich praktiziert und u. U. auch immer wieder in begrenztem Rahmen weiterentwickelt hat, durch etwas ersetzen, von dem man nicht weiß, ob es denn überhaupt funktioniert? Und sich denen zuwenden, die nicht kommen?
Die Ausrichtung derjenigen, die über Jahrzehnte auf die bewährte Weise ihren Dienst geleistet haben, lässt sich nicht mit einem Schalter aus- oder umdrehen. Das Arrangement aller Beteiligten, es noch eine kurze Strecke auf den alten Pfaden zu versuchen, ist überstark. Die Minderheit derjenigen, für die Veränderungen in der Kirche den Untergang des Abendlandes bedeutet, ist schrill und findet katholischerseits oftmals Gehör in Rom.
Auf diesem Hintergrund erscheint vielen eine additive Lösung die einzig mögliche zu sein: Weitermachen wie bisher, also v. a. performen, und zugleich Neues ausprobieren. Das gelingt aber nicht. Entweder geht diese Lösung auf die Gesundheit der Beteiligten oder der Einsatz für Neues erfolgt halbherzig und kann nicht erfolgreich sein. So wird Innovation nicht systemrelevant. Sie bleibt Alibi.
Wenn in der aktuellen Situation der Kirchen Innovation systemrelevant und Transformation nachhaltig werden soll, ist die zentrale Frage, wie in einem komplexen System wie dem kirchlichen in verantwortlicher Weise Freiraum geschaffen werden kann, um die notwendigen Lern- und Veränderungsprozesse gestalten zu können und v. a. Neues zu kreieren. Das erfordert in erster Linie transparente und begründete Entscheidungen.
Begriffsklärungen
Der notwendige Prozess des Abschaffens wird – je nach Kontext – als Exnovation, Produkteliminierung oder Produktabkündigung bezeichnet.
Der Begriff Exnovation wird v. a. in der Nachhaltigkeitsdebatte verwendet, in der sich zeigt, dass der Wandel allein durch Innovation nicht vollzogen werden kann. Es braucht zusätzlich das aktive Abschaffen als problematisch eingestufter Produkte und Technologien – etwa Glühbirnen, Stromerzeugung aus Kohle und Kühlschränke mit FCKW. In diesem Kontext wird unter Exnovation ein “gezieltes und aktives Bemühen von Akteuren, bestehende Technologien, Organisationsstrukturen oder Verhaltensweisen ‚aus der Welt zu schaffen’, weil sie ihre Lösungskraft verloren, unter veränderten Bedingungen und Erkenntnissen nicht mehr als zielführend oder gar als schädigend erkannt wurden.“ 3
Im betriebswirtschaftlichen Kontext wird der Vorgang des Abschaffens häufig als Produkteliminierung oder Produktabkündigung geführt. Verschiedene Faktoren führen dazu: Sinkende Nachfrage bzw. Rentabilität, eine veränderte strategische Ausrichtung, zu hoher Konkurrenzdruck bzw. zu große Wettbewerbsnachteile, sinkende Kundenzufriedenheit bzw. negatives Feedback aufgrund von Qualitätsproblemen, Funktionsmängeln u. a. Nicht zuletzt spielt auch der Kannibalisierungseffekt eine Rolle: Er tritt auf, wenn ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung eines Unternehmens die Verkäufe eines bereits bestehenden Produkts desselben Unternehmens verringert. Das kann auch umgekehrt gedacht werden: Damit das neue (i. d. R. verbesserte, ggf. teurere) Produkt sich besser am Markt durchsetzen kann, wird das ursprüngliche Produkt vom Markt genommen. Dies geschieht, um die Ressourcen auf das neue Produkt zu konzentrieren und die interne Konkurrenz zu reduzieren.
In kirchlichen Kontexten ist in letzter Zeit verstärkt der Begriff Exnovation aufgegriffen worden und in Mode gekommen. Er greift allerdings zu kurz. Es geht in den meisten Fällen nicht um Exnovation im engeren Sinne, also um die Abschaffung eines Angebots oder einer Tätigkeit. Viel häufiger steht eine Reduktion bzw. Schwerpunktsetzung an oder die Verlagerung der Verantwortung für ein Angebot oder eine Tätigkeit (z. B. von hauptberuflichen auf ehrenamtlich Tätige oder zwischen verschiedenen Ebenen kirchlichen Handelns).
Produktlebenszyklus
Hintergrund der folgenden Überlegungen ist die Idee, den Lebenszyklus eines Angebots aktiv zu gestalten. Der sog. Produktlebenszyklus umfasst alle Phasen der „Lebensdauer“ eines Angebots, vom Konzept über das Design und die Ausgestaltung, die Produkteinführung, den Echtbetrieb und die Wartung bis hin zum Rückgang der Nutzung (Degeneration) und der notwendigen Entscheidung, was mit dem Angebot bzw. den Ressourcen, die dort hineingesteckt werden, geschehen soll.
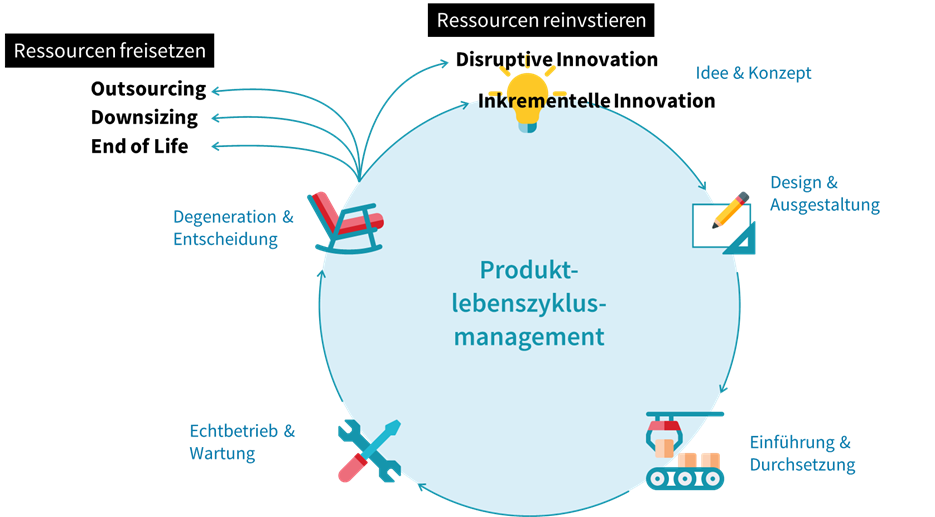
Abb. 1: Produktlebenszyklusmanagement
Wenn die Nutzung eines Angebotes signifikant zurückgeht oder Ersatzprodukte deutlich an Zuspruch gewinnen und das eigene Produkt überflügeln, gilt es zu entscheiden: Sollen die Ressourcen, die in das Produkt gesteckt werden (Zeit, Geld, …), im gleichen Feld direkt reinvestiert werden, sei es für graduelle Verbesserungen (inkrementelle Innovation) oder eine radikale Neukonzeption des Produkts (disruptive Innovation), oder werden sie freigesetzt, um Raum für ganz andere Dinge zu schaffen, die sinnvoll und notwendig erscheinen? Hier bestehen drei Optionen, wie mit dem bisherigen Angebot umgegangen werden kann: Es kann outgesourct werden, etwa indem es eine Partnerorganisation übernimmt (z. B. ein Jugendhaus, das an die Diakonie geht) oder es im Falle einer Kirchengemeinde ehrenamtlich Tätigen anvertraut wird (z. B. Beerdigungen). Es kann aber auch in dem Sinne optimiert werden, dass man Wege sucht, wie das Angebot weniger Ressourcen in Anspruch nimmt oder es reduziert wird (Downsizing). Das kann z. B. der Fall sein, wenn Gottesdienste fokussiert bzw. konzentriert (und qualitativ verbessert) werden. Schließlich besteht natürlich auch die Möglichkeit, das Angebot auslaufen zu lassen und ersatzlos aus dem Portfolio zu streichen (End of Life).
Übersicht über Tools und Vorgehensweisen
Bei Fragen der Priorisierung bzw. des Freiraumschaffens geht es im Kern um Entscheidungen, die in aller Regel in einer Gruppe oder einem Gremium zu treffen sind. Der Prozess der Entscheidungsfindung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Folgende Verfahren bzw. Tools werden hier vorgestellt:4
- (Einzel-)Entscheidung nach dem Mehrheitsprinzip
- Clusterverfahren zur inversen Priorisierung
- Fokusfinder (multipler Paarvergleich)
- Ratingboard (Zustimmungsrating)
- Systemisches Konsensieren (Widerstandsrating)
- Cockpit Freiraum schaffen (kriteriengeleitete Entscheidung)
Das gewählte Verfahren beeinflusst stets auch die Gruppenkohäsion und -dynamik auf der einen und die individuelle Bereitschaft, das Ergebnis mitzutragen (Commitment), auf der anderen Seite. Daher ist die Frage der Verfahrenswahl bzw. nach dem „besten“ Tool stets mit einer systemischen Betrachtung und Bewertung von Risiken verbunden.
Entscheidung nach dem Mehrheitsprinzip
Die Frage, ob ein Angebot reduziert, ausgelagert oder abgeschafft werden soll, kann selbstverständlich nach dem Mehrheitsprinzip entschieden werden. Einfache Mehrheiten setzen die Zustimmung von mindestens der Hälfte, qualifizierte Mehrheiten von mindestens 2/3 der anwesenden Gruppenmitglieder voraus. Mehrheitsentscheidungen können i. d. R. sehr schnell herbeigeführt werden. Allerdings führen sie oftmals zu Polarisierungen (z. B. bei 55 % ja vs. 45 % nein). Sie produzieren Gewinner:innen und Verlierer:innen. Dies wirkt sich stark auf die Identifikation mit Entscheidungen aus. Gerade bei knappen Entscheidungen findet sich u. U. nahezu die Hälfte der Personen nicht im Ergebnis wieder. Hinzu kommt, dass bei solchen Entscheidungen die einzelnen Angebote isoliert und nicht in Relation zu anderen Angeboten betrachtet werden. Im Blick auf die Fragestellung ist das eher unterkomplex.
Clusterverfahren zur inversen Priorisierung
Ein einfaches Verfahren selbstgesteuerter Priorisierung von Tätigkeiten, Angeboten oder benötigter Ressourcen ist das Clusterverfahren zur inversen Priorisierung. Zielsetzung dieses Verfahrens ist es, ausgehend von einem gesamtorganisatorisch definierten Zielrahmen für notwendige Einsparungen den jeweils Verantwortlichen für Tätigkeits- oder Produktbereiche ein Instrumentarium an die Hand zu geben, um in Eigenregie zu entscheiden, was im eigenen Zuständigkeitsbereich zukünftig ganz weggelassen oder im Umfang reduziert werden soll. Der Clou ist dabei, dass man das Ganze im Blick behält und invers, also von hinten her priorisiert. D. h. man überlegt, was – im Vergleich zum jeweiligen Rest – als nächstes am ehesten gestrichen werden kann.
Das Verfahren geht von der Hypothese aus, dass die Verantwortlichen für ihren jeweiligen Verantwortungsbereich ein klares inneres Bild der Rangfolge von Tätigkeiten, Angeboten oder benötigter Ressourcen haben und genau sagen können, was sie – falls erforderlich – von hinten beginnend schrittweise aufgeben oder reduzieren würden.
Für die Durchführung des Verfahrens liegt als Tool ein DIN-A4-Arbeitsblatt und für komplexere Zusammenhänge eine Excel-Tabelle vor, in die Festlegungen und erarbeitete Ergebnisse schrittweise eingetragen werden. Wenn innerhalb des jeweiligen Verantwortungsbereichs mehrere Personen an der Entscheidung beteiligt sind, können die erforderlichen Festlegungen diskursiv erfolgen.
Die Bearbeitung des Clusterverfahrens zur inversen Priorisierung beginnt mit übergeordneten Vorklärungen in der Gesamtorganisation, die dann die Arbeitsgrundlage für die Einzelklärungen in den Verantwortungsbereichen sind. Dazu gehört u. a. die Frage, was Gegenstand der Betrachtung ist (Objekte: Tätigkeiten, Angebote, …), welche Organisationseinheiten bzw. Verantwortungsbereiche mit einbezogen werden, was anteilige Einsparziele sind und bis wann sie zu erreichen sind.
Auf dieser Basis wird in den jeweiligen Verantwortungsbereichen autonom weitergearbeitet. Das Vorgehen gliedert sich in mehrere Schritte, deren Ergebnisse im Arbeitsblatt „Inverse Priorisierung“ festgehalten werden.
Kern des Verfahrens ist die schrittweise Festlegung der Objekte (Tätigkeiten, Angebote), die abgeschafft oder reduziert werden sollen, um die Einsparziele zu erreichen. Die Leitfrage hierfür ist: Was von dem, was jeweils noch im Portfolio vorhanden ist, kann am ehesten weggelassen oder in seinem Umfang reduziert werden? Für das identifizierte Objekt wird die mögliche Einsparung festgelegt. Das kumulierte Einsparvolumen bis zum jeweiligen Eintrag gibt Auskunft darüber, ob das Einsparziel erreicht oder weitere Objekte herangezogen werden müssen.
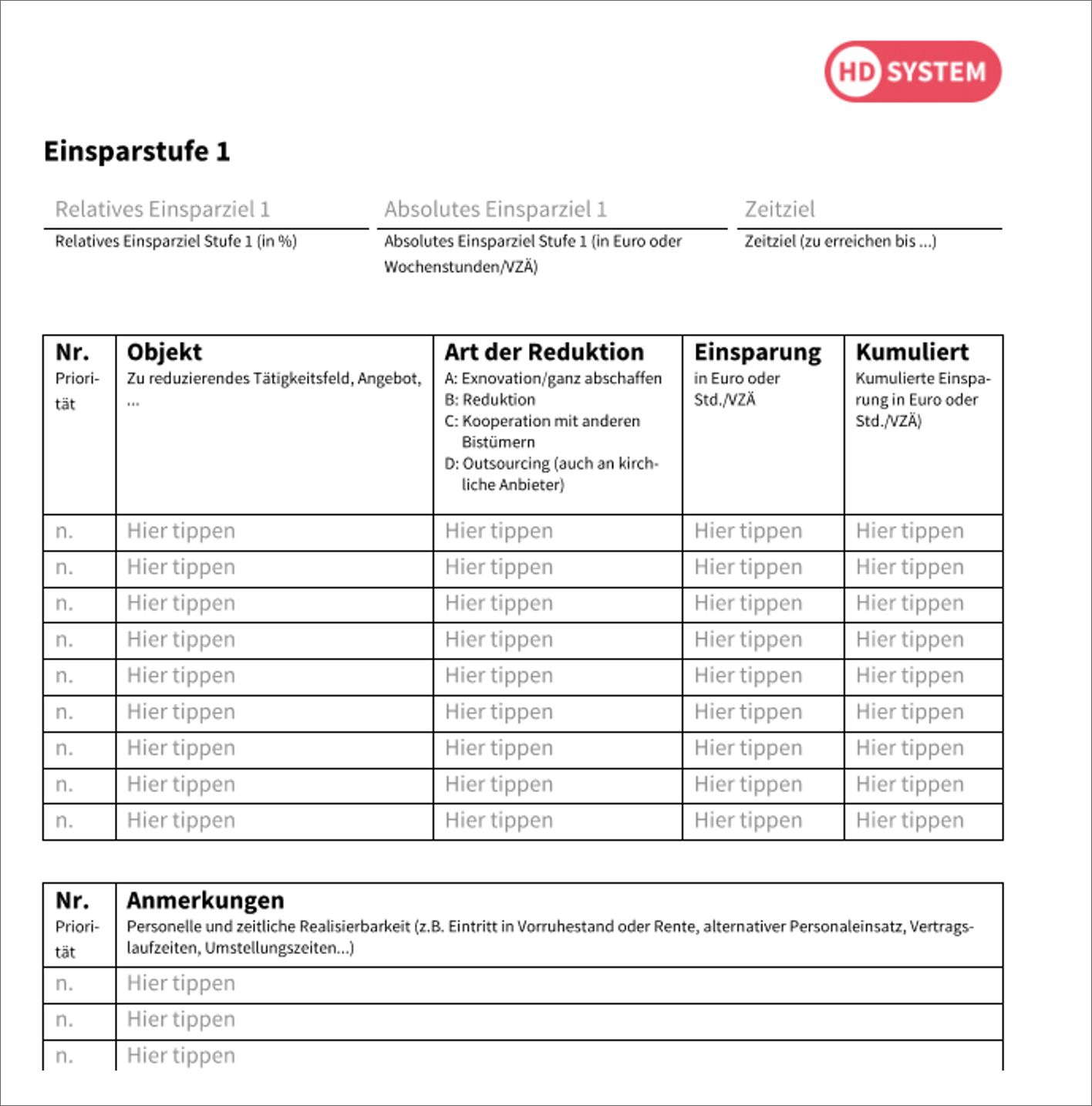
Abb. 2: Inverse Priorisierung
In der Regel geht man bei diesem Verfahren diskursiv vor. Es bietet sich an, notwendige Entscheidungen nach dem Konsentprinzip5 zu fällen. Ist die diskursive Form der Priorisierung jedoch nicht zielführend, weil z. B. Eigeninteressen eine Konsensbildung erschweren, bieten sich spezifische Entscheidungsverfahren als Zwischenschritt an, insbesondere Ratingverfahren, systemisches Konsensieren oder multipler Paarvergleich (Fokusfinder), die im weiteren Verlauf gesondert beschrieben werden.
Beim Nachdenken über Einsparmöglichkeiten und -prioritäten ist immer darauf zu achten, dass es zwischen Tätigkeiten oder auch Angeboten Wechselwirkungen geben kann, die nicht zu vernachlässigen sind und ggf. die Einsparreihenfolge oder auch das jeweils ins Auge gefasste Einsparvolumen beeinflussen können.
Die Ergebnisse der unterschiedlichen Verantwortungsbereiche müssen dann zusammengeführt und auf Diskontinuitäten bzw. Wechselwirkungen hin überprüft werden. Hier kann es noch zu einzelnen Verschiebungen kommen. Sie haben i. d. R. übergreifende Bedeutung und müssen daher gemeinsam entschieden und getragen werden. Abschließend ist zu überlegen, wie die Kommunikation zu gestalten ist, also wer, wie, wann und auf welchem Weg informiert wird.
Arbeit mit dem Fokusfinder – multipler Paarvergleich
Das Tool Fokusfinder basiert auf dem Prinzip des multiplen Paarvergleichs. Auch hier handelt es sich um ein Verfahren, das in besonderer Weise zur Priorisierung in Gruppen geeignet ist. Der Fokusfinder wird in mehreren Schritten durchlaufen.
Zu Beginn legt man fest, was betrachtet und ggf. reduziert oder abgeschafft werden soll (z. B. Angebote oder Tätigkeitsfelder) und wie die Reduktion bzw. das Abschaffen gemessen werden soll (z. B. über Zeitressourcen, die eingesetzt werden).
Dann werden alle infrage kommenden Objekte (z. B. die Angebote einer Kirchengemeinde) aufgelistet, die potenziell reduziert oder abgeschafft werden könnten.
Ausgehend von einer definierenden Fragestellung (z. B. Was ist (uns) wichtiger?) werden die Objekte paarweise miteinander verglichen. Auf Basis aller Paarvergleiche wird die Rangfolge der Objekte gebildet und mit weiteren Informationen angereichert: Der aktuelle Ressourcenverbrauch und die mögliche Einsparsumme werden eingetragen. Die kumulierte Einsparsumme zeigt an, ob bzw. inwieweit das insgesamt angestrebte Einsparziel erreicht ist oder weitere Objekte in die Berechnung einbezogen werden müssen.
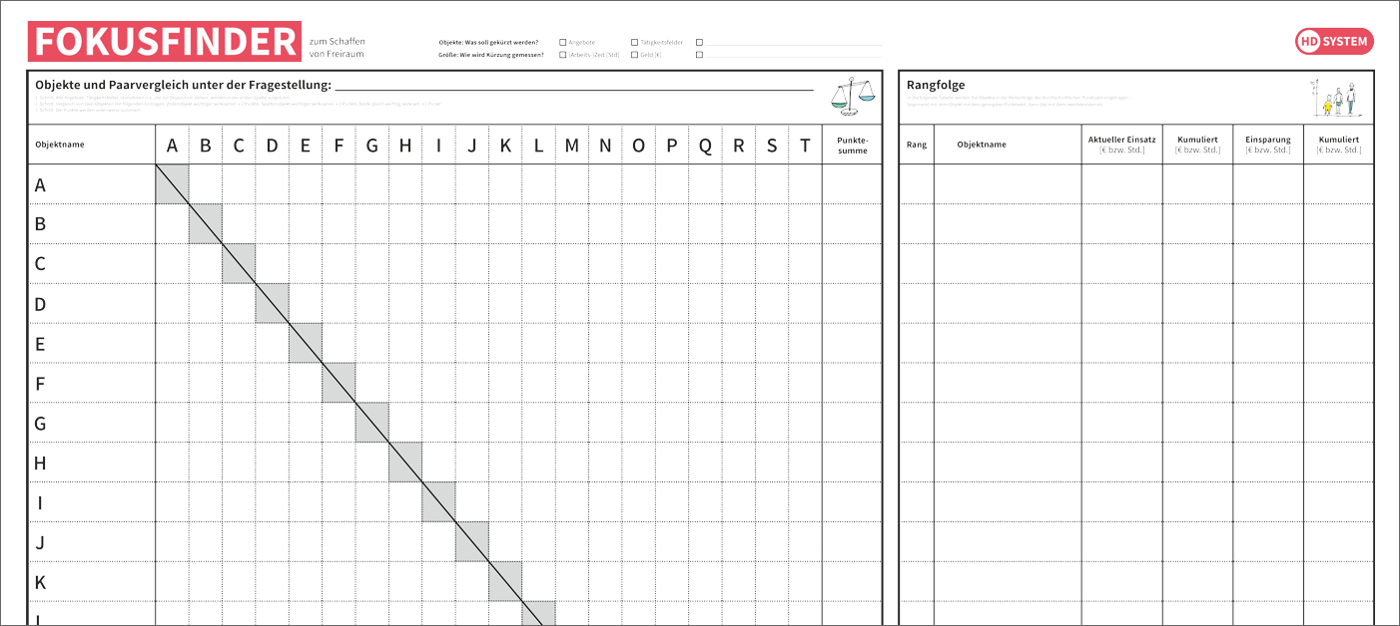
Abb. 3: Fokusfinder
Auch hier werden die Ergebnisse sprachlich zusammengefasst und eine finale Entscheidung über die Reduzierung oder gänzliche Abschaffung der Angebote bzw. Objekte formuliert, die dann sorgfältig und differenziert zu kommunizieren ist.
Arbeit mit dem Ratingboard – Zustimmungsrating
Beim Freiraumschaffen mit Hilfe des Tools Ratingboard wird der Grad der Zustimmung zur Abschaffung bzw. substanziellen Reduktion eines Angebotes abgefragt. Hierbei handelt es sich um intervallskalierte Einschätzungen.
Zunächst wird ähnlich wie beim Fokusfinder definiert, was betrachtet und ggf. reduziert oder abgeschafft werden soll, z. B. Angebote, Tätigkeitsfelder, Immobilien etc. Ebenso wird die Größe bestimmt, in der die Reduktion bzw. das Abschaffen gemessen werden soll.
Alle infrage kommenden Objekte, die zur Disposition stehen, werden in der Matrix aufgeführt und die Einzelbewertungen der Teilnehmer:innen eingetragen. Diese sollen das Ausmaß ihrer Zustimmung angeben, ein Objekt abzuschaffen bzw. es substanziell zu reduzieren. Basierend auf den Durchschnittsbewertungen werden die Objekte in eine Rangfolge gebracht. Zusätzlich wird in diesem Schritt wie beim Fokusfinder der aktuelle Ressourceneinsatz bestimmt und je Objekt überlegt, wieviel man einsparen will. Die kumulierten Einsparsummen geben Aufschluss, ob das angepeilte Einsparziel bereits erreicht ist.
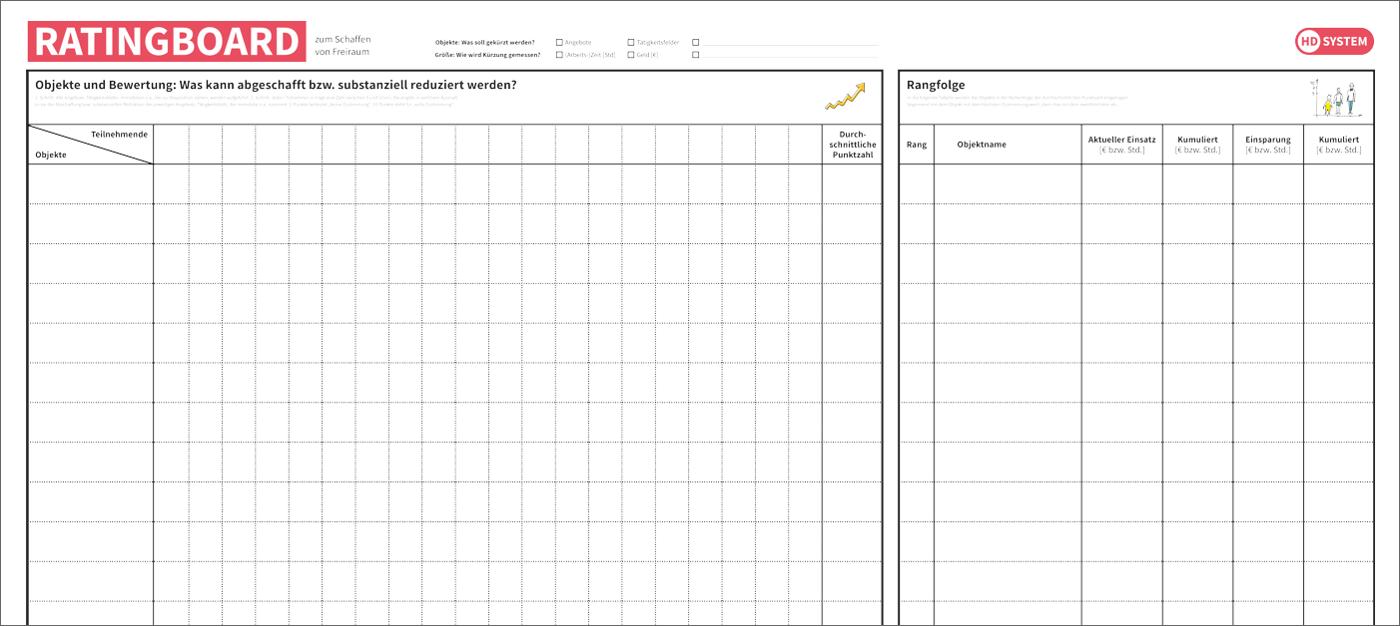
Abb. 4: Ratingboard
Die Ergebnisse werden sprachlich zusammengefasst und eine finale Entscheidung über die Reduzierung oder gänzliche Abschaffung der Angebote getroffen, die entsprechend kommuniziert wird.
Systemisches Konsensieren – Widerstandsrating
Das systemische Konsensieren zur Schaffung von Freiraum ist vom Vorgehen her dem Ratingverfahren vergleichbar. Im Unterschied dazu wird bei diesem Tool nicht der Grad der Zustimmung zur Abschaffung bzw. substanziellen Reduktion eines Angebotes abgefragt, sondern umgekehrt der Widerstand dagegen. Auch hier liegen intervallskalierte Einschätzungen vor.
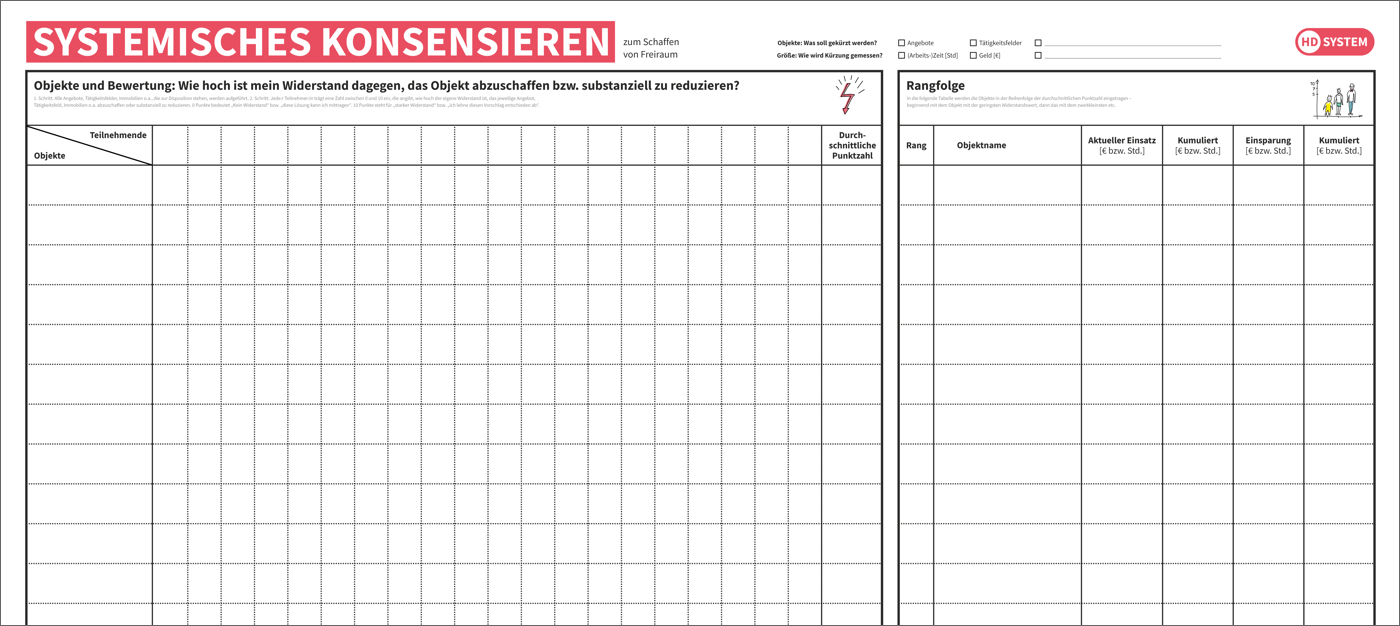
Abb. 5: Systemisches Konsensieren
Die Ergebnisse des systemischen Konsensierens und des Ratingverfahrens unterscheiden sich deutlich. Während beim Ratingverfahren jene Objekte im Fokus sind, deren Abschaffung bzw. Reduktion von der Mehrheit der Teilnehmenden befürwortet wird, sind es beim systemischen Konsensieren jene, bei denen der Widerstand gegen die Abschaffung bzw. Reduktion am geringsten ist. Daher ist vom Grundsatz her eine höhere Akzeptanz in der Breite gegeben als beim Rating.
Cockpit Freiraum schaffen – Kriterienorientierte Entscheidung
Das „Cockpit Freiraum schaffen“ ist ein Tool, das die Möglichkeit bietet, Entscheidungen über die Abschaffung bzw. Reduktion von Angeboten oder Tätigkeiten kriterienbasiert zu treffen. Das Tool wird in der Gruppe diskursiv bearbeitet, greift aber in Teilen auch auf vorhandene Daten aus Beobachtungen zurück. Die Angebote (bzw. Tätigkeiten) im Portfolio werden dabei schrittweise anhand von 8 Kriterien (Dimensionen) bewertet. Jeweils zwei Dimensionen sind zu einer Matrix zusammengefasst:
- Relative Nachfragestärke x relative Nachfrageänderung
- Relativer Aufwand x Nähe zum Purpose
- Breitenwirkung x Tiefenwirkung
- Risiko der Abschaffung (Kundenbeziehung und Stakeholderinteressen) x Chance der Beibehaltung (Marktpotenzial/-chancen)
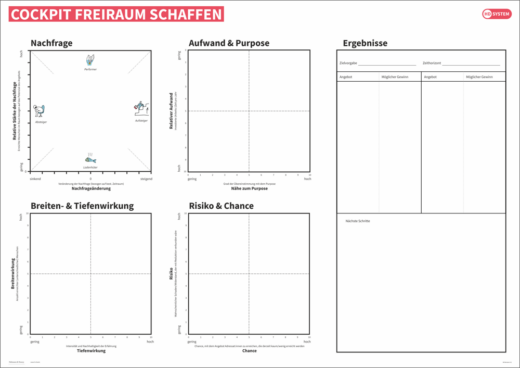
Abb. 6: Cockpit Freiraum schaffen
Die Angebote werden entsprechend ihrer Position auf den jeweiligen Dimensionen in den Matrizen eingetragen. Anhand des Gesamtüberblicks lassen sich die Angebote dann anhand von Plausibilitätsüberlegungen in eine Rangfolge bringen, die Auskunft darüber gibt, welche Angebote am ehesten reduziert, outgesourct oder aufgegeben werden können. Es empfiehlt sich, notwendige Entscheidungen nach dem Konsentprinzip zu treffen (vgl. Fußnote 2). Angebote werden schließlich entsprechend ihrer Rangordnung inkl. der damit freiwerdenden Ressourcen in das Ergebnisfeld übertragen. Nächste Schritte können im Anschluss geplant und festgehalten werden.
Das Verfahren kann auf zwei verschiedene Art und Weisen durchgeführt werden. Es kann in Gänze diskursiv auf der Basis aktueller Erfahrungen und Einschätzungen der Teilnehmenden eines Workshops bearbeitet werden. Damit hat das Verfahren einen Screening-Charakter, da etwa Größen wie Nachfrage und Nachfrageänderung auf subjektiven Eindrücken der Beteiligten basieren. Das Verfahren kann aber auch differenzierter und datenbasiert durchgeführt werden, indem ein Teil der Kenngrößen (wie Nachfrage oder Aufwand) mit echten (also empirischen) Daten hinterlegt wird. Der Aufwand für diese Vorgehensweise ist entsprechend höher, weil die Daten beschafft und notwendige Berechnungen erstellt werden müssen.
Kriterienbasierte Analyse der Angebote
Relative Nachfrage x relative Nachfrageänderung
Im ersten Analyseschritt wird die Nachfrage und deren Änderung über die Zeit betrachtet, um daraus Informationen für die Weiterentwicklung des Angebotsportfolios zu gewinnen. Sie kann – wie zuvor erwähnt – intuitiv als Screeningverfahren oder systematisch als empirisch fundiertes Analyseverfahren eingesetzt werden.
Aufwand x Purpose
Im zweiten Schritt wird die Relevanz des Angebots für die Organisation, definiert als Nähe zum Purpose (Sinn & Zweck der Organisation), mit dem Aufwand in Beziehung gesetzt, der notwendig ist, das Angebot vorzuhalten bzw. zu erbringen.
Breitenwirkung x Tiefenwirkung
Es folgt die Analyse bzw. Einschätzung des Angebots hinsichtlich seiner Breiten- und Tiefenwirkung. Unter Breitenwirkung wird verstanden, wie groß die Bandbreite bzw. das Spektrum der Adressat:innen ist, das mit einem Angebot erreicht wird. Mit Tiefenwirkung ist gemeint, in welchem Ausmaß ein Angebot die Auseinandersetzung und Mitwirkung des:der Adressat:in erfordert, in welcher Intensität es Erfahrungen ermöglicht und wie nachhaltig es in seiner Wirkung ist.
Risiko x Chance
Abschließend wird das Angebot dahingehend untersucht, wie hoch das Risiko einer Reduktion, eines Outsourcings oder der Abschaffung des Angebots ist und in welchem Maße die Beibehaltung des Angebots (in bisheriger Form) neue Marktchancen, also Potenziale eröffnet, neue Adressatengruppen anzusprechen.
Darstellung im Kriterienraum
Durch die Bearbeitung erhält man ein anschauliches Bild, wie die Angebote im Kriterienraum positioniert sind. Aus der Position in der jeweiligen Matrix und über die Matrizen hinweg ergeben sich konkrete Hinweise darauf, wie mit den Produkten weiter zu verfahren ist.
Die Dimensionen in allen Matrizen sind so gepolt, dass im linken unteren Quadranten („roter Bereich“) diejenigen Angebote liegen, die – aus Sicht derjenigen, die das Board bearbeitet haben – bezogen auf die jeweils betrachteten Kriterien eher schlecht abschneiden. Angebote, die oben rechts im „grünen“ Bereich liegen, werden positiv eingeschätzt.
Über die Einzelbetrachtung hinaus ist jedoch das Gesamtbild entscheidend. Bei jenen Angeboten, die gehäuft, also zwei-, drei- oder viermal im roten Bereich liegen, ist die Plausibilität hoch, dass sie gut und einvernehmlich reduziert, outgesourct oder abgeschafft werden können.
Priorisierung der Angebote und Berechnung des Einsparpotenzials
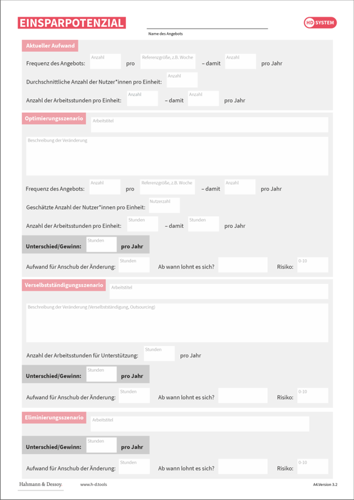
Abb. 7: Einsparpotenzial
Ein weiterer wesentlicher Schritt besteht jetzt darin, die Angebote anhand ihrer Positionierung im Kriterienraum zu priorisieren. Diskursiv wird die Rang- und Reihenfolge festgehalten, in der man die Angebote reduzieren, anderweitig platzieren oder exnovieren will. Es gibt dabei sicher Fälle, die unstrittig sind, es gibt sicher auch Fälle, die nicht eindeutig sind. Auf jeden Fall braucht es hier klare und begründete Entscheidungen. Auch hier empfiehlt sich das Konsentverfahren (vgl. Fußnote 2). Am Ende steht die Liste der Produkte, die in der Folge schrittweise auf das darin liegende Rückbau- und Einsparpotenzial zu prüfen sind, bis man das anvisierte Limit erreicht hat.
Auch die Berechnung des Einsparpotenzials erfordert mehrere Schritte. Hierfür steht die Karte „Einsparpotenzial“ zur Verfügung. Zunächst wird auf einen definierten Referenzzeitraum bezogen berechnet, wie hoch aktuell der Aufwand für ein Angebot ist. Im zweiten Schritt werden unterschiedlichen Szenarien geprüft:
- Optimierungsszenarien: Optionen, die auf eine Reduktion des Aufwands bei grundsätzlicher Beibehaltung des Angebots abzielen
- Outsourcing- oder Verselbstständigungsszenarien: Optionen, das Angebot in andere Hände (ggf. auch Strukturen bzw. Trägerschaften) zu übergeben
- Eliminierungsszenario: komplette Eliminierung, also die Aufgabe des Angebots
Für jedes der Szenarien ist neben dem Einsparpotenzial der Aufwand für den Anschub der jeweiligen Änderung anzugeben und eine Risikobewertung vorzunehmen. Die Ergebnisse werden im Cockpit dokumentiert.
Abschließende Überlegungen zur Indikation: Wann welches Tool?
Die vorgestellten Tools beschreiben mehr oder weniger strukturierte Vorgehensweisen, um partizipativ zu qualifizierten und transparenten Entscheidungen zu kommen, welche Tätigkeiten oder Angebote weggelassen oder reduziert werden können, wenn Ressourcen fehlen oder in Innovation gesteckt werden sollen.
Den größten Gestaltungsspielraum für Verantwortliche von Teilbereichen der Organisation gibt das Clusterverfahren zur inversen Priorisierung. Da es in der Grundversion diskursiv angelegt ist, besteht eine höhere Anfälligkeit, sich in Diskussionen zu verstricken. Daher ist eine gut funktionierende Arbeitsbeziehung für dieses Verfahren unabdingbar.
Umgehen lässt sich das Risiko, wenn man (ggf. zusätzlich) auf die strukturierteren Verfahren zurückgreift, in denen die Entscheidung auf einer Skalierung beruht. Das einfachste Tool ist das Ratingverfahren. Es fokussiert die Zustimmung zur Frage, was abgeschafft oder reduziert werden soll. Im Ergebnis kann das bedeuten: Man hat zwar diejenigen Objekte identifiziert, die mehrheitlich eine Zustimmung finden, aber aus dem Auge verloren, dass es dabei zu einzelnen Objekten erhebliche Widerstände gegeben kann. Das Verfahren ist anwendbar, wenn es tendenziell eine hohe Übereinstimmung in der Frage des Freiraumschaffens gibt.
Ist dies nicht der Fall, insbesondere dann, wenn Polarisierungen zu erwarten sind, bietet sich das Tool Systemisches Konsensieren an. Hier wird der Widerstand gegen die Abschaffung bzw. Reduktion eines Objektes gemessen. Idealerweise führt man beide Verfahren durch und bearbeitet die Differenzen im Ergebnis diskursiv auf Basis des Konsentverfahrens.
Das Tool Fokusfinder integriert wesentlich mehr Informationen und ist daher etwas aufwändiger. Im Blick auf die Fragestellung (z. B. Was ist wichtiger?) wird jedes einzelne Objekt mit jedem anderen Objekt verglichen. Dadurch wird die Entscheidung sehr valide. Auch dieses Verfahren lässt sich mit den beiden zuvor genannten kombinieren, um die Unterschiede wahrzunehmen und diskursiv auszuhandeln. Benutzt man alle drei Verfahren, ist das Ergebnis äußerst zuverlässig.
Die drei bisher genannten Skalierungsverfahren setzen darauf, dass die Optionen der beteiligten Akteur:innen Gültigkeit haben und mit gleichem Gewicht in das Ergebnis einfließen, losgelöst von den jeweiligen Kriterien, die den einzelnen Optionen zugrundliegen. Das „Cockpit Freiraum schaffen“ bietet im Unterschied dazu acht paarweise kombinierte Kriterien, die für die Bewertung von Angeboten relevant sind. Die Einschätzung der Objekte, bezogen auf die Kriterien, geschieht diskursiv oder auch z. T. anhand empirischer Daten. Das Ergebnis ist eine anschauliche Positionierung der Objekte im Kriterienraum, die entscheidende Hinweise für die Erstellung der Objektrangfolge liefert. Dieses Verfahren ist am aufwändigsten, integriert empirische Daten, sorgt für die Anwendung der gleichen Kriterien auf alle Objekte und plausibilisiert die Entscheidung der Kriterien. Voraussetzung ist, dass die Beteiligten den Kriterien folgen und ihre Plausibilität anerkennen können.
Fazit: Strategische Exnovation als Wegbereiter für kirchliche Transformation
In einer Zeit, die von rapiden gesellschaftlichen, technologischen und ökologischen Veränderungen geprägt ist, stehen die Kirchen vor einer ihrer größten Herausforderungen: der Notwendigkeit einer tiefgreifenden Transformation. Diese resultiert nicht nur aus abnehmender Umweltreferenz und sinkenden Mitgliederzahlen, sondern auch aus dem Bedarf, eine relevante und resonante Präsenz in der postmodernen Gesellschaft herzustellen.
Kirche und kirchliche Einrichtungen müssen lernen, das Gleichgewicht zwischen Bewahren und Erneuerung neu zu justieren. Dies erfordert mutige und entschlossene Schritte in Richtung einer strategischen Exnovation. Die vorgestellten Tools bieten konkrete Ansätze, wie Entscheidungen über die Reduzierung oder Beendigung von Angeboten bzw. Tätigkeiten strukturiert und partizipativ getroffen werden können. Sie ermöglichen es den Kirchen, ihre Ressourcen strategisch auf innovative und transformative Aktivitäten zu konzentrieren, die einen wirklichen Unterschied machen. Für die Kirchen wird es entscheidend sein, eine Umgebung zu schaffen, in der das Lernen und Experimentieren mit neuen Formen des kirchlichen Lebens nicht nur möglich, sondern zur neuen Norm wird.

Praxis
Immobilienkonzeptentwicklung
1. Kontext und Herausforderungen
Die Zahl der Kirchenmitglieder in beiden großen Kirchen geht deutlich schneller zurück, als die sog. „Freiburger Studie“6 prognostiziert hat. Das hat mit den exponentiell anwachsenden Kirchenaustritten zu tun. So verzeichnete die Katholische Kirche 2021 einen Mitgliederrückgang von 547.472 Personen (ein Minus von 2,5 %). Darin enthalten waren 359.338 Kirchenaustritte (= 66 % des Rückgangs). Gleichzeitig steigen die Kirchenaustritte weiterhin exponentiell an, von 2020 auf 2021 um 62 %. In den Evangelischen Kirchen lag der Rückgang der Mitglieder 2021 bei 510.899, darin enthalten sind ca. 380.000 Kirchenaustritte (= 74 % des Rückgangs ). Die Kirchenaustritte stiegen von 2020 auf 2021 um 36 %. Setzte sich der Trend so fort, wäre nicht erst 2060, sondern bereits wesentlich früher, zwischen 2040 und 2050 mit einer Halbierung der Mitgliederzahl zu rechnen.
Auch die in der Freiburger Studie enthaltene Prognosen zur Entwicklung der Kirchensteuereinnahmen und der Kaufkraft sind zwischenzeitlich überholt. Das hat mit dem viel schnelleren Rückgang der Mitgliederzahlen zu tun. Ausgelöst durch die Coronakrise und die durch den Ukrainekrieg induzierten Preissteigerungen, nimmt zudem die Kaufkraft deutlich schneller ab als angenommen. Nicht umsonst werden in einer Reihe von Diözesen bereits jetzt drastische Haushaltssicherungsmaßnahmen bis zu einer Höhe von einem Drittel des bisherigen Budgets durchgeführt.Nicht umsonst werden in einer Reihe von Diözesen bereits jetzt drastische Haushaltssicherungsmaßnahmen bis zu einer Höhe von einem Drittel des bisherigen Budgets durchgeführt.
Bei den Immobilien hinken die Kirchen gegenüber dieser Entwicklung weit hinterher, was sich pointiert insbesondere bei den Zahlen der Evanglischen Kirchen zeigen lässt (vgl. Tabelle 1). Während die Mitgliederzahl von ca. 23,6 Mio. im Jahr 2011 auf 19,7 Mio. im Jahr 2021, also um 16,5 % fiel, ging die Zahl der Kirchen kaum zurück. 2011 gab es laut EKD-Statistik 20.648 evangelische Kirchen und Kapellen, im Jahr 2021 waren es 20.372. Das entspricht einem Rückgang von lediglich 1,3 %. In der Katholischen Kirche zeigt sich im gleichen Zeitraum ein Mitgliederrückgang von knapp 12% und ein Rückgang der Kirchen bzw. Kapellen um ca. 2%.
| Evangelische Kirche | Katholische Kirche | |||
|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | Kirchen & Kapellen | Mitglieder | Kirchen & Kapellen | |
| 2011 | 23.619.648 | 20.648 | 24.472.817 | ca. 24.500 |
| 2021 | 19.725.000 | 20.372 | 21.645.875 | ca. 24.000 |
| Relative Änderung | -16,5% | -1,3% | -11,6% | -2,0% |
Tab. 1: Anzahl der Mitglieder und Kirchen der beiden großen Kirchen in Deutschland 2011 und 20217
Noch drastischer fällt der Vergleich im Blick auf den Rückgang der Gottesdienstbesucher aus. So ging die Zahl der Besucher von Sonntagsgottesdiensten (Frühjahrs-bzw. Herbstzählung) in der Katholischen Kirche im Vergleichszeitraum von ca. 3,01 Mio. im Jahr 2011 auf ca. 925.000 im Jahr 2021 zurück. Das ist ein Rückgang von ca. 69 %. Zwar zeigen sich dort noch deutlich Auswirkungen der coronabedingten Einschränkungen, allerdings zeigt die Entwicklung nach dem Ende der Maßnahmen, dass der Gottesdienstbesuch auf niedrigem Niveau verbleibt.
Immobilien sind für Diözesen und Landeskirchen – neben den Personalkosten – die zentralen Kostentreiber.
Immobilien sind für Diözesen und Landeskirchen – neben den Personalkosten – die zentralen Kostentreiber. Zwar wurden in den zurückliegenden Jahren die Ausgaben dafür bereits deutlich reduziert, mit dem Effekt eines erheblichen und fortschreitenden Renovierungs- und Sanierungsstaus. Dieser betrifft nicht nur Kirchen, sondern auch andere Immobilien, wie etwa Gemeindezentren und Pfarrhäuser. In vielen Fällen ist die Bausubstanz betroffen. Angesichts der Gesamtentwicklung ist davon auszugehen, dass sich die Situation in den nächsten Jahren erheblich verschärfen wird, wenn es nicht zu einem substanziellen Abbau kirchlicher Immobilien einschließlich Kirchen und Kapellen kommt. Umgekehrt formuliert: Es werden regelmäßig, z.T. wöchentlich Entscheidungen in Millionenhöhe getroffen, von denen man nicht weiß, ob die betreffende Immobilien in ein oder zwei Jahren noch gebraucht wird bzw. gehalten werden kann.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Hürden für den Abbau, die Umwidmung oder Veräußerung kirchlicher Immobilien hoch sind und der Prozess i.d.R. sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, nicht zuletzt, weil die Gebäude unter Denkmalschutz stehen8, stark sanierungsbedürftig oder für eine alternative Verwendung nicht attraktiv genug sind. Umso wichtiger ist es frühzeitig damit zu beginnen, taugliche langfristig-strategisch ausgerichtete Immobilienkonzepte zu entwickeln.
2. Qualitätskriterien für den Prozess
Die Entwicklung von Immobilienkonzepten, bei denen es um eine Reduktion vorhandener Immobilien, insbesondere auch Kirchen geht, ist oftmals ein zäher und emotional belastender Prozess.
Die Entwicklung von Immobilienkonzepten, bei denen es um eine Reduktion vorhandener Immobilien, insbesondere auch Kirchen geht, ist oftmals ein zäher und emotional belastender Prozess. Nicht selten kam es in der Vergangenheit auch vor, dass man top-down kurzen Prozess gemacht und eine Kirche geschlossen hat, ohne dass es kompensatorische Maßnahmen gab, die den Verlust hätten auffangen können.
Immobilienkonzeptentwicklung und Kirchenentwicklung gehören eng zusammen, sind Kehrseiten einer Medaille. Die Immobilien sind zentrale Potenzialfaktoren, die mögliche kirchliche Ausdrucksformen prägen. Wenn ein Immobilienkonzept zentraler Baustein von Kirchenentwicklung sein soll, muss die Entwicklung der Konzeption bestimmten Qualitätskriterien genügen:
Langfristig-strategischer Horizont
Angesichts der hohen Änderungsdynamik müssen Entscheidungen im Blick auf Immobilien, die nicht ohne weiteres revidierbar sind, – bei aller Unsicherheit von Prognosen – langfristig-strategisch ausgerichtet sein. Das betrifft sowohl die Markt- als auch die Ressourcenlage.
Seelsorglich-pastorale Funktion
Immobilien haben eine Dienstfunktion. Sie werden dann und nur insofern gebraucht, wie sie für die Umsetzung des kirchlichen Auftrags, also der Mission dienen. Das gilt sowohl großflächig auf den seelsorglich-pastoralen Raum hin, als auch im Blick auf das lokale Geschehen vor Ort .
Orientierung am Sozialraum
Kirche ist nicht für sich selbst da, sondern Sakrament, Werkzeug der Liebe Gottes zu den Menschen. Wenn man das ernst nimmt, sind kirchliche Gebäude nicht primär für die Kirchenmitglieder oder für die wenigen „Kirchentreuen“ da, sondern für die Menschen, zu denen die Kirche gesandt ist. Daher sind Immobilienkonzepte stets auf das Umfeld hin zu erstellen, in denen kirchliches Handeln erfolgt.
Optimierung im seelsorglich-pastoralen Raum
Kirchliches Leben vollzieht sich zukünftig zunehmend weniger in klassischen Pfarreigrößen. Organisatorisches Bezugssystem ist der größere seelsorglich-pastorale Raum, in dem kirchliche Orte mit und ohne Immobilien netzwerkartig miteinander verknüpft sind. Die verbleibenden Immobilien sind auf diesen Organisationsraum bezogen optimal, d.h. effizient zu konfigurieren.
Bei Immobilien sind zumeist unterschiedliche Interessen und viele Emotionen im Spiel.
Transparenz und Partizipation im Prozess
Bei Immobilien sind zumeist unterschiedliche Interessen und viele Emotionen im Spiel. Daher ist der Prozess der Konzeptentwicklung maximal transparent und partizipativ zu gestalten. Die Vorgaben der übergeordneten Ebene, die verfügbaren Ressourcen, die Schritte des Vorgehens, Akteure, Beteiligungsformate und Entscheidungskriterien müssen von Anfang an offengelegt werden. Die Akteure vor Ort sind unbedingt einzubeziehen, wobei offen kommuniziert werden muss, nach welchen Kriterien Voten oder Rückmeldungen in die Entscheidung einfließen.
Strukturiertheit, Präzision und Tempo
Aufgrund der vielfältigen Interessen und der hohen Emotionalität, aber auch wegen der hohen Komplexität, die damit verbunden ist, verlaufen Prozesse zur Immobilienkonzeptentwicklung vielfach zäh und ohne roten Faden. Je strukturierter die Teilschritte, je präziser die jeweiligen Aufgabenstellungen und je plausibler die bereitgestellten Instrumente sind, desto schneller kommt der Prozess in Fahrt und führt schnell zu verwertbaren Ergebnissen. In einem seelsorglich-pastoralen Raum (Größenordnung 50.000 bis 80.000 Kirchenmitglieder) sollte der Immobilienentwicklungsprozess keinesfalls länger als 15 Monate dauern, vorausgesetzt, eine angemessene Bestandsaufnahme der vorhandenen Immobilien liegt vor.
Entscheidungsfähige Optionen mit fairem Interessensausgleich
Am Ende des Entwicklungsprozesses steht nicht ein Ergebnis, sondern stehen mehrere entscheidungsfähige Optionen, die anhand der vorab definierten Kriterien ermittelt wurden. Optionsbezogen sind Vor- und Nachteile, Effekte und Nebeneffekte sowie notwendige Kompensationsmaßnahmen darzustellen. Optionen sind nur dann entscheidungsfähig, wenn sie einen fairen Interessensausgleich sicherstellen, also Gewinn und Verlust verteilt sind. Die Entscheidung selbst fällt in den dafür zuständigen Gremien und Kreisen nach einem vorab vereinbarten Prozedere.
In unserer Beratungspraxis haben wir eine Architektur und ein zugehöriges Toolset entwickelt, um diesen Kriterien in Prozessen der Immobilienkonzeptentwicklung gerecht zu werden.
3. Prozessgestaltung
Sie alle (Gremien & Gruppierungen) müssen im Prozess der Konzeptentwicklung einbezogen werden. Dabei geht es um eine gute Balance zwischen zentraler Steuerung und Selbststeuerung vor Ort.
An der Entwicklung pastoral fundierter Immobilienkonzepte ist i.d.R. eine Vielzahl von Akteuren und Organisationseinheiten auf unterschiedlichen Ebenen beteiligt. Neben den Kirchengemeinden und den dort zuständigen Gremien und Gruppierungen (katholisch: Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat, Seelsorgeteam; evangelisch: Kirchenvorstand, Presbyterium, Seelsorger:innen) spielen übergeordnete Einheiten (pastorale Räume, Kooperationsräume, u.a.) und v.a. zentrale Verwaltungseinheiten mit seelsorglich-pastoraler, ökologischer, baulicher bzw. finanzieller Zuständigkeit eine wichtige Rolle. Sie alle müssen im Prozess der Konzeptentwicklung einbezogen werden. Dabei geht es um eine gute Balance zwischen zentraler Steuerung und Selbststeuerung vor Ort.
3.1. Rahmenbedingungen
Der Umgang mit Immobilien in Kirchengemeinden ist i.d.R. sehr emotional, insbesondere bei den jeweiligen Nutzer:innen, die u. U. selbst bei der Errichtung der Gebäude mitgewirkt oder jahrelang ihre Zeit dafür eingesetzt haben. Daher ist es wichtig, dass die Akteure und Gremien vor Ort den Prozess der Konzeptentwicklung – im Rahmen der Vorgaben – selbst gestalten und über die Ergebnisse selbst entscheiden können. Dies gelingt, wenn
- die Rahmenbedingungen seitens der übergeordneten Instanzen in sich schlüssig und klar kommuniziert sind (Spielräume sind erkennbar)
- der Immobilienbestand angemessen erfasst ist (Umfang, Qualität, Unterhaltungskosten, energetischer Zustand, Renovierungs- und Sanierungsbedarfe, Nutzung)
- der Prozess der Konzeptentwicklung transparent kommuniziert, stringent geführt und mit einem schlüssigen Instrumentarium unterlegt ist (roter Faden muss erkennbar sein)
- die Verantwortlichen in Seelsorgeteam und Gremien voll und ganz dahinterstehen und dies auch jederzeit nach außen kommunizieren
Soll der Prozess vor Ort gut gelingen, müssen die Vorgaben der übergeordneten Instanzen vor, spätestens aber zu Beginn des Prozesses klar sein und den Verantwortlichen vor Ort transparent kommuniziert werden. Zu den Vorgaben gehören insbesondere
- mittel- und langfristig verfügbarer finanzieller Rahmen
- Unterstützungsleistungen seitens der Diözese bzw. Landeskirche
- rechtliche und vertragliche Bindungen (z.B. Denkmalschutz)
- Anforderungen an eine nachhaltige Immobilienbewirtschaftung
- Renovierungs- und Sanierungskosten, -zeiträume und -fristen (inkl. energetische Maßnahmen)
- Seelsorglich-pastorale Kriterien an das Immobilienkonzept
Wenn der Rahmen nicht klar ist und sich u.U. mehrere übergeordnete Stellen hinsichtlich ihrer Anforderungen und wechselseitiger Erwartungen nicht einig sind, sie vor Ort (unabgestimmt) agieren oder mitten im Prozess normativ eingreifen, müssen Prozesse der Immobilienentwicklung notwendig scheitern. Vielleicht hat man am Ende das Ziel der Reduktion erreicht, hinterlässt jedoch verbrannte Ende, polarisierte Verhältnisse vor Ort, bestätigte Vorurteile gegenüber der Verwaltung, fortschreitenden Vertrauensverlust etc.
Weil das Nachdenken über benötigte Immobilien und deren Priorisierung angesichts der Ressourcenlage eine Notwendigkeit ist, der sich die lokal verantwortlichen Akteure nicht dauerhaft verschließen können, besteht allerdings umgekehrt auch die Gefahr vertikaler Übersteuerung.
Weil das Nachdenken über benötigte Immobilien und deren Priorisierung angesichts der Ressourcenlage eine Notwendigkeit ist, der sich die lokal verantwortlichen Akteure nicht dauerhaft verschließen können, besteht allerdings umgekehrt auch die Gefahr vertikaler Übersteuerung. Wenn seitens der Fachabteilungen in den Verwaltungsbehörden die Entwicklung des Immobilienkonzepts als Vehikel zur Veränderung des kirchlichen Leben vor Ort genutzt werden soll, kommen zusätzliche verdeckte Aufträge ins Spiel. Was möglicherweise auf anderen Wegen nicht gelungen ist, soll jetzt über das Immobilienkonzept unter der Hand mit geregelt werden (Instrumentalisierung). Auch dies ist zum Scheitern verurteilt.
Aufgrund der Komplexität der Materie, der Vielzahl der zu berücksichtigenden Faktoren und Interessen, ist eine Begleitung von Prozessen der Immobilienkonzeptentwicklung durch interne oder externe Entwickler:innen unabdingbar. Sie sichern den Rahmen, schaffen den Überblick, stehen für den roten Faden, schützen vor Überforderung und bieten prozessbezogene und bei Bedarf fachliche Unterstützung an (oder vermitteln diese).
Für Prozesse der Immobilienkonzeptentwicklung ist je nach Komplexität und Divergenz der Interessen eine Dauer zwischen 6 Monaten und einem Jahr anzusetzen.
Für Prozesse der Immobilienkonzeptentwicklung ist je nach Komplexität und Divergenz der Interessen eine Dauer zwischen 6 Monaten und einem Jahr anzusetzen. Für die Begleitung sind ca. 10 bis 12 Tage einzuplanen.
3.2. Architektur
Der Erstkontakt zwischen Entwickler:innen und Verantwortungsträger:innen vor Ort ist besonders wichtig. Er dient nicht nur dazu, eine Arbeitsbeziehung herzustellen, die Landschaft zu erkunden, das Anliegen zu verstehen, die Motivation zu klären und Ressourcen in den Blick zu nehmen. Es geht dabei zentral auch um die Klärung der Rahmenbedingungen:
- Liegen alle relevanten Daten zu den Immobilien vor?
- Sind die Kriterien der übergeordneten Instanzen bekannt?
- Gibt es die Bereitschaft und die Ressourcen, einen stringenten Prozess mitzugehen?
- Tragen die Verantwortungsträger:innen vor Ort den Prozess in dieser Form mit?
Sofern diese Fragen nicht eindeutig positiv beantwortet werden können, müssen ggf. weitere Vorklärungen erfolgen oder der Auftrag kommt nicht zustande.
Liegen alle Voraussetzungen vor, kann mit der inhaltlichen Arbeit begonnen werden. Sie gliedert sich im wesentlich in folgende Arbeitspakete:
- Projektplanung (Ergebnis: Roadmap für den Prozess der Immobilienkonzeptentwicklung)
- Kommunikationsplanung (Ergebnis: Stakeholderanalyse, Kommunikationskonzept, kommunikative Maßnahmen)
- Sozialraumanalyse (Ergebnis: Sozialräumliche Basisanalyse, Optionen für gemeindliches Engagement vor Ort / im Sozialraum)
- Strategieentwicklung (Ergebnis: Purpose und Pastoralstrategie für die Kirchengemeinde / den pastoralen Raum)
- Geschäftsmodellentwicklung vor Ort auf der Basis von Sozialraumanalyse (Optionen), Pastoralstrategie und normativen Vorgaben (Ergebnis: lokale Geschäftsmodelle für Gemeinden / Kirchorte)
- Kriteriengeleitete Bewertung der lokalen Geschäftsmodelle und der zugeordneten Immobilien (kriterienbezogene Kennwerte und Rangfolgen)
- Auswahl möglicher Kombinationen von Geschäftsmodellen und zugeordneter Immobilien (Ergebnis: alternative Cluster/Szenarien als Grundlage für die Entscheider:innen)
- Bei Bedarf können im Verlauf oder im Anschluss weitere Aspekte aufgegriffen und inhaltlich vertieft werden, z.B. Innovation/Exnovation, Angebotsentwicklung, Markenbildung/Angebotskommunikation, Positionierung/Kooperation im Sozialraum
3.3. Kontextualisierung
Mit zu berücksichtigen sind darüber hinaus Maßnahmen, die dazu dienen, die Menschen am Prozess teilhaben und zu Wort kommen zu lassen.
Die Reihenfolge der Arbeitspakete gibt den groben zeitlichen Verlauf des Prozesses wieder. Mit zu berücksichtigen sind darüber hinaus Maßnahmen, die dazu dienen, die Menschen am Prozess teilhaben und zu Wort kommen zu lassen. Hierzu zählen insbesondere
- die Durchführung kommunikativer Maßnahmen nach innen (z.B. Arbeit mit Multiplikator:innen, Information der Mitarbeiter:innen) und außen (z.B. Pressearbeit)
- die Gestaltung partizipativer Elemente (z.B. Hearings oder Konsultationen) und
- Maßnahmen des Konfliktmanagements bzw. der Mediation, die u.U. bei fortgeschrittener Polarisierung indiziert sind
Die Architektur muss sicherstellen, dass die Konsultation der jeweils übergeordneten Systeme in angemessener Weise erfolgt und mögliche Impulse daraus gut aufgenommen und in die Entscheidung integriert werden können.
Im Blick auf die Geschäftsmodelle und deren Bewertung könnte zudem die konsultative Einbeziehung externer Knowhowträger:innen sein. Hier kommen z.B. Politik und Verwaltung, andere Kirchen und Religionsgemeinschaften, Vertreter:innen anderer Professionen (z.B. der Wirtschaft) oder ausgewiesene Expert:innen für den Sozialraum in Frage.
3.4. Entscheidung
In der Praxis spielen hier die Seelsorgeteams mit ihren je eigenen Binnendynamiken eine mehr oder weniger dominierende Rolle.
Die Entscheidung über Pastoralstrategie, Geschäftsmodelle und Immobilienkonzept erfolgt formell in den vom Kirchen- bzw. im Staatskirchenrecht dafür vorgesehenen und damit zuständigen Gremien. Davon unberührt kann die inhaltliche (Vor-)Entscheidung vor Ort organisatorisch ganz anders geregelt werden. In der Praxis spielen hier die Seelsorgeteams mit ihren je eigenen Binnendynamiken eine mehr oder weniger dominierende Rolle. Um eine größtmögliche Identifikation von Aktiven und Mitgliedern zu erreichen, empfiehlt es sich, nicht nur die inhaltlichen Vorklärungen, sondern auch die Entscheidung selbst partizipativ zu gestalten.
Das beinhaltet drei Aspekte:
- Es muss etwas zu entscheiden geben, d.h. am Ende des Prozesses muss eine Entscheidungsgrundlage vorliegen, die eine Wahlmöglichkeit beinhaltet.
- Die unterschiedlichen Ebenen bzw. Subsysteme müssen direkt oder repräsentativ in die Entscheidung eingebunden sein, d.h. es gibt eine transparente und ausbalancierte Entscheidungsarchitektur.
- Die Entscheidung erfolgt nach einem Verfahren, das polarisierende (u.U. knappe) Mehrheitsentscheidungen ausschließt.
Zu 1)
Die inhaltlichen Vorarbeiten für ein pastoral bzw. seelsorglich fundiertes, zukunftsfähiges Immobilienkonzept sind so zu gestalten, dass sie eine schrittweise kriteriengeleitete Verdichtung der verfügbaren Informationen erlauben, die es ermöglicht eine begrenzte Zahl (z.B. 3 bis 5 ) möglicher (im Blick auf die Kriterien) hochwertiger und vergleichbarer Portfolios von Geschäftsmodellen inkl. zugehöriger Immobilien vorzulegen. Das Zustandekommen dieser Optionen ist anhand der Kriterien zu begründen und transparent darzustellen.
Zu 2)
Strukturell kann die Beteiligung der Mitglieder an der Entscheidung über die Optionen (Portfolios) repräsentativ oder direkt erfolgen. Die einfachste Form repräsentativer Entscheidung ist die Abstimmung in den zuständigen Gremien. Es könnte aber sachgemäßer sein, punktuell für diese Fragestellung ein repräsentatives Gremium zu bilden, das die unterschiedlichen Sichtweisen im Referenzsystem viel besser abbildet und damit zu einer ausbalancierteren Entscheidung kommen kann. Es wäre aber auch möglich, aktive Gruppen oder die Kirchenmitglieder mittels Befragung selbst direkt entscheiden zu lassen.
Zu 3)
Mehrheitsentscheidungen sind dichotom (Ja/Nein-Entscheidungen). Sie führen regelmäßig zu Polarisierungen, gerade wenn damit starke Emotionen verbunden sind. In der Folge wird die Annahme bzw. Identifikation mit der Lösung erheblich erschwert. Das Klima kann auf lange Zeit ernsthaft beschädigt werden. Daher ist es sinnvoll Entscheidungsverfahren heranzuziehen, die eine differenziertere Bewertung ermöglichen bzw. zu konsensnahen Entscheidungen führen. Bei repräsentativen Entscheidungen kommt hier insbesondere das aus der Soziokratie bekannte Konsent-Verfahren in Frage, alternativ systemisches Konsensieren. Bei direkter Beteiligung der Mitglieder (über eine Befragung) wäre die Verwendung von Skalen angezeigt, die eine differenzierte Einschätzung ermöglichen.
4. Tools
Über die Visualisierung öffnen die Instrumente einen zweiten Wahrnehmungskanal, der besonders einprägsam ist.
Im Folgenden werden exemplarisch Instrumente vorgestellt, die in Prozessen der Immobilienkonzeptentwicklung zur Anwendung kommen. Es handelt sich dabei um Methoden, die auf Plakaten in DIN-A0- oder DIN-A1-Format bzw. auf sog. Karten in DIN-A4-Format strukturiert dargestellt sind. Die Instrumente stellen also Landkarten zur Verfügung, an denen man sich orientieren und das Thema schrittweise mit Hilfe von Haftnotizzetteln bearbeiten kann. Über die Visualisierung öffnen die Instrumente einen zweiten Wahrnehmungskanal, der besonders einprägsam ist. Sie reduzieren Komplexität und bieten dennoch eine hinreichende Differenzierung, um zu qualifizierten Ergebnissen zu kommen. Damit sind die Instrumente gerade für Ehrenamtliche eine große Erleichterung und führen schnell zu guten Arbeitsergebnissen.
4.1. Projektierung
Für eine strukturierte Projektplanung eignet sich das Projektboard. Es ist ein bewährtes und zugleich leichtgängiges Werkzeug, um sich in einer Planungsgruppe über die Anlage und Steuerung eines Projekts zu verständigen. Das Board hilft, das Projekt in seinem Verlauf zu planen, zu steuern und seinen Fortschritt im Auge zu behalten. Ausgehend vom Auftrag werden Ziele, Adressaten, Beteiligte, Organisation und Aufgaben bestimmt. Die Aufgaben lassen sich auf einer Zeitschiene anordnen und mit Meilensteinen und Monitoring-Zeitpunkten versehen. Risiken werden festgehalten. Ein Themenspeicher kann zwischen den Bearbeitungsphasen genutzt werden, um wichtige Aspekte festzuhalten, die in eine spätere Bearbeitung einfließen können.
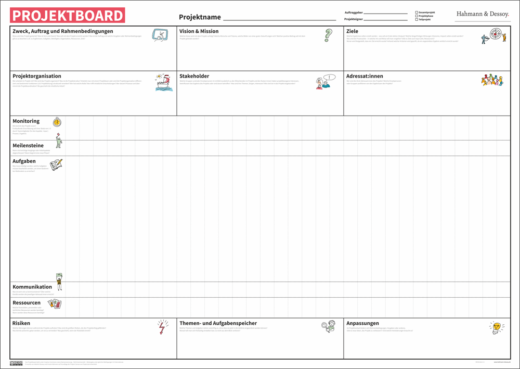
Die Ergebnisse werden in Form einer Roadmap verdichtet und nach Abstimmung mit den Beteiligten zunächst dem:der Auftraggeber:in zur Entscheidung vorgelegt. Im Anschluss sind die übergeordneten Instanzen mit einzubeziehen. Sie können Änderungswünsche eintragen, die dann vor Ort erneut zu verhandeln sind. Wenn keine der beteiligten Instanzen ernsthafte Bedenken hat, wird die Roadmap von ihnen unterschrieben und gilt verbindlich (multilateraler Kontrakt).
4.2. Kommunikation
Die Planung der Kommunikation ist für das Mitgehen der Betroffenen und Beteiligten in den Kirchengemeinden zentraler Bedeutung. Nur wenn sie mehrheitlich den Prozess und seine Notwendigkeit verstehen, werden sie daran beteiligen und sich mit den Ergebnissen identifizieren können.
Da es um die Verteilung knapper Ressourcen geht, ist die Kommunikation zum Prozess bei einem Teil der Betroffenen mit starken Emotionen verknüpft. Unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse prallen aufeinander. Man muss davon ausgehen, dass es ganz unterschiedliche Einstellungen zum Prozess gibt. Die Menschen sind mehr oder weniger stark involviert. Die Annahmen, wie stark man vom Rückbau betroffen ist gehen auseinander. Das alles erfordert eine differenzierte, dialogisch orientierte Kommunikation.
Basis für das Kommunikationskonzept ist eine qualifizierte Stakeholderanalyse mit der Anspruchsgruppen identifiziert werden, die sich
- hinsichtlich ihrer Einstellung zum Projekt (positiv oder negativ) und ihrem Einfluss im System (hoch oder niedrig) bzw.
- hinsichtlich der Art ihres Involvements / ihrer inneren Beteiligung (hoch oder niedrig) und ihrer Betroffenheit (Ausmaß des angenommenen Gewinns oder Schadens durch das Projekt) unterscheiden
Anders als bei einer Kommunikation nach dem Gießkannenprinzip, berücksichtigt die Stakeholderkommunikation diese Besonderheiten von Adressat:innen und passt sich dahingehend an.
Diese und weitere Informationen sind wichtig, um die Kommunikation adressatenorientiert in differenzierter Weise zu gestalten.9 Anders als bei einer Kommunikation nach dem Gießkannenprinzip, berücksichtigt die Stakeholderkommunikation diese Besonderheiten von Adressat:innen und passt sich dahingehend an. Das ist nicht nur erfolgsversprechender, sondern ist auch Ausdruck einer aufmerksamen, zugewandten Haltung: Die Unterschiedlichkeit der Menschen wird wahr- und angenommen und spielt für das eigene Handeln eine Rolle.
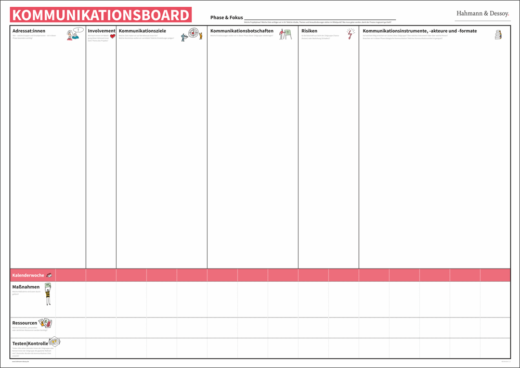
Die Kommunikationsplanung selbst erfolgt dann mit Hilfe des Kommunikationsboards. Es bietet methodische Hinweise zur konkreten Bearbeitung der Kommunikationsaufgabe. Man kann bei der Bearbeitung die übergreifende Kommunikation betrachten, die im Projekt unabdingbar ist und darüber hinaus in einem zweiten Schritt die einzelnen Stakeholdern mit ihren spezifischen Kommunikationsanforderung.
Das Kommunikationsboard hat im oberen Teil einen tabellenartigen Aufbau. Hier werden für die übergreifende Kommunikation bzw. die verschiedenen Stakeholder Kommunikationsrelevante Informationen eingetragen bzw. Festlegungen vorgenommen. Sie betreffen v.a. die Kommunikationsziele, die Kommunikationsbotschaften, bestehende Risiken und Kommunikationsinstrumente, -akteure und -formate.
Der untere Teil des Kommunikationsboards verfolgt eine prozessorientierte Sichtweise. Auf einer Zeitachse werden die Kommunikationsmaßnahmen, benötigte Ressourcen oder auch vorzunehmende Texts im Vorfeld oder aber Controllingschleifen im Nachgang festgelegt und eingeordnet.
4.3. Sozialraumanalyse
Für die Durchführung der Sozialraumanalyse stehen unterschiedliche Instrumente zur Verfügung. Voraussetzung ist die eine sorgfältige Abgrenzung des bzw. der betrachteten Sozialräume. Hierzu eignen sich Karten, die i.d.R. in kirchlichen Verwaltungen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus lassen sich Kartierungen gut in GoogleMaps realisieren.
Mit Hilfe des Datenboards werden relevante soziodemografische Daten zur Bevölkerung im Sozialraum erfasst: Altersstruktur, Lebensformen, Milieuverteilung, Arbeitssituation, Herkunft, Weltanschauung / religiöse Orientierung und Sozialindikatoren wie Arbeitslosenquote, SGB II-Quote oder Kriminalitätsrate. Im Ergebnis ergibt sich ein Profil der Wohnbevölkerung im Sozialraum, das Hinweise sowohl auf Ressourcen und Potenziale als auch auf Bedürfnis- und Problemlagen bereitstellt. Bei der Bearbeitung kann man sich auf die Einschätzung von Expert:innen vor Ort (z.B. aus Caritas oder Diakonie) oder aber entsprechendes statistisches Material stützen, das i.d.R. über die Zivilgemeinde oder in Teilen auch über die kirchlichen Verwaltungen (z.B. Milieudaten) zu beziehen ist.
In einem zweiten Schritt geht es um die Infrastruktur im Sozialraum. Hier steht das Board Sozialraumscreening zur Verfügung. Es wird ebenfalls mit Informationsträger:innen aus dem Sozialraum bearbeitet. Schrittweise werden im Diskurs mit Hilfe von Leitfragen die harten Faktoren administrativer Raumgestaltung analysiert, beschrieben, geordnet und bewertet. Es stehen dafür 10 Cluster zur Verfügung: Umwelt/Ökologie, Wohnen, Bildung, Soziales, Arbeit, Verkehr, Gesundheit, Kultur, Verwaltung und Wirtschaft. Anhand der Ergebnisse werden grundlegende Strukturen, Zusammenhänge zwischen Einflussfaktoren und Handlungs- bzw. Entwicklungsbedarfe sichtbar.
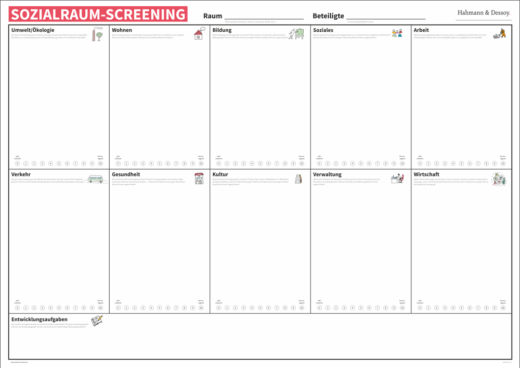
Die Basisanalysen zu den Sozialräumen, in denen sich eine Kirchengemeinde bewegt, können sich durchaus über einen längeren Zeitraum hinziehen, wenn Informationen fehlen, wenn Fragen auftauchen, die zu klären sind oder Hypothesen formuliert werden, die einer empirischen Überprüfung bedürfen etc.
Zu beteiligen sind nach Möglichkeit alle kirchlichen Akteur:innen, die vor Ort aktiv bzw. tätig sind, also z.B. auch die verbandliche Caritas.
Auf Grundlage der Basisanalyse wird die sozialräumliche Betrachtung in den Gemeinden bzw. an den Kirchorten fortgesetzt. Zu beteiligen sind nach Möglichkeit alle kirchlichen Akteur:innen, die vor Ort aktiv bzw. tätig sind, also z.B. auch die verbandliche Caritas. In den lokalen Workshops geht es darum, Optionen für kirchliches Engagement im Sozialraum zu entwickeln. Man nutzt dafür das Optionsboard.
Ausgehend von den Issues bzw. Entwicklungsaufgaben, den vorhandenen Ressourcen und potenziellen Partnern werden zunächst Ideen für mögliche mittel- oder langfristige Engagements gesammelt, die dann im weiteren Verlauf strukturiert bearbeitet werden, z.B. im Blick auf benötigte Ressourcen, mögliche Partner, Nähe zum eigenen Purpose etc. Abschließend werden die Ideen im Blick auf die Sinnhaftigkeit und den Nutzen für alle Beteiligten hin bewertet.
Entscheidet man sich im weiteren Verlauf für eine Engagement-Option und entwickelt daraus ein Geschäftsmodell für den Kirchort oder die Gemeinde, so kann man mit Hilfe eines spezifisch auf diese Frage hin optimierten Kooperationsboards die Zusammenarbeit mit den im Modell vorgesehenen Partnern konfigurieren und schrittweise entwickeln.
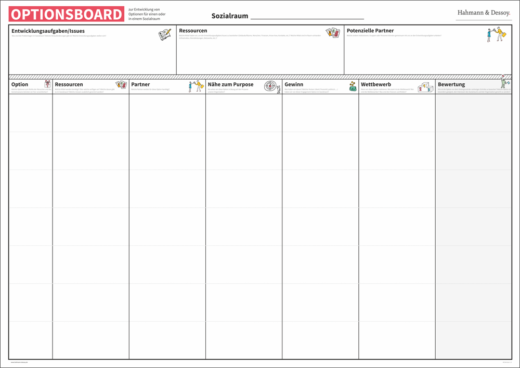
4.4. Pastoralstrategie
Wenn ein Immobilienkonzept pastoral begründet sein soll, genügt ein Pastoralkonzept nicht, das die bestehende Praxis beschreibt.
Immobilienkonzepte sind naturgemäß langfristig angelegt. Wenn ein Immobilienkonzept pastoral begründet sein soll, genügt ein Pastoralkonzept nicht, das die bestehende Praxis beschreibt. Gebraucht wird eine Pastoralstrategie, also eine Strategie kirchlichen Handelns im jeweiligen Bezugsraum (Kirchengemeinde, pastoralen Raum), die den Weg in die Zukunft beschreibt.
Ausgangspunkt für die Entwicklung einer solchen Strategie ist die Vergewisserung bzw. Verständigung über das gemeinsame Mindset: „Warum sind wir Kirche?“ (tragende Erfahrung, Kern der Hoffnung) und „Wozu sind wir Kirche?“ (Sinn und Zweck unseres Tuns). Gearbeitet wird dabei im Blick auf die Wozu-Frage mit der Purposekarte, zunächst individuell und dann gemeinsam.
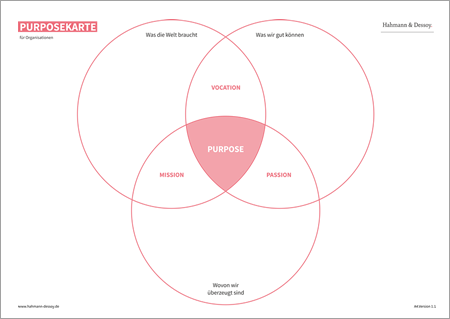
Mit Hilfe von Leitfragen wird man im Venn-Diagramm schrittweise von außen nach innen an den Purpose der Organisation, die Schnittstelle zwischen Vocation, Mission und Passion herangeführt.
Ausgehend vom Purpose sind strategische Grundätze festzulegen und strategische Richtungsentscheidungen zu treffen. Gearbeitet wird dabei mit dem Strategieboard. Das Board ist in vier Sektoren gegliedert. Bei den Grundsätzen (Sektor 1) sind die wichtigsten Aspekte einer gemeinsamen Vision (Utopie von Kirche), ein prägnantes Missionsstatement (i.S. eines Nutzenversprechens für die Adressaten), zentrale Werte für das kirchliche Handeln sowie der Beitrag zur gesellschaftlichen Wertschöpfung und zu einer nachhaltigen Entwicklung einzutragen.
Anders als bei klassischen Pastoralkonzepten geht es bei der Pastoralstrategie nicht um die Beschreibung des Ist-Zustandes, sondern um dir Beschreibung der langfristigen Zielperspektive und möglicher Schritte auf dem Weg dorthin. Es geht also um die Transformation von Kirche in eine gute Zukunft. Der erste und wichtigste Schritt ist dabei die Vergewisserung und Verständigung darüber, in welche Richtung man gehen, also sich verändern will. In diesem Schritt werden die grundlegenden Linien i.S. strategischer Richtungsentscheidungen für die langfristige Gestaltung und Entwicklung der Organisation, in diesem Fall der Kirche im Bezugsraum, festgelegt. Dabei beantwortet man im wesentlichen folgende Fragen:
- Wie positioniert sich die Organisation (Kirche) in ihrem Umfeld? – Markt (Sektor 2)
- Wie gestaltet die Organisation (Kirche) ihre Binnenarchitektur? – Konfiguration (Sektor 3)
- Wie gewinnt, nutzt und pflegt die Organisation (Kirche) ihre Mittel? – Ressourcen (Sektor 4)
Betrachtet man etwa den Markt, ist zu überlegen, wer zukünftig die Adressaten kirchlichen Handeln sein sollen.
Betrachtet man etwa den Markt, ist zu überlegen, wer zukünftig die Adressaten kirchlichen Handeln sein sollen. Ist man als Kirche zukünftig (ausschließlich) für die treuen Kirchgänger da oder geht es um diejenigen, die bisher nicht oder nicht mehr erreicht werden? Wer sind diese Adressaten genauer? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Angebote und deren Gestaltung? Etc.
Im Blick auf die Konfiguration ist z.B. bedeutsam, wie sich die Kirche im größeren Raum aufstellen will: Wie sind Zentralität und Dezentralität auszubalancieren? Liegt das Gewicht auf den Zentren (und den Hauptamtlichen) oder auf den lokalen Kirchorten (und den Ehrenamtlichen)? Wie viele Gremienebenen braucht man? Etc.
Bei den Ressourcen stehen ebenfalls grundlegende Zukunftsfragen an. Liegt die Verantwortung für das seelsorgliche Handeln bei den Hauptberuflichen oder in der Hand der Getauften? Wie sind Aufgaben und Befugnisse zu regeln? Wie ist das Miteinander zu denken? Etc.
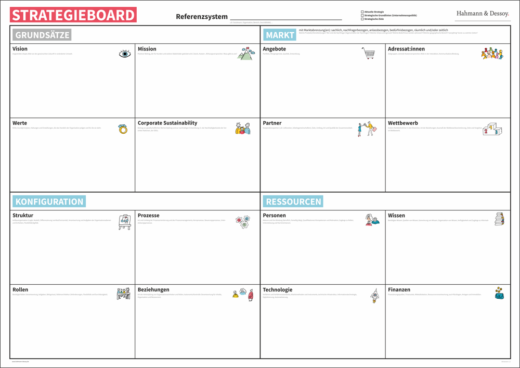
Im weiteren Verlauf lassen sich die Richtungsentscheidungen dann auch weiter konkretisieren in Form überprüfbarer, zeitlich gefasster strategischer Ziele inkl. zugehöriger Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen. Hilfreich ist hier die Operationalsierungskarte und das Zielsystemboard.
Die strategischen Grundsätze, Richtungsentscheidungen und Ziele haben normativen Charakter. Sie bilden die verbindliche Grundlage für aktuelle und zukünftige Entscheidungen in der Organisation, z.B. auch bzgl. der Immobilien und ihrer Verwendung. Sie gelten dauerhaft, so lange, bis sie im Konsens geändert werden.
4.5. Lokale Geschäftsmodelle
Jede Organisation hat – ob nun explizit entwickelt oder implizit eingeführt – ein Geschäftsmodell, das abbildet, wie der Nutzen für die Adressat:innen der Angebote entsteht und wie sich umgekehrt die Wertschöpfung in der Organisation vollzieht. Das trifft auch auf Kirchengemeinden und Kirchorte/Gemeinden zu.
Im Rahmen der Immobilienkonzeptentwicklung ist lokal, d.h. in den Gemeinden bzw. an den jeweiligen Kirchorten, zu überlegen, wie das Kirche-Sein zukunftsorientiert gestaltet werden kann und welche alternativen Optionen es dabei gibt.
Um dies qualifiziert zu tun, hilft die Idee des „Geschäftsmodells“. Das Modell beinhaltet die innere Logik oder Geschäftslogik der Organisation und damit alle wesentlichen Aspekte, die zur Wertschöpfung und für das Entstehen von Kundennutzen relevant sind. Das Geschäftsmodellboard dient dazu, mögliche Geschäftsmodelle zu entwickeln, zu visualisieren, zu testen, zu verändern usw.
Das Geschäftsmodellboard weist 5 Dimensionen auf und verfügt insgesamt über 13 Felder, die nacheinander und aufeinander bezogen entlang der jeweiligen Leitfragen bearbeitet werden:
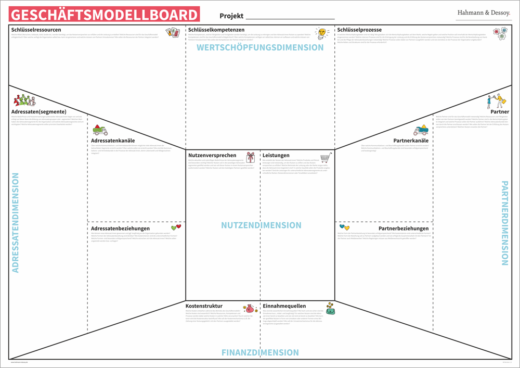
- Adressatendimension mit den Feldern Adressatensegmente, -kanälen und -beziehungen
- Nutzendimension mit den Feldern Nutzenversprechen und Leistungen
- Wertschöpfungsdimension mit den Feldern Schlüsselressourcen, -kompetenzen und -prozesse
- Partnerdimension mit den Feldern Partnersegmente, -kanäle und -beziehungen
- Finanzdimension mit den Feldern Kostenstruktur und Einnahmequellen
Die Bezugspunkte für die (Neu-)Konzeption der kirchlichen Handlungslogik vor Ort sind neben den diözesanen bzw. landeskirchlichen Vorgaben v.a. die verbindliche Pastoralstrategie des Bezugsraums und die im Vorfeld erfolgte Sozialraumanalyse.
Die Bezugspunkte für die (Neu-)Konzeption der kirchlichen Handlungslogik vor Ort, also des Geschäftsmodells, sind neben den diözesanen bzw. landeskirchlichen Vorgaben v.a. die verbindliche Pastoralstrategie des Bezugsraums (Kirchengemeinde, pastoraler Raum) und die im Vorfeld erfolgte Sozialraumanalyse, speziell die dort für den jeweiligen Ort herausgearbeiteten Optionen eines kirchlich geprägten Engagements im Sozialraum.
Idealerweise arbeiten Vertreter unterschiedlicher kirchlicher Gremien, Gruppen und Organisationen, die im Einzugsgebiet aktiv sind, an der Erstellung möglicher lokaler Geschäftsmodelle mit, also neben Ortsausschüssen oder Gemeindeteams, Verbände, Caritas, Bildungseinrichtungen etc.
Im Ergebnis liegen nach Möglichkeit mehrere Geschäftsmodelloptionen für die Kirchorte oder auch losgelöst von ihnen vor, die darüber Auskunft geben, wie das kirchliche Leben in Zukunft gestaltet werden kann, einschließlich der erforderlichen Ressourcen was Finanzen, Personal und Immobilien betrifft. Denkbar ist, dass zur Aufgabe gehört, mindestens ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das ohne die aktuell genutzten Gebäude (Kirche, Pfarrheim) auskommt.
4.6. Einzelbewertung von Geschäftsmodellen und Immobilien
Sind die voran skizzierten Schritte durchgeführt, liegen alle Informationen auf dem Tisch, die für eine qualifiziert Entscheidung über die zukünftige Ausgestaltung des kirchlichen Lebens inkl. der zugehörigen Immobilien erforderlich sind. Sie fließen nun in einen strukturierten und transparenten Bewertungsprozess ein. Dieser beginnt mit der Einzelbewertung von Geschäftsmodellen und Immobilien nach fachlichen Kriterien.
Einzelbewertung der Geschäftsmodelle
Die Bewertung der Geschäftsmodelle erfolgt in einer Bewertungskommission, die mit Personen aus den Entscheidungsorganen besetzt ist, die im Bezugssystem eine hohe Anerkennung genießen. In die Bewertung fließen folgende Kriterien ein:
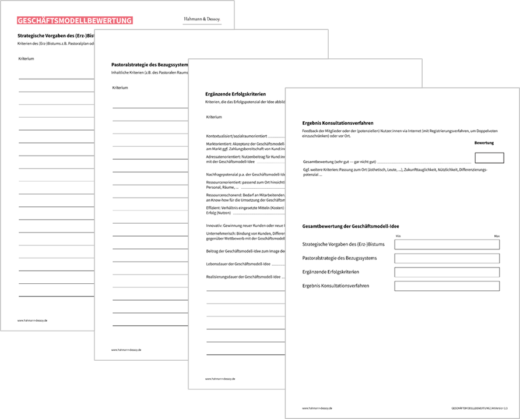
- die strategische Vorgaben der Diözese bzw. der Landeskirche (Kriterienset 1)
- die Pastoralstrategie des Bezugssystems (Kirchengemeinde, pastoraler Raum) (Kriterienset 2)
- ergänzende übergreifende Erfolgsfaktoren sowie (Kriterienset 3)
- das Ergebnis der Konsultation (Kriterienset 4)
Zur Unterstützung und Objektivierung des Bewertungsvorgangs dient die Kartensammlung Geschäftsmodellbewertung. Bei den strategischen Vorgaben der Diözese bzw. der Landeskirche und der Pastoralstrategie werden die Einzelkriterien zunächst gemeinsam aus den jeweiligen Texten abgeleitet. Bei den ergänzenden übergreifenden Erfolgsfaktoren gibt es bereits ausformulierte Kriterien, die jedoch bei Bedarf zusätzlich ergänzt werden können. In allen drei Fällen wird in einem zweiten Schritt festgelegt, mit welcher Gewichtung die Kriterien in das jeweilige Gesamtergebnis einfließen sollen. Danach wird auf einer Skala von 0 bis 10 eingeschätzt, inwieweit die Geschäftsmodelle die einzelnen Kriterien erfüllen. Für die Gesamtbewertung wird pro Kriterium das Produkt aus Gewichtung x Bewertung gebildet, die Ergebnisse werden summiert und durch die Anzahl der Kriterien geteilt. Im Ergebnis liegt für jedes Geschäftsmodell bei jedem Kriterienset der gewichtete Durchschnitt als Gesamtscore vor. Aus dem Konsultationsverfahren liegt ein zusätzlicher Score vor, der angibt, wie schlüssig und sinnvoll die an der Konsultation beteiligten Personen das jeweilige Geschäftsmodell insgesamt einschätzen.
Für die vier Scores kann zusätzlich das arithmetische Mittel als Gesamtscore bestimmt werden. Mit Hilfe der so ermittelten Kennwerte lassen sich die Geschäftsmodelle insgesamt und für jeden Kirchort in eine Rangfolge bringen, aus der erkennbar ist, welche Modelle am ehesten den zugrunde gelegten Kriterien entsprechen.
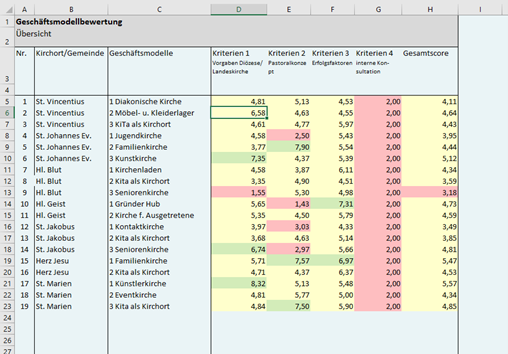
Die Ergebnisse der Geschäftsmodellbewertung werden systematisch in einer speziell hierfür erstellten Excel-Datei zur Geschäftsmodell- und Immobilienbewertung dokumentiert.
Bewertung der Immobilien
Die Einzelbewertung der Immobilien wird im zuständigen Fachgremium (Kirchenvorstand, Presbyterium) vorgenommen.
Wichtig ist bei dieser Betrachtung, die Schlüsselthemen Nachhaltigkeit und Klimaneutralität mit zu berücksichtigen.
Wichtig ist bei dieser Betrachtung, die Schlüsselthemen Nachhaltigkeit und Klimaneutralität mit zu berücksichtigen. Die Diözesen/Landeskirchen legen dabei die Standards fest, die im Blick auf die erforderliche Sanierung der Gebäude zu beachten sind und damit für die Ausgestaltung des Immobilienkonzepts zentrale Bedeutung haben.
Für eine energetische Sanierung bedarf es einer verlässlichen und differenzierten Einschätzung des energetischen Zustands der Immobilie als auch einer validen Kostenschätzung. Beides ist durch die übergeordneten kirchlichen Behörden, durch eignen Sachverstand oder entsprechende Gutachten sicherzustellen.
Neben den laufenden Kosten für Unterhaltung und Erhalt sowie die Sanierung von Gebäuden, ist mit zu berücksichtigen, inwieweit es normative Vorgaben seitens der Diözese bzw. Landeskirche gibt und welche rechtlichen bzw. vertraglichen Bindungen (z.B. Denkmalschutz, langfristige Verträge) ggf. zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus ist von Bedeutung, ob es Möglichkeiten alternativer Verwendung oder Optionen zur Veräußerung/Übereignung von Immobilien gibt.
Die Bewertung der Immobilien wird unmittelbar in der Excel-Datei Datei zur Geschäftsmodell- und Immobilienbewertung vorgenommen.
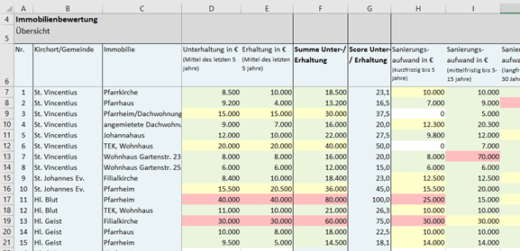
1.7. Lösungsszenarien und deren Bewertung
Am Ende des Entwicklungsprozesses muss im Blick auf Geschäftsmodelle und Immobilien eine Auswahl getroffen werden. Es genügt dabei nicht, die einzelnen Modelle und die zugehörigen Immobilien isoliert zu betrachten. Mitentscheidend ist die Sinnhaftigkeit des Gesamtpakets. So kann es z.B. sein, ein Geschäftsmodell „Familienkirche“ an mehreren Standorten in der Einzelbewertung gut abschneidet. Im Blick auf das Gesamtsystem einer Kirchengemeinde wäre eine Lösung mit mehreren Familienkirchen allerdings fragwürdig, weil man damit wechselseitig in Konkurrenz treten und sich das Wasser abgraben würde, während andere Themen und Zielgruppen oder auch sozialräumliche Herausforderungen außen vor blieben.
Aus diesem Grund bedarf es vor einer Entscheidung durch die verantwortlichen Gremien der Identifikation möglicher sinnvoller Kombinationen oder Cluster von Geschäftsmodellen/Immobilien, die in der Summe der Einzelbewertungen möglichst gut abschneiden. Das geschieht in einer kleinen Arbeitsgruppe mit Hilfe der Excel-Datei zur Geschäftsmodell- und Immobilienbewertung.
Aus den bewerteten Geschäftsmodellen und den ihnen zugehörigen Immobilien werden iterativ jene 4 bis 6 Kombinationen herausgefiltert, die in der Gesamtbewertung am besten abschneiden und damit den übergeordneten pastoralen, ökologischen, baulichen und finanziellen Anforderungen sowie den lokalen Bedürfnissen am ehesten entsprechen.
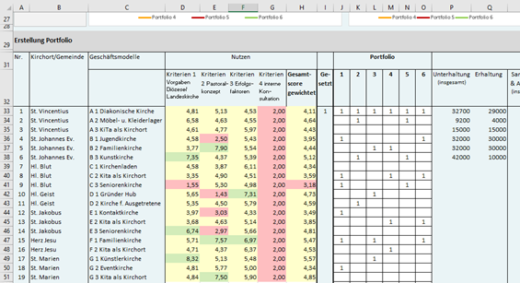
Das Vorgehen dabei ist nahezu spielerisch. Man legt fest, welche Geschäftsmodelle zum Portfolio dazugehören sollen. Die pastorale und finanzielle (Gesamt-)Bewertung der Portfolios wird unmittelbar berechnet und im Vergleich der Portfolios 1 bis 6 tabellarisch und grafisch dargestellt.
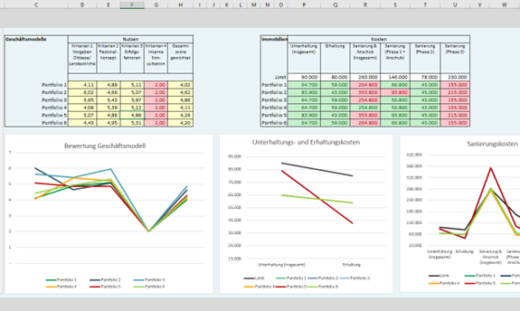
Liegen die Optionen vor, werden diese in knapper Form darstellt und hinsichtlich der Auswahl begründet. Die Argumente liefert die zuvor erfolgte, systematische Bewertung anhand pastoraler und finanzieller sowie baulicher Kriterien. Die Entscheidung erfolgt dann in den zuständigen Gremien anhand der im Prozess der Immobilienentwicklung verdichteten Informationen.
5. Praxiserfahrung
Die Erfahrung in der Praxis zeigt, dass sowohl hauptamtlich in Seelsorge und Pastoral Tätigen als auch ehrenamtlich Engagierten ein strukturiertes Arbeiten sehr entgegenkommt, weil es Ressourcen schont, den Arbeitsfortschritt greifbar macht und zu Entscheidungen führt.
Die Arbeit mit den Boards hilft, beim jeweiligen Thema die Übersicht zu behalten, hinreichend differenziert in die Materie einzusteigen und schrittweise vorzugehen.
Die Arbeit mit den Boards hilft, beim jeweiligen Thema die Übersicht zu behalten, hinreichend differenziert in die Materie einzusteigen und schrittweise vorzugehen. Die Moderation ist in der Lage, situativ zu entscheiden, wie tief man in Details geht, wo in der Diskussion Schwerpunkte zu setzen sind, ob bestimmte Felder vernachlässigt werden können etc. Darüber hinaus ist es vergleichsweise einfach, den Fokus zu halten und den roten Faden ansichtig zu machen.
Die Ergebnisse sind i.d.R. sehr differenziert und zugleich hoch verdichtet, dass eine zeitnahe Verschriftlichung unabdingbar ist. Hier ist zu klären, inwieweit das vom System selbst zu leisten ist (was ideal wäre) oder von den externen bzw. internen Entwickler:innen als zusätzliche Dienstleistung angeboten wird.

Praxis
Bistum Trier
Ja und Nein.
Ja, insofern wir die Realität zurückgehender finanzieller und personeller Ressourcen genau betrachten und versuchen, die Konsequenzen zu ziehen: Verhandlungen zu höheren Refinanzierungen mit Staat und Kommunen, Planung von konkreten Kostensenkungsmaßnahmen.
Nein, weil wir wohl nicht konsequent genug sind, nicht umfassend genug denken und weil wir uns noch Dinge schönreden (z.B. „Die Zinsen steigen ja wieder, das bringt uns Entlastung bei den Pensionsrückstellungen…“). Ähnliches gilt bei der Fusion von Pfarreien. Die „Pfarrei der Zukunft“ wäre ein großer Schritt auf eine Neubetrachtung von Pfarrei (als Organisations- und Verwaltungsraum) mit vielen „Orten von Kirche“ (als Räume kirchlichen Lebens und seelsorgerischen Handelns) gewesen. Sie hätte meiner Ansicht nach selbst disruptiv gewirkt. Wir hätten eine Entwicklung vorweggenommen, die nun schleichend kommt. Und wir hätten dabei selbst steuernd wirken können, statt einer Entwicklung ausgeliefert zu sein. Leider ist die „Pfarrei der Zukunft“ am Widerstand einiger Verwaltungsräte und an Rom gescheitert. Die Entwicklung findet nun trotzdem statt – auf einen längeren Zeitraum hin und mit wesentlich mehr Aufwand.
Die letzten drei Jahre mit ihren vielen unvorhersehbaren Krisen (Pandemie, Flutkatastrophe und Klimakrise, Krieg und Flucht, Energiekrise und Inflation) haben in die weitere Entwicklung viel Unsicherheit hineingebracht: Was können wir noch vorhersehen, berechnen? Geschieht nicht doch alles anders?
Im Bistum Trier hat dies im Rahmen des durch inhaltliche Kriterien geleiteten Haushaltssicherungsprozesses auch dazu geführt, dass kein Handlungsfeld ganz aufgegeben wird, sondern überall etwas gespart werden soll, wenn auch in unterschiedlicher Intensität und mit zarten Akzentsetzungen. Es scheint noch nicht der Zeitpunkt („kairós“) zu entscheiden, wo sich zukünftig der Schwerpunkt kirchlichen Handeln abspielen sollte.
Von einer systematischen Diskussion und Beratung zu diesem Thema kann nicht die Rede sein. Es wird hier oder da angesprochen – siehe Diskussion zur Haushaltssicherung oder auch im Zusammenhang des Synodalen Weges oder in Gesprächen in kleinem Kreis am Rande von Konferenzen und Sitzungen. Aber das Thema wird in meinen Augen noch verdrängt, bzw. vielfach flüchtet man sich ins Gewohnte und Sicherheit Gebende – mit dem Argument des „Noch“.
Zunächst einmal werden die Zahlen kommuniziert: Kirchenaustritte mit stets neuen Rekorden, steter Rückgang der Katholikenzahl im Bistum auch durch Überhang an Sterbefällen gegenüber Taufen. Im Zusammenhang mit der Kommunikation des Haushaltssicherungskonzeptes wurden die Prognosen deutlich gemacht: minus 35% reale Kirchensteuereinnahmen (=135 Mio. Euro weniger); minus 50% hauptamtliches pastorales Personal. Auch der Arbeitskräftemangel auf allen Ebenen wird bei vielen Gelegenheiten angesprochen. Der unmittelbar darauffolgende Gedanke, dass dieser Rückgang nicht ohne Folgen für das kirchliche Leben und Handeln bleiben wird, leuchtet unmittelbar ein.
Aber die Problematik solcher Kommunikation liegt darin, dass die Schilderung des Rückgangs als Schilderung des „Untergangs der Katholischen Kirche“ interpretiert wird. Damit verbunden wird dann die Warnung, dass mit zu viel Schreckensszenarien auch die Motivation zu kirchlichem Handeln verloren gehen kann. Ich halte dagegen und sage, dass eine Minderung der Quantität von kirchlichem Handeln nicht gleichgesetzt werden kann mit einer Minderung an Qualität. Die darin enthaltene Chance des „Weniger ist mehr“ wird aber mangels Erfahrung bislang nur selten geteilt.
Zunächst einmal ist das für mich eine Frage der persönlichen Haltung:
- Disruptive Haltungen machen mir persönlich erstmal keine Angst. Ich halte Veränderungen in der Kirche für not-wendig. Zu Vieles ist verkrustet und erstarrt, aber eben nicht aus eigener, allein menschlicher Kraft zu lösen.
- Es ist für mich auch eine Frage der Spiritualität: Es gibt kein wirkliches Leben, es sei denn durch den Tod hindurch. Das ist die Frohe Botschaft der Auferstehung, aber auch menschliche Erfahrung (z.B. Abnabelung des Kindes von der Mutter nach der Geburt) und das Erleben der Natur (z.B. neues Erwachen im Frühling und Sommer nach dem Sterben in Herbst und Winter). Entsprechend kann eine Optimierung nicht nur aus rein menschlichen Bemühungen entstehen, sondern durch ein Sich Ver-Lassen auf Gott hin (vgl. dazu den empfehlenswerten Artikel von Joachim Reger, Selbstoptimierung. Christliche Reflexion auf ein verbreitetes Ideal, in: Stimmen der Zeit 10/2022, S. 769-777).
Daraus folgend ist es für mich handlungsleitend, den Menschen die Angst vor Veränderungen zu nehmen und – bei aller Enttäuschung und Trauer vor dem starken Rückgang der Bedeutung von Kirche in unserer Zeit – Gelassenheit und Gottvertrauen zu leben und zu verkünden. Daraus wiederum wächst die Kraft, auch aktiv und angstfrei in die Veränderung zu gehen und sie mitzugestalten – natürlich nicht allein, sondern mit Gleichgesinnten.
Die Zielrichtung der Veränderungen sind für mich durch die Ereignisse und prägenden Entwicklungen der letzten Jahre deutlich ablesbar:
- Die Erkenntnisse aus dem Erleben und der Aufarbeitung von sexuellem, geistlichem und Machtmissbrauch in der Kirche müssen zu einer deutlicheren Verteilung von Macht und Verantwortung führen. Führen im Team ist da für mich ein wichtiger Schritt.
- Die vielfältigen Krisen der letzten Jahre machen deutlich, dass die Kirche besonders zur helfenden Nächstenliebe herausgerufen und -gefordert ist. Die Bistumssynode von Trier hat daher das diakonische Handeln in den Mittelpunkt gerückt, das nachsynodal zum Leitwort „Da sein. Für Mensch und Welt“ geführt hat. Im Haushaltssicherungskonzept wurden aus diesem Grund in den besonders diakonisch geprägten Handlungsfeldern (neben den auf Kinder und Jugendliche ausgerichteten) die geringsten Kostensenkungsquoten angesetzt.
Das gehört wohl zu den schwersten Aufgaben, denn der Verantwortung für die Mitarbeiter*innen gerecht zu werden, heißt ja v.a. ihnen den Lebensunterhalt zu ermöglichen. Wenn nicht nur die Kirchensteuereinnahmen aufgrund von demografischer Entwicklung und Kirchenaustritten zurückgehen, sondern einmal die politische Entscheidung fällt, die Kirchensteuer zu streichen (wie es vor wenigen Jahren im benachbarten Luxemburg der Fall war), wird es nicht leicht durchzuhalten sein, niemandem betriebsbedingt zu kündigen.
Im Übrigen versucht die Diözese durch regelmäßige Kommunikation die Mitarbeiter*innen auf dem Laufenden zu halten und v.a. über die Mitarbeitervertretungen auch an den Entwicklungen zu beteiligen – und zwar nicht nur auf den offiziellen bzw. formalen Wegen gemäß der MAVO, sondern auch durch unmittelbares Einbinden in die Steuerungsgruppen der Prozesse.
Die katholische Kirche ist nicht alleiniger Akteur in der Gesellschaft. Durch die zurückgehende Bedeutung und wohl auch Akzeptanz der Kirche in der Gesellschaft wird es zunehmend darauf ankommen, in gute Kooperationen zu gehen. Bei der Sorge um Flüchtlinge in den letzten sieben Jahren wurden da bereits gute Erfahrungen gemacht. Kommunen und andere Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbände gehen womöglich andere Wege der Hilfe, aber im Ziel, dem Wohl der Bedürftigen zu dienen, sind sich viele einig.
Ein weiteres „Kerngeschäft“ von Kirche sehe ich in unserer Botschaft: In unsicheren Zeiten wie den aktuellen suchen Menschen vermehrt nach Sinn, Halt und Orientierung. Die Frohe Botschaft Jesu Christi in ihrem geistlichen und geistigen Reichtum ist geradezu prädestiniert, Menschen in ihren verschiedenen Lebenssituationen abzuholen und Sinn zu schenken.
2.11.2022
Ulrich von Plettenberg, Generalvikar Bistum Trier

Praxis
Evangelische Kirche im Rheinland
Natürlich sind uns in der Rheinischen Kirche die disruptiven Szenarien bekannt. Sie sind vielfältig beforscht und kommuniziert. Das Modell der „Volkskirche“, welches unser kirchliches Selbstverständnis und unsere Strukturen über Jahre geprägt hat, müssen wir verabschieden.
Gleichzeitig ist meiner Einschätzung nach das wesentliche Problem nicht, dass wir weniger Mitglieder und Ressourcen haben werden. Auch damit können wir gut Kirche sein. Unser Problem ist, dass wir den alten Strukturen und Selbstbildern verhaftet bleiben und uns nicht konsequent auf die grundlegend veränderten Voraussetzungen einstellen.
Das Thema „Verkleinerung“ hat sehr unterschiedliche Dimensionen. Etwa personelle Reduktion, aber auch Reduktion von Gebäudebestand. Wie zukunftsorientiert mit der Frage der notwendigen Reduktion kirchlicher Gebäude umgegangen werden kann, wurde im September auf dem Evangelische Kirchbautag in Köln diskutiert. Unter dem Motto „Mut baut Zukunft“ haben sich die Teilnehmenden der Frage gestellt: Wie, trotz schwieriger werdender Rahmenbedingungen, mit Mut, Ausdauer und Kreativität die Gemeinden ihre Baumaßnahmen angehen können und dies schon getan haben. Rückbau ist dabei vielfach die Voraussetzung für die Entstehung von Neuem.
Die Veränderungen unserer kirchlichen Strukturen und deren Konsequenzen werden auf allen Ebenen diskutiert. Wichtig ist mir jedoch, dass wir als Kirche nicht im Modus des Beredens und Diskutierens stehen bleiben, sondern handeln und die Möglichkeiten zur Gestaltung, die uns offenstehen, jetzt nutzen. Die Kirchenleitung hat sich deshalb mit dem Positionspapier EKiR 2030 – Wir gestalten „evangelisch rheinisch“ zukunftsfähig – fünf Handlungsfelder vorgenommen, bei denen sie unmittelbar anpacken möchte: Mitgliederorientierung, Organisation, Junge Generation, Digitalisierung, Vernetzung.
Was wir im Moment brauchen, um Kirche voranzubringen und zukunftsfähig zu gestalten, statt in einem Narrativ des Verfalls zu verharren, sind Hoffnungsgeschichten. Ich möchte von Erfolgserlebnissen und innovativen Projekten erzählen, die andere inspirieren und motivieren. Dafür ist mir die Begegnung mit den Menschen vor Ort, in den Gemeinden, den Werken, Organisationen und Initiativen unserer Landeskirche sehr wichtig.
Entscheidend im Prozess der anstehenden Strukturveränderungen in unserer Landeskirche ist die Befähigung der Gemeinden und Kirchenkreise bei diesen Veränderungen handlungsfähig zu bleiben. Hier brauchen die Gemeinden auch neue Spiel- und Freiräume, die Innovation und Erprobung von Neuem zulassen. Dazu muss von Seiten der Landeskirche auch die kirchliche Gesetzgebung überdacht werden, um den Gemeinden einen Rahmen für höhere Flexibilität zu schaffen – beispielsweise im Umgang mit Kasualien und der veränderten Lebenssituationen unserer Mitglieder.
Ganz neu fokussieren wir als Landeskirche außerdem die Aufgabe Strategischer Innovation im Bereich der Kirchenentwicklung – auch personell. Zur Förderung von Innovation und Exnovation wird dieser Arbeitsbereich Tools und Methoden entwickeln, um Leitungsgremien verschiedener Ebenen zu befähigen, solide Entscheidungen zu treffen.
Wir haben uns als Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland konkrete Ziele mit Blick auf das Jahr 2030 gesetzt. Wir haben zukunftsrelevante Handlungsfelder identifiziert und Projekte aufgesetzt, die konkrete Veränderungen und Umsteuerungen angehen. Seit drei Jahren fördert die rheinische Kirche mit dem Projekt „Erprobungsräume“ das Erproben innovativer ekklesialer Gemeinschaftsformen, in der Hoffnung, dass Menschen so vielfältigere Zugänge zum Glauben eröffnet werden können. Mit dem Projekt Mixed Economy stellen wir uns nun auch der Herausforderung, den neuen Formen des Kirche- und Gemeinde-Seins einen Platz neben traditionellen Formen einzuräumen. So wollen wir den Übergang zu einer Kirche gestalten, die für unterschiedliche Lebensstile und Lebenssituationen vielfältigere Anknüpfungspunkte als bisher eröffnet.
Ohne Zweifel stellen die strukturellen Veränderungen, vor denen wir stehen, unsere Mitarbeitenden in Haupt- und Ehrenamt vor große Herausforderungen. Kleinerwerden strengt an: Presbyterien und Synoden sind fortlaufend mit Reformen beschäftigt. Zudem nehmen Verwaltungsvorgaben eher zu – bei weniger vorhandenen Mitarbeitenden. Strukturen zu verändern und zu schaffen, die unseren Mitarbeitenden langfristig gute Arbeitsbedingungen ermöglichen, ist ein langer und sich ständig wandelnder Prozess.
Hierzu zwei konkrete Beispiele: Die Anstellung von Pfarrpersonen auf Kirchenkreisebene statt bei der Gemeinde ermöglicht den Pfarrpersonen, sich stärker gabenorientiert einzusetzen und erhöht die Vernetzung unter den Kolleg-/innen. Das stärkt dann auch die Attraktivität des Berufs. Auf Seiten des Ehrenamts werden momentan unter dem Arbeitstitel „Ehrenamtsakademie“ die bereits vorhandenen Angebote in der Fort- und Weiterbildung für Ehrenamtliche in der EKiR an einer zentralen Stelle auf einer digitalen Plattform gebündelt. Diese kann von Ehrenamtlichen genutzt werden, um schnell passende Angebote zur Qualifikation und Information zu finden. Dadurch kann die Qualität ehrenamtlichen Engagements steigen und Engagierte werden besser wahrgenommen. Sowohl die Motivation von Ehrenamtlichen wird dadurch gesteigert als auch die Attraktivität der EKiR als Ort, an dem ehrenamtliches Engagement möglich ist.
Wir erleben aktuell eine Zeit, in der das Wort „Krise“ in aller Munde ist. Die Energieversorgung steht in Frage, die Wirtschaft wankt, globale Flüchtlingsströme nehmen zu, in Europa herrscht Krieg und dabei darf vor allem die Klimakatastrophe nicht aus dem Blick geraten. Unabhängig von allen strukturellen und personellen Veränderungen, vor denen unsere Kirche stehen mag, bleibt es ihr Auftrag sich den Menschen in Not anzunehmen, von Gott und von der Hoffnung zu erzählen, sowie entgegen den Trends zur Vereinsamung und Individualisierung in unserer Gesellschafft einen Ort der Gemeinschaft und Geschwisterlichkeit zu bieten.
12.10.2022
Dr. Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland

Praxis
Erzbistum Paderborn
Das Erzbistum Paderborn beschäftigt sich intensiv mit seinem Kirche-Sein sowie seinem Auftrag in der Welt. Leitend ist die Frage: Wozu bist du da, Kirche von Paderborn? Selbstverständlich sind dabei die veränderten Voraussetzungen von zentraler Bedeutung und fest im Blick.
Wichtig ist dem Erzbistum Paderborn im Hinblick auf Ihre Fragen: Es geht nicht allein um Abbrüche und Auflösung, vielmehr um Umbrüche und neue Aufbrüche. Das Kirche-Sein in Deutschland und damit auch im Erzbistum Paderborn verändert sich. Das ändert aber nichts daran, dass die katholische Kirche in Deutschland ihren Auftrag und ihre Verantwortung wahrnimmt und in verschiedenen Handlungsfeldern auch weiterhin ihren gesellschaftlichen Beitrag leistet.
Bei der Beschäftigung mit Gegenwarts- und Zukunftsfragen werden Prognosen berücksichtigt. Treffender aber sind sogenannte „Zukunfts-Szenarien“, mit denen auf die künftigen Entwicklungen geschaut wird. Sie enthalten die verschiedenen Kirchenbilder, die existieren, und die möglichen Strategien, die jeweils auch auf das entsprechende gesellschaftliche Umfeld eingehen. Im Vordergrund steht bei diesem Ansatz die Vorausschau. Weil die Faktoren sehr komplex sind, hat diese Betrachtungsweise einen entscheidenden Vorteil gegenüber der reinen Prognose, die letztlich eindimensional bleibt.
Bereits seit 2004 beschäftigt sich das Erzbistum Paderborn gezielt mit seinem eigenen Veränderungsprozess. In mehreren Schritten vollzieht der diözesane Weg des Erzbistums Paderborn die Veränderungen mit und stellt die Weichen für die künftigen Entwicklungen. Immer wieder wird dabei nach Ehrlichkeit und Attraktivität gefragt. Grundsätzlich verläuft der Diözesane Weg des Erzbistums Paderborn seit 2004 in der Spur von „ehrlich“ und „attraktiv“, das heißt nicht in der Abwärtsspirale der Destruktion, sondern – motiviert aus der Grundhaltung: Gott vertrauen – Glauben leben – Zukunft gestalten – im Sinne der Effectuation immer mit Blick auf das, was wächst.
Neu beauftragt ist im Erzbistum Paderborn das Projekt „Zukunft territorialer Seelsorge“ mit dem Ziel, ein realistisches Bild zu entwickeln für zukünftige Pastoral. Dieses enthält in neuer Klarheit die anstehende zwangsläufige Disruption zwischen territorialem und kategorialem Verständnis von Pastoral.
Die Entwicklung wird systematisch bearbeitet beispielsweise bei den „Herstelle-Tagungen“ der Managementteams/Bistumsleitung (mit Prof. Loffeld, Dr. Hennecke), in der im Erzbischöflichen Generalvikariat verorteten Entwicklungsabteilung, in der ausführlich mit Szenarien und aktuellen Gesellschaftstheorien gearbeitet wurde und wird. Auch das neue Projekt Zukunft territorialer Seelsorge ist hier zu nennen.
Um die Menschen im Erzbistum Paderborn mitzunehmen und zu begleiten arbeiten wir an der Change-Kommunikation wachstumsorientiert und sind inspiriert von der christlichen Hoffnung. Beim Diözesanen Forum, aber auch bei Pastoralwerkstätten und anderen Formaten der Begegnung zwischen Bistumsebene und Ortsebene wird „Klartext“ gesprochen, damit die Botschaft von Veränderung / Wandel / Weggemeinschaft einen ehrlichen Kontext hat.
Beispielsweise durch die Beauftragung der Themen des Diözesanen Wegs in zukunftsfähigen Arbeitsformen, die sukzessive die Zukunftsfragen (Territorialpastoral, Leitung, Engagement, Gottesdienst, Qualität, Feedback, Bewahrung der Schöpfung) weiter entwickeln und bearbeitbar machen, sehen wir Wege des Handelns und Steuerns. Kleinschrittiges Ausprobieren, Fehlerfreundlichkeit, Prototypen, … sind Elemente dieses Weges.
Durch immer neue Formate der Kommunikation und der Verständigung gestalten wir den Übergang. So planen wir im Jahr 2023 ein Diözesanes Forum als Pilgerweg und im Anschluss möchten wir ein Diözesanen Pilgerjahr gestalten unter den Leitmotiven: „in Bewegung kommen/bleiben“, „miteinander neu Wege gehen“.
Wir setzen dabei auf die Potentiale und das Engagement unserer Mitarbeitenden. Dieses wird neu priorisiert, unter anderem durch eine Kompetenzeinheit Potentialförderung, die Personalentwicklung betreibt aus der Sicht von Taufberufung und Potentialentfaltung.
Wir sind überzeugt: Das weckt und erhält Energien und Resilienz!
In unserem klaren Bekenntnis zum Einsatz für die Gesellschaft, in unserem Fokus auf diakonische Schwerpunkte in der Pastoral, dem Ansatz jeglicher Pastoral von den Lebensthemen der Menschen her – das ist im Zukunftsbild für das Erzbistum Paderborn und damit auch im Zielbild 2030+ für das Erzbistum Paderborn festgeschrieben – übernehmen wir Verantwortung für die Gesellschaft und sichern wir die Präsenz der Kirche bei den Menschen.

Praxis
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck
Wir verarbeiten die Disruptionserfahrungen der Corona-Pandemie und nutzen sie als „kairos“ für die Transformation der Kirche, z.B. im Blick auf die Gottesdienstlandschaft, die Digitalisierung, den Umgang mit Gebäuden, die Vernetzung mit der Zivilgesellschaft.
Es gibt eine Steuerungsgruppe für den Reformprozess, in der der Transformationsprozess in einer multiprofessionellen Gruppe reflektiert und begleitet wird. Auch wissenschaftliche Begleitung und Perspektiven von Berater*innen suchen wir regelmäßig. Die Entscheidungsgremien sind regelmäßig in Entwicklung und Umsetzung einbezogen.
Wir haben einen breit angelegten und auf Beteiligung ausgerichteten „Verständigungsprozess zum Auftrag der Kirche“ durchgeführt, in dem wir ein gemeinsames Verständnis vom Auftrag und den Grundaufgaben von Kirche in sich wandelnden Verhältnissen und sich verändernden Ressourcen diskutiert haben. Mehr als 1500 Haupt- und Ehrenamtliche, aber auch Menschen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft wurden in zahlreichen Veranstaltungen beteiligt. Jetzt liegt der Ball in den Gemeinden unsrer Kirche: Auch sie sollen beteiligt werden und diskutieren, wie sie den Auftrag der Kirche umsetzen können und dabei über einen angemessenen Ressourceneinsatz entscheiden.
Die benannten Grundaufgaben und strategische Kriterien (Kontaktflächen bietend, Ausstrahlung fördernd, Kooperation stärkend, nachhaltig, motivierend) dienen als Orientierung bei allen Ressourcenentscheidungen. Durch zwei von uns entwickelte Tools wird der Umgang mit den Kriterien und den Grundaufgaben in kirchlichen Gremien unterstützt und eingeübt.
Bisher versuchen wir diesen Prozess als evolutionäre Transformation zu gestalten, nicht als disruptive Erneuerung.
Durch ein Innovationsbudget eröffnen wir gleichzeitig Spielräume für innovative Formen von Kirchesein, die neue und andere Wege gehen. Wir setzen auf multiprofessionelle Teams und errichten neue Stellen für Diakoninnen und Diakone. Auch der Kontakt und die Verknüpfung mit Diakonie als einer anderen Gestalt von Kirche spielt dabei eine wichtige Rolle.
Durch fünf landeskirchliche Prozesse (Verfassung, Haushalt, Verwaltung, Gebäude, Berufsbilder) arbeiten wir bis 2026 an zukunftsfähigen Strukturen und Strategien im Umgang mit Ressourcen. Kooperationen zwischen Gemeinden, mit der EKHN und der katholischen Kirche sowie auf EKD-Ebene sollen hier Synergien fördern.
Bisher versuchen wir diesen Prozess als evolutionäre Transformation zu gestalten, nicht als disruptive Erneuerung.
Wir haben eine mittelfristige Personalplanung und eine verantwortungsvolle Versorgungsstrategie im Blick auf die Pensionsverpflichtungen. Langfristig wird über die Zahl der Beamtenverhältnisse zu diskutieren sein. Neben diesen finanziellen Perspektiven ist die Beteiligung der Mitarbeitenden an diesen Transformationsprozessen entscheidend, damit sie die Veränderungen nicht nur mittragen, sondern proaktiv und auf Augenhöhe mitgestalten.
Die Orientierung am Auftrag (missionale Kirche sein) fördert die Sozialraumorientierung und verhindert einen Rückzug „hinter Kirchenmauern“. Wir werden weiterhin hör- und sichtbar sein und unsere Stimme in gesellschaftliche Diskurse einbringen, Menschen durchs Leben begleiten, Sorgenetze knüpfen und von unserem Glauben erzählen. So nehmen wir unsere Verantwortung „in“ der Gesellschaft wahr, nicht „für“ sie, das wäre anmaßend.
19. September 2022
Prof. Dr. Beate Hofmann, Bischöfin Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck

Praxis
Bistum Hildesheim
In den vergangenen 10 Jahren haben wir in unzähligen Veranstaltungen den systemischen Wandel unserer Kirchengestalt und der Rollenarchitektur in Gemeinden mit den Hauptberuflichen und in der Bistumsleitung diskutiert. Allerdings geht es offensichtlich nicht – von nicht beeinflussbaren Faktoren abgesehen (Krieg, Finanzkrisen, Arbeitslosigkeit) – um eine disruptive Entwicklung oder einen Zusammenbruch, sondern um einen deutlich länger dauernden und schon seit Jahren sich immer mehr zeigenden schleichenden Prozess. In diesem „Aufbrechen“ neuer Erfahrungen und beim gleichzeitigen Bleiben in gewachsenen Erfahrungen wird immer deutlicher, dass es keinen Masterplan geben kann, weder disruptiv noch als Fortsetzung einer bisher geförderten Kirchengestalt – es geht vielmehr eher darum, einen weiten Rahmen der Unterstützung und Begleitung zu bieten, Möglichkeiten für neue Formen der Leitungsaufgaben zu schaffen und die Ungleichzeitigkeit von Enden und Anfangen zu würdigen und zu begleiten
Das Thema wird zwischen den Verantwortlichen des Bistums (Bischof, GV und Bereichsleiter*innen), im Diözesanpastoralrat, im Priesterrat und Diözesanrat und in den inhaltlich verantwortlichen Abteilungen diskutiert.
Da wir nicht mit einem flächendeckenden disruptiven Zusammenbruch rechnen, sondern mit einem gleichwohl oft schmerzhaften ungleichzeitigen und lokal sehr differenzierten Umbruchsprozess, kommunizieren wir zum einen intensiv die Zukunftsorientierungen des Bistums und eröffnen die Möglichkeit begleiteter Zukunftsprozesse am Ort, um mit den Mitarbeitenden und Engagierten vor Ort intensiv zu diskutieren.
Durch gemeinsame Vergewisserung der inhaltlichen und pastoralen Ziele auf den Leitungsebenen und in den Partizipationsgremien können abgestimmte Schritte und Entscheidungen getroffen werden. Dabei werden durch Entscheidungen Räume und Möglichkeiten für eine lokale Entwicklung ermöglicht, die jeweils vor Ort begleitet werden.
Wir gestalten diesen Übergang seit einigen Jahren, indem wir Raum für differenzierte und begleitete Lösungen vor Ort schaffen und Menschen ermutigen für ihre Initiativen mit Mut voranzugehen
Mit dem Aufbau einer Abteilung für Strategie und Personalentwicklung werden Instrumente der Begleitung, Weiterentwicklung und Weiterbildung geschaffen, die die Mitarbeitenden stützen.
- Durch die Neuausrichtung unserer Akademie und der Bildungseinrichtungen wird das Bistum zur gesellschaftlichen Meinungsbildung aus christlicher Identität beitragen.
- Durch die Fokussierung und Profilierung der katholischen Schulen und der frühkindlichen Bildungseinrichtungen leisten wir auch in Zukunft unseren Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft.
- Durch die Profilierung der caritativen Einrichtungen werden wir unserer Verantwortung für die Menschen zeichenhaft gerecht.
30.10.2022
Generalvikariatsrat Christian Hennecke, Leiter der Hauptabteilung Pastoral im Bischöflichen Generalvikariat Hildesheim

Praxis
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
In der Tat sehen wir, dass die Entwicklungen in Gesellschaft und Kirche radikale Auswirkungen haben. Die deutlich zunehmenden Kirchenaustritte, das Thema des sexuellen Missbrauchs, das die Vertrauenswürdigkeit der Kirche grundlegend infrage stellt, das Auseinanderdriften von individuell gelebter Religiosität oder gelebtem Wertebewusstsein und der Praxis des christlichen Glaubens in der Organisation der Kirche und der Nachwuchsmangel stellen uns vor große Herausforderungen.
In unserem seit 2019 laufenden Kirchenentwicklungsprozess haben die o. g. Themen immer mehr Raum eingenommen. Wir sind mit Veränderungen des Bestehenden gestartet und befinden uns mittlerweile in einem umfassenden Transformationsprozess, der keinen Bereich kirchlichen Handelns außen vorlässt. Dabei gibt es — wie vermutlich in jeder „basisdemokratisch“ aufgestellten Großorganisation — zum jetzigen Zeitpunkt unterschiedliche Einschätzungen dazu, wie radikal die Entwicklung ist und ob ein Übergang gestaltet werden kann oder von einem Zusammenbruch der bisherigen Gestalt gesprochen werden muss.
Die radikalen Entwicklungen werden durch den umfassenden Reformprozess, in dem wir uns befinden, derzeit auf allen Ebenen der Kirche besprochen. Dies ist auch deshalb so, weil wir bereits synodale Beschlüsse zu einem deutlichen Abbau von Gebäuden, zu einer Umstrukturierung von Gemeinden und einer neuen Form des Verkündigungsdienstes gefasst haben oder derzeit herbeiführen möchten. Die sich daraus ergebenden Veränderungen betreffen alle Ebenen der Kirche. Dass wir „nicht weitermachen können wie bisher“ scheint mir dabei ein von vielen geteilter Konsens zu sein.
Ausdruck dieser grundlegenden Veränderung, die bisherige Organisationsformen infrage stellen, ist es, dass die in den o. g. Bereichen beschlossenen strukturellen Veränderungen in deutlich kürzeren Fristen und mit höherer Verbindlichkeit für alle Ebenen erfolgen müssen als dies bei vorherigen Veränderungsprozessen der Fall war. Daraus folgen Veränderungen z.B. in der Bedeutung der Parochie als dem bislang tragenden Prinzip kirchlichen Handelns vor Ort oder dem Selbstverständnis des Pfarrberufes.
Wir haben auch Themen der Nachhaltigkeit und Digitalisierung schon zu Beginn als wichtige Herausforderungen identifiziert; durch die Coronakrise und die Klimakrise überholt uns die Dynamik jedoch und wir müssen diese Themen nun mit größerer Dringlichkeit aufnehmen.
Allerdings ist es auch so, dass die Transformationsprozesse in den Leitungsgremien nicht übereinstimmend als Strategie zum Umgang mit einem Zusammenbruch verstanden werden, so dass wir die radikalen Veränderungen nicht unter dieser „Überschrift“ thematisieren.
Systematisch im Sinne eines bevorstehenden Zusammenbruchs wird das Thema nicht diskutiert. Aus meiner Sicht müsste auch unterschieden werden zwischen einer Disruption, bei der etwas Neues das Alte „aushebelt“ und einem Zusammenbruch, bei dem dann zu fragen wäre, welche Parameter für diese Diagnose angelegt werden. Finanziell wird es wohl zunächst nicht zu einem Zusammenbruch kommen, da die Finanzplanung Maßnahmen vorsehen kann, wenn sich ungeahnte Finanzierungslücken von einem Jahr auf das andere einstellen, weil es weitere Absicherungsmechanismen gibt und entsprechend der wirtschaftlichen Prognosen finanztechnisch vorsichtig geplant wird. Gleichwohl sind die rasch sinkenden Mitgliederzahlen natürlich ein Alarmzeichen. Am ehesten scheint mir aber die rasch abnehmende Anzahl von Pfarrer*innen in den nächsten Jahren durch Ruhestandsversetzungen einer Disruption vergleichbar zu sein. Dieses Thema wird breit diskutiert, auf allen Ebenen der Kirche.
Dies geht aus meiner Sicht nur durch ein konsequentes Angehen der anstehenden Herausforderungen. Dazu gehören die Entwicklung von Szenarien und das Herbeiführen von Entscheidungen zu Einsparungen und organisationalen Veränderungen. Zu letzterem gehört, dass den Kirchengemeinden und Dekanaten Spielräume ermöglicht werden, Kirche vor Ort entsprechend der Situation und den dortigen Erfordernissen zu gestalten. Der Abbau von Genehmigungen, das Eröffnen von Freiräumen und die Ermöglichung regionaler Unterschiede sind aus meiner Sicht Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten zu erhalten. Das bedeutet, dass die Steuerung auf gesamtkirchlicher Ebene im Blick auf das, was vor Ort geschieht oder geschehen soll, verringert wird; gleichzeitig bleibt die Steuerung im Blick auf die Rahmenbedingungen bzw. Ressourcen wichtig. Die „Erlaubnis“, Neues auszuprobieren erscheint mir ebenfalls ein wichtiger Punkt zu sein, um Handlungsfähigkeit vor Ort zu erhalten und dabei nicht nur reaktiv, sondern proaktiv zu agieren.
Die Frage ist ja: Den Übergang wohin? Die oben angegebenen Aspekte der Transformation werden bereits angegangen. Gemeinden und Dekanate werden bei organisationalen Veränderungen begleitet. Aus meiner Sicht ist es auch ein Kennzeichen einer Disruption, dass kein einfacher Fahrplan vorliegt und ein neues Ziel nicht einfach angesteuert werden kann, sondern deutlich werden muss, dass noch nicht klar ist, was wofür eine Lösung sein kann. Aus meiner Sicht ist es eher ein Schritt-für-Schritt-Denken und -Handeln, das dann beim Ausprobieren zeigt, was sinnvoll zu tun und anzustreben sein kann. Personalgewinnung, alternative Modelle der Mitgliedschaft und die Verringerung von Verwaltungstätigkeit durch Aufgabenkritik sind aus meiner Sicht wichtige Themen, um die Organisation angesichts der derzeitigen Umbrüche zu verändern. Gleichzeitig müssen wir aushalten, dass wir — insbesondere in den Leitungsebenen – nicht schon die Antwort haben, sondern die Entwicklung gut beobachten und wahrnehmen, riskieren, loslassen, wie es auf allen Ebenen geschieht. Die Coronakrise war ja eigentlich eine Disruption, bei der wir allerdings auch gemerkt haben, wie schnell und aktiv sich viele auf die neue Situation eingestellt haben. Die Entwicklung digitaler Praxis im kirchlichen Handeln hat die religiöse Kommunikation befördert und viele Möglichkeiten eröffnet (z. B. auch die Möglichkeit digitaler Kongresse :-). Diese Disruption in einem positiven Sinne zu befördern hieße, die neuen Möglichkeiten zuzulassen und bei einer gelingenden Umsetzung so gut es geht zu unterstützen, auf keinen Fall aber an Vorgaben aus Zeiten vor Corona einfach festzuhalten oder abzuwarten „bis die Krise wieder vorbei ist“. Meine Erfahrung in dieser Zeit war/ist auch, dass wir auf allen Ebenen dieselben Prozesse der Verständigung, der Diskussion, des Aushaltens von Unterschieden und der Suche nach gemeinsamen Lösungen durchlaufen. Es gibt nicht die eine Leitungsebene, die weiß, was zu tun ist, und anderen sagen kann, wie es geht. Darum ist das Eingeständnis in die gemeinsam erlebte Suche, der Austausch miteinander und auch mit anderen Akteuren außerhalb der Kirche für mich ein wichtiges Element bei dem Umgang mit einer disruptiven Entwicklung. Dies führt allerdings auch zu einer Verunsicherung, denn die Erwartung an „klare Vorgaben“ und „Lösungen“ waren und sind auch da. Eine Disruption kann für mich dann gut genutzt werden, wenn dabei auch die Eigenständigkeit der Akteure zugelassen und befördert wird.
Gleichzeitig ist meine Erfahrung auch, dass sich damit keinesfalls nur negative Erfahrungen verbinden. Es sind ja ungeahnte Möglichkeiten entstanden, Lernerfahrungen wurden gemacht. Alle standen vor der gleichen neuen Situation, das war einerseits konflikthaft, hat andererseits aber auch ehrliche und offene Diskurse befördert.
Auch in der jetzigen Energiekrise stellen wir fest, dass Kirchengemeinden sehr schnell eigenständig agieren und Maßnahmen ergreifen, um z. B. Heizkosten und Energie zu sparen. Auch hier gilt, die Rahmenbedingungen zu klären und zu kommunizieren und vor Ort möglichst viel an Eigenverantwortung und konkret passenden Lösungen zu ermöglichen.
Ob man bei einer Disruption also einen Übergang gestalten kann oder diese tiefgreifende Veränderung nur begleiten und immer wieder sehen muss, was gerade gebraucht wird, könnte man fragen. Um letzteres zu ermöglichen, braucht es aus meiner Sicht immer wieder eine Vernetzung und das Einholen von Resonanzen über Gelingen oder Misslingen und das daran ausgerichtete Weiterdenken.
Mitarbeitende haben Rechte, durch die sie abgesichert sind. Für Änderungen in Bezug auf die Bedingungen ihrer Arbeit gibt es verabredete Verfahren. Verantwortlich erscheint es mir in diesem Zusammenhang, Überlastungssituationen wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Verantwortlich erscheint mir in diesem Zusammenhang auch, die Veränderungsdynamik offen auszusprechen und Mitarbeitende so zu fördern, dass sie mit Veränderungen umzugehen lernen können. Das gilt aus meiner Sicht ebenso für alle, uns Leitende eingeschlossen. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass Kirche eigentlich eine Institution ist, die auf Tradition ausgerichtet ist. Gleichzeitig ist es Teil der Verantwortung, die unterschiedlichen Wahrnehmungen zuzulassen. Was für die einen an dringenden Veränderungen ansteht, ist für andere ein schlimmer Verlust. Den Austausch so zu befördern, dass das Verständnis füreinander möglich wird und nicht in gegenseitige Abgrenzung führt, gehört für mich zu einem verantwortlichen Umgang mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden dazu.
Im Prinzip gehört zur Wahrnehmung der Verantwortung in der Gesellschaft das Gleiche wie das, was für die Wahrnehmung der Verantwortung in der Kirche gilt: zusammen mit den Akteuren die Entwicklungen wahrnehmen und gemeinsam nach Handlungsstrategien suchen.
Darüber hinaus sind wir als Kirche durch die Gesellschaft gerade sehr kritisch angefragt. Dieser Kritik müssen wir uns stellen und fragen, wie wir Glaubwürdigkeit als Organisation wiedergewinnen. Auch dazu gehören für mich eine offene Wahrnehmung und die Bereitschaft sich zu verändern und infrage stellen zu lassen. Und uns in unserem Handeln dann auch tatsächlich so auszurichten, dass Glaubwürdigkeit entsteht.
Gleichzeitig sind wir als Christinnen und Christen von einem bestimmten Menschenbild und Weltbild geprägt. Fragen der Gerechtigkeit, der vorbehaltlosen Anerkennung eines jeden Menschen und der damit verbundenen Würde sind Grundthemen einer wertebasierten Organisation wie der Kirche, die Christinnen und Christen im Alltag leben und in ihre jeweiligen sozialen Bezüge einbringen.
Macht eine Disruption einer Organisation das Handeln in einer solchen Haltung schwerer oder befördert es nicht auch den Austausch und die gemeinsame Entwicklung? Ihre Frage höre ich auch als Nachfrage, wie bei einem Zusammenbruch noch Handlungsfähigkeit „nach außen“ gewährleistet werden kann. Wenn dies so intendiert ist, dann erscheint mir dies die Basisorientierung von Kirche nicht gut genug berücksichtigt zu haben. In fast allen Landeskirchen ist die Gemeinwesenorientierung ein wichtiger Aspekt der Veränderung. Darin spiegelt sich gerade das Interesse kirchliches Handeln so zu verändern, dass gesellschaftliche Akteure Raum im kirchlichen Handeln gewinnen und Kooperationen im Sozialraum für die Gestalt und das Selbstverständnis kirchlichen Handelns mehr Bedeutung gewinnen. Anders gesagt: eine disruptive Entwicklung kann die Frage der gemeinsamen Verantwortung neu stellen und anders zu bearbeiten ermöglichen als es die bisherige Unterscheidung, Abgrenzung und Eigenständigkeit von Organisationen tun konnte.
30.10.2022
Oberkirchenrätin Dr. Melanie Beiner, Leiterin Dezernat 1 – Kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Praxis
Erzbistum Hamburg
Das Erzbistum Hamburg hat im Jahr 2016 einen Erneuerungsprozess begonnen, in dem ein pastoraler Orientierungsrahmen zur Gestaltung der Zukunft im Erzbistum erarbeitet worden ist. Die Vermögens- und Immobilienreform hat das Ziel, den Einsatz wirtschaftlicher Ressourcen auf das Wesentliche zu konzentrieren und große Teile des Diözesanhaushaltes nachhaltiger zu gestalten. Sie ist somit eine direkte (ökonomische) Konsequenz des Erneuerungsprozesses. Dazu gehört, dass das System auf die in Zukunft verfügbaren Ressourcen angepasst wird. All dies geschieht in Verantwortung für die nächste Generation von Katholik_innen und die Beständigkeit der Glaubensvermittlung.
Ein weiteres Projekt „missionarisch weiter gehen – Personalstrategie 2030“ versucht, Reaktionen auf eine disruptive Entwicklung unserer Personalstruktur zu antizipieren. Denn die Personaldecke wird sich mit der Verrentung der geburtenstarken Jahrgänge massiv verkleinern. Parallel dazu gibt es kaum Studierende für die Berufsgruppen und die Anzahl der Katholik_innen nimmt ab. Bis Mitte der 2020er Jahre wird mit neuen Stellenformaten experimentiert, aus deren Evaluation heraus neue Ansätze für den Personaleinsatz in der Pastoral strategisch grundgelegt werden können. Unser Motto ist ein biblisches: „Prüft alles und behaltet das Gute“ (1 Thess 5,21). Dieser Rat des Apostels Paulus gilt natürlich nicht nur für dieses Projekt, sondern auch grundsätzlich für unsere Diözese. Das heißt, dass für uns im Erzbistum Hamburg schon jetzt die Freude am Neuen („Prüft alles“) und die kluge Unterscheidung („…und behaltet das Gute“) besonders wichtig sind. Gerade deshalb haben wir in unserem Pastoralen Orientierungsrahmen für uns als Diözese formuliert, dass wir unter anderem ein aufbrechendes Erzbistum Hamburg sein wollen (so heißt es in unserem Pastoralen Orientierungsrahmen).
Also: Ja, das Erzbistum Hamburg beschäftigt sich intensiv mit einem Gestaltwandel der kirchlichen Sozialformen.
Wir haben eine Pastoralkonferenz (PaKo) im März diesen Jahres eingerichtet, die agil versucht, strategische Themen des Gestaltwandels zu bearbeiten. Diese Konferenz versucht, strategische Themen zu erfassen, zu analysieren und in Prozesse ausgehend vom Generalvikariat zu übersetzen. Daneben befassen sich im Grunde genommen fast alle Gremien unseres Bistums in unterschiedlichen Facetten mit der Zukunft unseres kirchlichen Lebens und Handelns. Zum Beispiel im Wirtschaftsrat und Diözesanpastoralrat sind diese regelmäßig Thema; ich gehe aber auch davon aus, dass zum Beispiel unsere Berufsgruppen sich intensiv mit Zukunftsfragen auseinandersetzen.
Aktuell arbeiten wir daran, Innovation systematisch in unserer Diözese zu verorten, indem wir einen Innovationsfonds eingerichtet haben und jetzt zur Umsetzung bringen. Konkret bedeutet das, dass alle Katholikinnen und Katholiken im Erzbistum Hamburg die Möglichkeit haben werden, Mittel und Zuschüsse für innovative pastorale Projekte aus diesem Fonds zu beantragen. Dabei ist auch im Blick, dass dies nicht zuerst und zuletzt dem kirchlichen Selbsterhalt dient, sondern unserem Beitrag als Christinnen und Christen in der Gesellschaft. Für mich ist die damit eröffnete Diskussion ein Ort, an dem wir das Thema „Gestaltwandel des Kirchlichen“ ganz praktisch sowie systematisch bearbeiten.
Auf der einen Seite versuchen wir, uns verstärkt auf die Kommunikation mit den Kirchenmitgliedern zu konzentrieren. Aufgabe und Ziel unserer Mitgliederkommunikation im Erzbistum Hamburg ist es deshalb, in Zeiten des Wandels in Beziehung mit allen Kirchenmitgliedern zu treten und zu bleiben. Dies tun wir, indem wir Transparenz herstellen, Kirche für alle erfahrbar machen und die Relevanz von Kirche auch in der heutigen Gesellschaft darstellen. Unser Mottosatz heißt: „Kirche in Beziehung“.
Kommunikativ agieren wir mit einem Mix, indem wir weiter die treuen Kirchbesucher ansprechen, aber auch unsere Reichweite in den Medien nutzen, um positive Narrative von der Reich-Gottes-Botschaft zu entwickeln (Social Media, Internet, Sendezeiten im öffentlich-rechtlichen und im privaten Rundfunk). Zukünftig wird es darauf ankommen, dass auch die digitalen Möglichkeiten (digitale Plattformlösung) professionell und kontinuierlich genutzt werden – zum Beispiel haben wir jüngst eine digitale Lernplattform entwickelt unter dem Titel s@lt: „spirit @ learning & teaching“.
Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch im Hinblick auf unsere Mitarbeitenden „Kirche in Beziehung“ sein und bleiben. Das tun wir, indem wir versuchen, über große strategische Prozesse transparent zu kommunizieren und diese partizipativ anzulegen. So haben wir beispielsweise die Entwicklung einer Personalstrategie 2030 so angelegt, dass sie mit einer Ideensammlung unter Mitarbeitenden und ihrer fortwährenden Beteiligung funktioniert.
Ich selbst spreche weniger von „Disruption“, sondern eher von „Transformation“ und „Gestaltwandel“ der Kirche. Denn diese Begriffe weisen darauf hin, dass sich im „Wandel“ Chancen verbergen. Der Wandel hilft uns und unserem Handeln wesentlicher zu werden: Die Botschaft vom Reich Gottes bleibt, auch wenn unsere Gestalt sich ändert.
Wie eingangs bereits erwähnt sind wir gerade in mehreren größeren Prozessen. Mit der Vermögens- und Immobilienreform sowie der „Personalstrategie 2030 – missionarisch weiter gehen“ werden jetzt schon Steuerungsmöglichkeiten für die Zukunft antizipiert.
Aber es gilt auch, sich an dieser Stelle ehrlich zu machen: Wir haben keine große Glaskugel und wissen nicht, wie die Gestalt der Kirche in 20 oder 25 Jahren aussehen wird. Die eigentliche Herausforderung besteht doch darin, mit dieser Ungewissheit vertrauensvoll umzugehen. Unser Glaube ist die wichtigste Ressource dafür.
In der Diözese ist ein Prozess der Errichtung von 28 Pfarreien im Januar 2022 abgeschlossen. Das Leben in diesen neu errichteten Pfarreien, die in Vernetzung mit „Orten kirchlichen Lebens“ und ausgerichtet auf das soziale Umfeld auch als sogenannte „Pastorale Räume“ bezeichnet werden, muss sich zum Teil noch einspielen.
Seit August 2022 wird an einer Evaluation der pfarreilichen Gremien gearbeitet, um eine veränderte Struktur für eine in Form gebrachte systematische Kommunikation der Akteure auf der lokalen Ebene neu zu gestalten. Das Design setzt auf Beteiligung von und Beziehung mit den Akteuren vor Ort. Wir suchen nach möglichen neuen Lösungen, die wiederum einer Konsultationsschleife unterzogen werden, bevor sie durch die diözesanen Räte beraten und zur Entscheidung empfohlen werden. Die Beteiligung der betroffenen Akteure, die gemeinsame Suche und Beschreibung von vielfältigen Lösungswegen, sowie eine Würdigung des Gelungenen wie auch das nüchterne Sehen des Misslungenen sind wichtige Aspekte in der Gestaltung des Übergangs. Ebenso werden neue Dinge projektweise ausprobiert und damit Erfahrungen gesammelt. Über Erkundungen (Reisen in die Weltkirche und in andere Kirchen) werden Ideen mitgebracht, an die Gegebenheiten vor Ort angepasst und umgesetzt.
Wir versuchen, mit kleinen Beispielen für Gelungenes in einer neuen Gestalt das Neue attraktiv zu machen. Wichtig dafür ist es, das Bisherige zu würdigen und zugleich das Neue willkommen zu heißen. Beispielsweise haben wir gerade zwei „Gründer_innen“-Stellen ausgeschrieben, die nach den Prinzipien der Fresh-X-Bewegung versuchen, auf der lokalen Ebene Neues auszuprobieren.
Der absehbare Rückgang hauptamtlichen Personals verlangt außerdem auch nach Lösungen in Bezug auf Leitungsstrukturen. Aktuell wird in zwei Modell-Pfarreien eine neue Leitungsarchitektur ausprobiert. Es geht darum, Leitungsverantwortung zu teilen und Laien flexibel in die Leitung der Pfarrei mit hineinzunehmen und so von vorneherein mehr Perspektiven als Grundlage von Wirklichkeitswahrnehmung und Entscheidung zu setzen.
Als Mitglied unserer Bistumsleitung möchte ich Veränderung als Chance für Neugestaltung begreifen und so gemeinsam mit anderen Mitarbeitenden ein positives Mindset fördern. Dazu gehört auch in der Personalentwicklung das Qualifizieren von Führungskräften, damit sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind als die, die Orientierung geben, Veränderungskultur positiv prägen und Neues ermöglichen. Mitarbeitende müssen dabei in der Veränderung entsprechend mitgenommen und konkrete Veränderungsbedarfe erfragt werden. Es bedarf zudem einer adäquaten internen Kommunikation wie auch regelmäßiger Updates zur Situation und Projekten, die der sich verändernden Situation Rechnung tragen. Besonders positive Aufbrüche müssen als Beispiele aktiv kommuniziert werden, sodass neue Ideen entwickelt und mutig eingebracht werden. Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden und Entwicklungsperspektiven tragen dazu bei. Die gemeinsame Suche nach Antworten als eigenen Anspruch zu definieren, entfaltet Dynamik und macht den gemeinsamen Weg einfacher.
Mir ist eine Kultur der Ermöglichung wichtig. Das heißt, dass wir das, was wir haben, zur Verfügung stellen wollen. Und das heißt auch, zu entdecken, wie wir mit einem Blick über den Tellerrand hin zu den Glaubensgeschwistern in der Welt lernen können, wo und wie wir als Katholik_innen in unserer Diözese hilfreich sein können. Unser Erzbistum besteht zu einem Drittel aus Katholikinnen und Katholiken anderer Muttersprachen als deutsch. Unser Bistum lebt eine Vielfalt, die auch unserer Gesellschaft guttut.
Ein Beispiel für gesellschaftliche Verantwortung, die in diesem Sinne im Erzbistum Hamburg übernommen wird, ist die Aktion „WE CARE FOR U!KRAINE“. Dabei handelt es sich um eine Hilfsaktion, im Zuge derer Pakete für die vom Krieg betroffenen Regionen in der Ukraine gepackt und verschickt werden. Einerseits hilft es den Menschen vor Ort, andererseits hilft es aber auch tatsächlich uns selbst, wenn wir miteinander über das Tun ins Gespräch kommen, auch über eigene Ängste und Sorgen.
Noch immer hat die Kirche viele Ressourcen, die sie einbringen kann in die Situationen der Zeit. Beispielsweise werden aktuell kirchliche Räume werktags zu Wärmestuben, wenn Menschen nicht mehr in der Lage sind, ihre eigenen Wohnungen zu heizen. Sie können Ausgabestellen für Lebensmittel sein, sie können Orte der Begegnung werden.
Vielleicht ist ein weiterer Punkt wichtig zu benennen: Die Kirche übernimmt durch die Personen, die sich in ihr engagieren, häufig ein demokratiestabilisierendes Engagement in der Gesellschaft, das wir viel zu oft übersehen. Heute gehören Menschen zur Kirche, die in allen Teilen der Gesellschaft ein demokratisches Miteinander kennen und aktiv gutheißen. Eine große Stärke unseres kirchlichen Lebens sollte es doch zumindest sein, dass sich alle gleichermaßen mit den eigenen Ideen und Gaben einbringen können. Das ist unser großes Potenzial.
Hamburg, 10.10.2022
P. Sascha-Philipp Geißler SAC, Generalvikar Erzbistum Hamburg
in Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden im Erzbischöflichen Generalvikariat Hamburg
