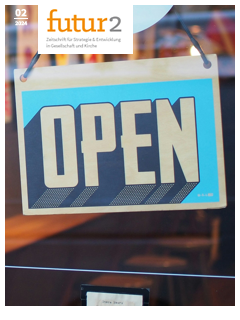Wenn es anders kommt als gewünscht. Kirche in der Schwebe
„Wer täglich in den Spiegel schaut, merkt nicht, dass er dicker wird.“ Das war Axel Noacks Kommentar, nachdem ich im Januar 2003 beim Kamingespräch in Magdeburg zu Gast war und nach meinem Vortrag mit ihm über aktuelle Entwicklungen und Statistiken zum kirchlichen Leben sprach.1
Noacks Bonmot illustriert in treffender Weise eine Grundhaltung, die seit der Jahrtausendwende in den ostdeutschen Kirchen weit verbreitet war und seit der Freiburger Studie auch in den Kirchen der alten Bundesrepublik die Diskussion prägt. Gegenwärtig wird sie gesamtdeutsch auf eine harte Probe gestellt und gerät (zu Recht) ins Wanken.
Die Gründe dafür sind allseits bekannt und brauchen hier nicht im Detail erläutert zu werden. Die Parameter, mit denen über eine lange Zeit hinweg kirchliches Leben gemessen wurde, zeichnen fast durchweg ein beunruhigendes Bild. Man kann sich aussuchen, ob man lieber der EKD-Statistik folgt und von ca. 14 Prozent der Bevölkerung Sachsen-Anhalts ausgeht, die Mitglied einer der beiden großen Kirchen sind2 oder dem Statistischen Landesamt vertraut, das auf der Grundlage des Zensus von knapp 11 Prozent spricht.3
Es geht um Veränderungen, nicht passend zu dem , wie es einmal war, und nicht so richtig passend zu dem, wie es ist.
Im Ergebnis läuft beides auf Dasselbe hinaus. Es ist ernüchternd: Vor allem dann, wenn man die Zahlen in einen längeren Zeithorizont stellt. Vor 35 Jahren, also zum Ende der DDR bildeten evangelische und katholische Christen ungefähr ein Drittel der Bevölkerung.4 35 Jahre zuvor, in der DDR, waren es noch zwei Drittel gewesen.5 Wir wissen das. Die Zahlen liegen alle auf dem Tisch, aber wir interpretieren sie – ich sage es jetzt einmal bewusst offen – höchst unterschiedlich. Um Noacks Bild noch einmal zu bemühen: Der sich Betrachtende schaut zwar immer noch mit den Augen des Wohlgefallens auf sein Spiegelbild und kann bestimmte Entwicklungen nicht ungeschminkt wahrnehmen, weil er im Vertrauten das Veränderte nicht erkennt, allerdings lässt sich ein Unwohlsein nicht länger verdrängen. Eine gewisse Kurzatmigkeit beim Treppensteigen zum Beispiel, das früher leichter ging, oder die Erfahrung, dass der Lieblingspullover beim Waschen irgendwie eingegangen zu sein scheint. Zumindest passt er nicht mehr so recht.
Sie merken, langsam kommt das Bild an seine Grenzen, geht es bei den Kirchen doch nicht ums Mehr-, sondern ums Weniger-Werden. Allerdings ist die damit verbundene Scham dieselbe. Es geht um Veränderungen, die irgendwie nicht passförmig zu sein scheinen. Nicht passend zu dem, wie es einmal war und nicht so richtig passend zu dem, wie es ist.
Innerhalb dieses Horizontes möchte ich drei Punkte mit Ihnen bedenken. Zunächst will ich der Erfahrung des „Nicht mehr so wie früher“ nachgehen, die uns fast unweigerlich bestimmt, wenn wir kirchliche Entwicklungen in den Blick nehmen. In einem zweiten Schritt werde ich sie in einen größeren Horizont einordnen, indem ich den Blick weite, über die kirchlichen Herausforderungen hinausblicke und dem Leben in Zeiten des Ungewissen nachspüre. Abschließend frage ich unter dem Stichwort einer Kirche in der Schwebe danach, was sich aus alledem für kirchliches Handeln heute ergeben könnte. Dabei konzentriere ich mich auf die Herausforderungen in Mitteldeutschland, ohne damit die hier vorgetragenen Gedanken in diesem Kontext einsperren zu wollen (und zu können).
1. Nicht mehr so wie früher: Die Spannung zwischen dem notwendigen Re-Framing und den vorhandenen Materialitäten wahr- und ernstnehmen
In der Regel sind es nicht die Fakten an sich, die Auswirkungen auf unser Handeln haben. Vielmehr ist der Rahmen entscheidend, in den die Ereignisse eingebettet und in dem sie interpretiert werden. Sozialwissenschaftlich wird hier vom Framing gesprochen, das unterschiedliche Interpretationen ein- und desselben beeinflusst und ermöglicht. Ein gängiges Framing ist das von mir eingangs illustrierte Interpretament des „Nicht-mehr-so-wie-früher“. Junge Menschen beispielsweise werden nach wie vor konfirmiert, aber eben deutlich weniger als früher, wobei das „Früher“ sich auf einen Zeitpunkt bezieht, an dem es irgendwie besser war als jetzt.
In gewisser Weise ist das ein probates Mittel mit langer Tradition. Kaum ist das Christentum in der Welt, fängt man an, die jeweiligen Ausprägungen mit dem zu vergleichen, was vorher war. Einerseits ist da die Auseinandersetzung mit dem vermeintlichen Urzustand. Als gut gilt dabei dasjenige, was irgendwie näher dran zu sein scheint an der Verkündigung des Jesus von Nazareth. Je näher, desto besser. Das haben vor allem die reformatorischen Kirchen verinnerlicht. Dabei versuchen sie die Frage nach dem Maßstab der Veränderung (allein) mit der Bibel zu klären. Hinsichtlich des Modus gibt es große Sympathien für den großen Ruck, so wie es eben vor 500 Jahren schon einmal war. Allerdings kann man das ecclesia semper reformanda auch anders angehen. Ich denke hier an die römisch-katholische Kirche, die neben der Schrift auch die Tradition berücksichtigt, also das, was sich im Laufe der Zeit in der Auseinandersetzung mit dem Evangelium herausgebildet hat. Evangelizität ist auch hier zentral, wird aber eben etwas anders bestimmt. Jede Kirche setzt hier also ihre eigenen Schwerpunkte, und man tut gut daran, die Dinge nicht vorschnell gegeneinander auszuspielen. Sie liegen deutlich näher beieinander, als es im ersten Zugriff scheint.
Es reicht nicht, die Entwicklungen interpretativ neu zu framen, wenn nicht auch die Materialitäten, d. h. die Gestaltgebungen von Kirche, einer neuen Rahmung unterzogen werden.
Im Bereich der evangelischen Kirchen scheint mir die Erinnerung an die Materialität der Dinge von grundlegender Bedeutung zu sein. In Auseinandersetzung mit den Kulturwissenschaften (Stichwort „material turn“ bzw. „Akteur-Netzwerk-Theorie“) hat Thomas Klie eindrücklich darauf hingewiesen, dass Artefakte, Dinge bzw. Objekte „weder einfach nur gegeben sind“, „noch … dem Menschen neutral gegenüber“ stehen. „Sie sind mehr als nur Gegenstände zum beliebigen Gebrauch.“6 Vielmehr teilen uns „die Dinge mit, was mit ihnen zu machen ist. Sie fordern gewissermaßen zum Gebrauch auf und leiten darüber die Alltagspraxis in bestimmter Weise an.“7 Kirchen, Kanzeln und Abendmahlsgeräte sind mehr als bloße Formen, die im Vollzug gefüllt werden. Vielmehr geben sie selbst mit vor, wie sie gefüllt werden wollen. Einzuschließen sind hier ausdrücklich auch die Strukturen, in denen Kirche agiert.
Wir haben es hier mit einer wechselseitigen Verschränkung zu tun: die Prägung der Dinge durch Menschen sowie das Geprägtwerden der Menschen durch die Dinge. Das ist immer im Zusammenhang zu sehen. „Wir werden die Sofas, auf denen wir sitzen, und die Sofas werden wir“8.
Wer sich das vor Augen führt, schaut in neuer Weise auf die Gestalt von Kirche. Die vorfindlichen Strukturen sind mehr als nur aktuelle Organisationseinheiten, die bei Bedarf anders gefüllt bzw. gebraucht werden können. Vielmehr haben sie eine eigene Agenda. Sie sind auf „jahrhundertelange Stabilität“ angelegt und „verfolgen letztlich den Zweck, dass sich bloß nicht viel ändert.“9 Dass groß angelegte Kirchenentwicklungsprogramme bisher keinen Erfolg zeitigten, hängt genau damit zusammen. Es reicht nicht, die Entwicklungen interpretativ neu zu framen, wenn nicht auch die Materialitäten, d. h. die Gestaltgebungen von Kirche, einer neuen Rahmung unterzogen werden. Dass es vom „Rückbau zum Umbau“10 kommen muss, ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den Landesbischöfin Junkermann zu Recht angemahnt hat. Allerdings ist die interpretative Rahmung eben nur die eine Seite der Medaille. Für ein wirksames Re-Framing braucht es mehr. Dazu müssen auch die entsprechenden Materialitäten einbezogen werden.
Auch die ostdeutschen Landeskirchen agieren im Modus der Staatsanalogie. Sie verbeamten Pfarrerinnen und Pfarrer und erlassen Kirchengesetze, die sie dann in ein weit verzweigtes Netz unterschiedlicher Zuständigkeiten geben und an die sich alle zu halten haben. Dabei sprechen die Strukturen nicht selten eine andere Sprache als das, was verbal zum Ausdruck gebracht wird. Dass gegenwärtig im kirchlichen Raum in sehr verstärkter Weise Existenzängste aufkommen, hängt zum großen Teil auch damit zusammen. Die Sicherheit, die man sich von den vorfindlichen Strukturen erhofft hatte und die sie ja tatsächlich über lange Zeit in guter Weise geboten haben, verflüchtigt sich in dem Maße, in dem deutlich wird, dass sie genau das nicht zu leisten vermögen, was gegenwärtig besonders Not tut, und das ist, Veränderbarkeit zu denken, zu ermöglichen und zu unterstützen. Denn genau darauf kommt es jetzt an.
Lange Zeit gab es für die ostdeutschen Kirchen an dieser Stelle eine Art Rückversicherung. Sie war einerseits ideeller Natur, wusste man sich doch in der christlichen Grundorientierung der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland getragen. Damit waren nicht zuletzt auch die institutionellen Absicherungen begründbar, mit denen die Kirchen in den 1990er Jahren ausgestattet wurden. Vor allem aber war und ist diese Absicherung finanzieller Natur. Der EKD-Finanzausgleich im Verbund mit den Staatsleistungen sichert den Kirchen ihre Existenz zu, auch wenn die eigenen Mitglieder sie im Rahmen der Kirchensteuer nicht in vollem Maße zu finanzieren vermögen. Beide Dimensionen der Rückversicherung geraten momentan mächtig unter Druck. Was jetzt ansteht, ist von neuer Qualität. Einzelne Aspekte sind in Erinnerung an die vier Jahrzehnte der Kirche im Sozialismus durchaus vertraut. Aber in der Grundrichtung ergibt sich doch eine neue, so nicht gekannte Herausforderung. Darauf will ich im zweiten Schritt zu sprechen kommen.
2. Leben in Zeiten des Ungewissen: Schwebe-Lernen (auch) als kirchliche Aufgabe begreifen
Im vergangenen Jahr hat der katholische Dogmatiker Ottmar Fuchs unter dem Titel „Momente einer Mystik der Schwebe“ ein anregendes Buch vorgelegt, in dem er dem Leben in Zeiten des Ungewissen auf die Spur zu kommen versucht. Darin erinnert er an Giordano Bruno, der im Februar 1600 in Rom auf dem Scheiterhaufen starb. Seine Erkenntnis, dass „der unendliche Raum des Universums überhaupt kein festes Bezugssystem mehr hat“11, dass „es keine Halterung des Universums gibt“, das „ganze Weltall schwebt“ und der Mensch darin „in seinen/ihren Begrenzungen und Halterungen“12 zu überleben hat, bildet für Fuchs den zentralen Fluchtpunkt, der auch theologisch auf- und ernst zu nehmen ist. Luther und Melanchthon gehörten übrigens zu den „frühsten Gegnern des astronomischen Reformers Kopernikus“13. Nach Blumenberg blieb es ihnen verborgen, „dass Kopernikus die sinnfälligste Demonstration gegen den mittelalterlichen Anspruch auf Kongruenz des Sichtbaren und des Unsichtbaren, der Naturordnung und der Heilsordnung angeboten hatte.“14
Wer schweben will, braucht Schwebekompetenz.
Genau hier setzt nun Fuchs an, weil es tatsächlich „einen elementaren Unterschied“ macht, „ob die Unendlichkeit des Universums ‚aufgehängt‘ an einen Fixpunkt ist, oder ob diese Unendlichkeit selbst unendlich schwebt.“15 In einem solchen „Schwebezustand der Welten gibt es keinen Fixstern mehr, weder den religiöser Offenbarungen noch den angeblich argumentativ schlüssiger Verstehensweisen: ‚kein einzelnes Faktum, keine Welt, keine Person, kein Heilsereignis durfte nach Brunos großer Prämisse für sich in Anspruch nehmen, die Macht und den Willen, die Fülle und die Selbstverschwendung der Gottheit darzustellen, zu enthalten und zu erschöpfen.‘“16 Zugleich ging er von einer „divers-kommunikativen Einheit der Gegensätze aus, die weder das Gegensätzliche aufhebt noch ihre Zusammengehörigkeit suspendiert.“17
Argumentationen führen nicht automatisch zu einem schlüssigen Ergebnis. „Am Wahrheitsdiskurs ist … nicht nur die Vernunft beteiligt, sondern alle möglichen Reaktionsweisen des Menschen auf Erfahrungen und Erlebnisse.“18 In diesem Universum schweben auch Dogmen „wie Fixsterne, die keine mehr sind. Und auch die Vernunft gibt es nicht als Einheitskompetenz der Menschheit, sondern es gibt sie interkulturell, plural, und man müsste dies in der Sprache entsprechend verändern, indem man ihren Plural hoffähig macht: Vernünfte! Positionen schweben, auch wenn sie für sich haltgebend sind. In einem weiteren System oder Zusammenhang erweisen sie sich untereinander als Pluralität und beweglich. Mit dieser Beweglichkeit zu ‚rechnen‘, ist die Bedingung gleichstufiger Begegnung. Menschen und Kulturen leben also von vornherein in einer Vernetzungsschwebe, die als solche dann doch einen gewissen Halt gibt.“19
Schwebelernen lernt man durch Schwebelernen.
Fuchs macht für diese Konstellation das Bild der Schwebe stark. Die darin angemessene Existenzweise ist die des Schwebens. Die Kirchen bilden hier keine Ausnahme. Wenn man es auf eine Kurzformel bringen wollte, könnte man von Kirche in der Schwebe sprechen. Damit wäre einerseits die gegenwärtige Situation des Umbruchs aufgenommen, mit all den damit verbundenen Unsicherheiten, den schwindenden Gewissheiten, den Erfahrungen des in die Tiefe Hineingewirbelt-Werdens und der dabei heraufziehenden Ohnmacht. Andererseits eröffnet dieses Bild auch einen Blick nach vorn mit der Verheißung eines neuen „Möglichkeitssinns“20 in all dem vermeintlich Gesetzten, mit der Entdeckerfreude für Räume schöpferischer Lebendigkeit oder der Erfahrung von Kraft, die sich einstellt, wenn man sich den Kräften hingibt.21 Wer schweben will, braucht Schwebekompetenz. Um sie zu erlangen, gilt einerseits das, was für alles andere auch gilt, das zu lernen ist. Schwebelernen lernt man durch Schwebelernen. Auf dem Weg dort allerdings kann es hilfreich sein, sich einzelner Aspekte zu vergewissern. Auf drei von ihnen möchte ich abschließend verweisen.
3. Handeln in der Schwebe: Lernaufgaben für Kirche heute
Wenn ich im Folgenden von Lernaufgaben spreche, dann adressiere ich die „Fähigkeit eines lebenden Systems zur dauerhaften Zustandsveränderung“22, nutze also einen allgemeinen Lernbegriff und knüpfe in gewisser Weise auch an Erkenntnisse der DDR-Kirchen an, die von der 2. Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen auf ihrer zweiten Tagung in Potsdam-Hermannswerder vor genau 50 Jahren formuliert wurden: Kirche ist als „Lerngemeinschaft“ zu verstehen.23 Das ist vor allem dann unverzichtbar, wenn die Erfahrung gemacht wird, dass sich die aktuellen Herausforderungen nicht mehr in angemessener Weise mit dem vorhandenen Instrumentarien bewältigen lassen und die alten Antworten nicht mehr per se tragen.
3.1 AufHÖREN lernen
Die Kirchen sind mit ihren gegenwärtigen Problemen nicht allein. Sie partizipieren vielmehr an einem übergreifenden Problem, das Andreas Reckwitz als „Grundproblem der Moderne“ bezeichnet. Er meint damit die vielfältige und vielaspektige Erfahrung des Verlusts, die letztlich darauf beruht, dass „die Zukunft keine Verheißung mehr ist“24. Die Decke der Fortschrittserwartungen, die alle Entwicklungen lange Zeit umhüllt hat, ist weggezogen. Nun kommen lediglich die blanken Verluste zum Vorschein, ohne eine Erzählung, die sie einzuhegen und zu verarbeiten helfen.
Übertragen auf das Feld der Kirche ließe sich sagen: Nicht die sinkenden Mitgliederzahlen und schwindenden Kirchensteuereinnahmen sind das Problem, sondern der fehlende Glaube, dass sie durch anderes, Besseres ersetzt werden.25 So breitet sich das „Nicht-mehr-so-wie-früher“ in seiner negativen Lesart ungebremst aus. Was es zu lernen gilt, ist „Verlustkompetenz“ (Reckwitz). Einen wesentlichen Teil dafür bildet die Fähigkeit zum Aufhören.26
Nicht die sinkenden Mitgliederzahlen und schwindenden Kirchensteuereinnahmen sind das Problem, sondern der fehlende Glaube, dass sie durch anderes, Besseres ersetzt werden.
Auf-hören ist ein sehr aktives Geschehen, nichts, wozu man resigniert geführt wird. Aufhören bedeutet zunächst einmal, innegehalten, hingehört zu haben, die Zeichen der Zeit zu verstehen und – im Falle der Kirchen – sie in den Horizont christlicher Überlieferung zu stellen. Fromm formuliert könnte man sagen: Wir hören auf das, was Gott uns in dem mitteilt, was nicht so wie früher funktioniert, was wir nicht einfach so weiterführen können wie bisher, und wir tun das im Licht seiner Immanuel-Verheißung. Wir lassen uns die Augen öffnen für das, was nicht mehr sein muss. Das können nur Leute, die keine Angst haben. Und mit Blick auf das vorhin Gesagte ist hinzuzufügen: Das können nur Leute, die nicht einfach das alte Gelingensnarrativ durch ein neues ersetzen, sondern die die Fähigkeit entwickelt haben, etwas offen zu lassen, die also der Versuchung widerstehen, vorschnell alte durch neue Festschreibungen zu ersetzen.
Dem Arbeiterpriester und Begründer der Straßenexerzitien Christian Herwartz SJ „wird die Einsicht zugeschrieben: ‚Wer sich nicht verändern will, kann nicht begegnen!‘ Begegnung geschieht erst, wenn die Teilnehmenden offen sind für ein Ereignis und einen Ausgang einer Begegnung, in denen sie sich verändern dürfen. … Dabei kann es oft zum Schweigen kommen, wo die Teilnehmenden einfach nicht (sofort) weiterwissen, wo die Konserven nicht mehr ausreichen, wo man nach neuer Sprache sucht und neue Horizonte sucht.“27
Begegnung geschieht erst, wenn die Teilnehmenden offen sind für ein Ereignis und einen Ausgang einer Begegnung, in denen sie sich verändern dürfen.
Was das für kirchliches Handeln heißen könnte, lässt sich beispielsweise bei Dorothee Steiof sehen, die in der sog. Präsenzpastoral arbeitet, sich also im öffentlichen Raum zeigt, einfach da ist und sich „anbietet“, wie sie selbst sagt. „Ich gehe in die Begegnung, ohne zu wissen, was ich jeweils für den anderen sein kann. Durch mein Da-sein fungiere ich sozusagen als eine ‚wandelnde Leerstelle‘ quer zum System der Akteur*innen im Sozialraum.“28 Eine solche Perspektive bedarf einer sie eröffnenden Grundhaltung. Auf sie möchte ich jetzt kurz zu sprechen kommen.
3.2 Hoffen lernen
Hoffnung hat gegenwärtig Hochkonjunktur, was angesichts der Polykrise, in der wir uns befinden, nicht verwundert. Interessanterweise sind es vor allem die nichttheologischen Wissenschaften, die sich dazu äußern und die auch gehört werden. Und sie sind in vielen hoch theologisch in ihren Ausführungen, vielleicht könnte man sogar von einer Säkular-Theologie sprechen, die sich hier äußert.
Hoffnung ist „ein Weltverhältnis“29 und darf nicht mit Optimismus verwechselt werden. Sie ist „das Gegenteil von Optimismus“30. Dieser resultiert oft „aus mangelnder Ehrlichkeit und fehlendem Mut – er ist eine Form der Verleugnung, die den Ernst der Lage verschleiert oder glauben macht, man habe die Lösung für alle Probleme“31. Solcherart Zweckoptimismus ist auch in den Kirchen anzutreffen, nicht selten gekleidet in formelhafte Äußerungen, wie derjenigen, dass Gott selbst der Herr der Kirche sei, sie erhalte und wir uns deshalb keine Sorgen zu machen brauchen. Was dabei zu kurz kommt, sind die Wahrnehmung von Verzweiflung und die „Erfahrung eines kompletten Horizontverlusts“32. Sie wird vielmehr mit solchen Äußerungen zu vermeiden gesucht. Hoffnung jedoch hat sich aber genau darin zu bewähren. Sie „setzt die Auseinandersetzung mit Leid und Verzweiflung voraus.“33 Dass sie dann als positiv angesehen wird, ist alles andere als ausgemacht. Kritiker behaupten, dass sie geradezu schädlich ist, hält sie doch von den notwendigen Veränderungen ab. Andere wiederum verweisen auf ihre motivierende Kraft. Hoffen und Handeln erscheinen dann als zwei Seiten ein und derselben Medaille.
Hoffnung haben, Hoffnung geben und Hoffnung finden hängen aufs Engste miteinander zusammen.
Das könnte die Stunde der Kirchen sein, aber „zum Fokus auf das menschliche Tun und seine Folgen passt die aufs Jenseits gerichtete Hoffnung des Christentums nicht mehr recht.“34 Insofern kann es nicht plakativ darum gehen, die Kirchen als Lernorte der Hoffnung zu bezeichnen. Wer der Kraft der Hoffnung, auch der christlichen Hoffnung, auf die Spur kommen möchte, muss deren unterschiedliche Facetten wahr- und ernstnehmen. Wir können gerade nicht mehr darauf setzen, „dass die bloße Hoffnung alles mechanisch richten werde“ 35, wie Bruno Latour vermerkt. Die christliche Hoffnung ist davon nicht ausgenommen. Aber sie hat großes Potenzial, das als Ressource stark zu machen ist. Voraussetzung dafür ist, dass sie einerseits als Ressource erkennbar ist und andererseits als eine solche aktiviert, erforscht und ausgebeutet werden kann.36 Sie ist also immer wieder neu freizugeben. Vielleicht kann auf diese Weise die alte Einsicht, dass Hoffnung lernt, wer Hoffnung gibt, auch für kirchliches Handeln heute Kraft gewinnen. Hoffnung haben, Hoffnung geben und Hoffnung finden hängen aufs Engste miteinander zusammen. Kirche hat davon Zeugnis zu geben, was sie selbst motiviert. „Wahre Hoffnung muss durch Gründe untermauert werden. Darin ähnelt sie der Liebe, und theologisch gesehen, ist sie sogar eine bestimmte Spielart der Liebe.“37 Von christlicher Hoffnung lässt sich begründet, aber nicht vollmundig reden. Sie ist nachvollziehbar, wenn man ihrer Prämisse folgt. Und sie ist leiderprobt. Sie wird geboren in Abschied, Trauer und Tod. Ihr Licht und ihre Kraft zeigen sich im Festhalten an ihrem Grund. Sie ist eine paradoxe Zuversicht, die einem letztlich nur geschenkt werden kann.
Es geht um Lebenshilfe zur Liebe und zur Solidarität. Das ist die Grunddimension kirchlichen Handelns.
Davon ist zu reden und zu handeln: von der Liebe als der „Ermöglichung von Sein“38, von der Unbedingtheit dieser Liebe, aufgrund derer „der Glaube selbst nicht zur Bedingung für deren Wirklichkeit“39 zu machen ist und von der Beziehungsorientierung dieser Liebe, insofern sie „niemals ohne den anderen existieren“40 kann. Es geht um Lebenshilfe zur Liebe und zur Solidarität. Das ist die Grunddimension kirchlichen Handelns. Dabei ist das paulinische „Haben als hätten wir nicht“ (vgl. 1Kor 7,29-32) „auch auf den Glauben, der ja diesseitig ist, zu übertragen: nämlich den Glauben und ‚Gott‘ zu ‚haben‘ als hätte man beides nicht. Dies wäre übrigens auch ein Akt der Solidarität mit den Menschen, die nicht glauben können.“41 Eine solche Zielrichtung verlangt den Kirchen einiges ab, aber es eröffnet auch einiges. Davon ist abschließend zu reden.
3.3 Schweben lernen
Ein Universum, das schwebt, ohne einen Fixpunkt, von dem her und auf den hin alles zuläuft. Das ist die denkerische Herausforderung, die uns seit Giordano Bruno vor die Füße gelegt ist. Sie hat auch Auswirkungen auf unser Glauben. „Der Glaube begibt sich in die eigene Schwebe, wo er Gott über die Offenbarungssemantik hinaus unergründlich Gott sein lässt.“42 Das, was wir von ihm sagen, müssen wir einerseits klar formulieren und andererseits auch immer wieder zurücknehmen, je nachdem, in welchen Horizonten und in welchen Fragerichtungen wir von Gott und der Welt reden. Wir müssen „die unheimliche Schwebe zwischen Ja und Nein als den wahren und einzigen festen Punkt unseres Erkennens aushalten und so unsere Aussagen immer auch hineinfallen lassen in die schweigende Unbegreiflichkeit Gottes selber“43. Das heißt, Halt in der Schwebe gibt es nur in der Bescheidenheit der Gottesrede, in der „Schwebe zwischen Ja und Nein über dem Abgrund der Unbegreiflichkeit Gottes“44 und der darin liegenden Erfahrung seiner Gegenwart. Eindeutig, im Sinne des Unverrückbaren, ist Gottesrede nicht und kann auch Kirche nicht sein. Aufgrund des göttlichen Geheimnisses ist Vieles in Schwebe zu halten. Wir leben nicht im „Stand absoluter Wahrheitserkenntnis“, sondern „mit relativen und revisionsbedürftigen Einsichten“45. Wo es allerdings um ein ganz bestimmtes menschendienliches oder menschendestruktives Verhalten geht, gibt es keine Schwebe mehr, wie nicht zuletzt Mt 25 eindrücklich vor Augen führt. Dann sind „riskante Entscheidungen“ zu treffen, „weil uns das Leben keine Zeit lässt, alles immer weiter-zu-Bedenken: Nur im Handeln, nicht aber im Denken gibt es letzte Gründe.“46
Wir müssen die unheimliche Schwebe zwischen Ja und Nein als den wahren und einzigen festen Punkt unseres Erkennens aushalten
Leben, Glauben und Handeln in der Schwebe, heißt nicht, konturlos durch die Zeit zu treiben. Es geht allerdings mit einem „Machtverzicht“ einher, „denn je mehr mit Macht etwas festgehalten wird, je mehr es also ‚Fixsterne‘ gibt, an denen man festhalten will, oder die man festhalten will, desto mehr Zugriffigkeit möchte man haben bis zu der Sehnsucht, etwas oder andere beherrschen zu können.“47
Korrigiert werden kann das immer nur in der ständigen Vergewisserung von Gottes Liebe als Ermöglichung allen Seins. „Liebe kann niemals ohne den Anderen existieren, sonst hat sie nichts mit dem Wesen der Liebe zu tun, die immer unbegrenzt angelegt ist.“48 Hier liegt der eigentliche Schmerz der Kirchenaustritte, Distanzierungen und Entfremdungen.
Wie weiter bei dieser Ausgangslage? Einerseits in radikaler Anerkennung der individuellen Annäherungspfade – „Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen“49 – und andererseits im radikalen Sich-Einlassen auf die Dimension der Unverfügbarkeit. Gottes Zusagen, seine Verheißungen, gibt es nur in der „Schwebe des Vertrauens“, also nicht als bloße Fixsterne, sondern als „eine immer wieder neu zu entdeckende Lebensweise.“50 Seine „Vergegenwärtigungsformen sind vorrübergehend haltgebend und dürfen es sein im Horizont einer Gottheit, die diesen Halt gibt und auch immer wieder für andere ‚Halte‘ öffnen kann.“51
Die gegenwärtigen Strukturen von Kirche tun sich schwer mit dieser Erkenntnis. Sie tun sich schwer damit, das paulinische „Haben als hätten wir nicht“ an sich heranzulassen und abzubilden. Sie werden sich wandeln müssen. Das ist keine Frage mehr, sondern eine unumgängliche Erkenntnis. Was nun gefragt ist, sind Mut, Einfallsreichtum, Kreativität und Gottvertrauen.
Wie das alles ausgeht, weiß niemand. Dass es so kommt, wie Axel Noack im Rückblick auf die Wiedervereinigung der Kirchen vor fünf Jahren in einem Interview gesagt hat, ist nicht garantiert, aber auch nicht nur ein frommer Wunsch: „Es ist anders gekommen, als wir es gewünscht hätten, aber besser, als wir befürchtet haben. Und am Ende hat es sich alles ganz gut zurechtgerüttelt.“52
- Mein Vortrag dort am 21.01.2003 erschien in überarbeiteter Fassung unter: Michael Domsgen, Wie weiter? Überlegungen zur Zukunft der religiösen Bildung am Lernort Schule in Sachsen-Anhalt, in: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 56 (2004), H. 1, 18-28.
- Evangelische Kirche in Deutschland, Kirchenmitgliederzahlen, Kurztabellen, Stand: 31.12.2023, unter: https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Bericht_KiMi_2023_Kurzbericht.pdf.
- Vgl. Kirchen verlieren weiter Mitglieder, in: Magdeburger Volksstimme, 29.10.2024, S. 2. Für die Landeshauptstadt Magdeburg, dem Bischofssitz der EKM, werden 7,5 Prozent evangelische und katholische Kirchenmitglieder angegeben.
- Paul M. Zulehner, Hermann Denz, Wie Europa lebt und glaubt. Europäische Wertestudie, Tabellenband, Wien 1993, 12.
- Stefan Wolle, DDR Kompakt. Die Kirchen, unter: https://www.bpb.de/themen/deutsche-teilung/ddr-kompakt/521477/die-kirchen/.
- Thomas Klie, Wie die Praktische Theologie zur Sache kam, in: Sonja Keller, Anje Roggenkamp (Hg.), Die materielle Kultur der Religion. Interdisziplinäre Perspektiven auf Objekte und Praxis, Bielefeld 2023, 77-89, 86. (open access: https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/d5/6f/6b/oa9783839463123iXkU8pE3udRJW.pdf)
- Ebd.
- Wolfgang Schivelbusch, Das verzehrende Leben der Dinge. Versuch über die Kommunikation, München 2015, 5.
- Reinhard Bingener, Veränderbare Kirche, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 01.09.2024, S. 8.
- Ilse Junkermann, „Ihr alle seid durch die Taufe berufen …!“ Bericht vor der Landessynode Frühjahr 2012, 9. Tagung der I. Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland vom 19. bis 21. April 2012 in Kloster Drübeck, masch. 46, 27.
- Ottmar Fuchs, Momente einer Mystik der Schwebe. Leben in Zeiten des Ungewissen, Ostfildern 2024, 19f.
- A.a.O., 20.
- Ebd. unter Bezug auf Hans Blumenberg, Das Universum eines Ketzers, in: Giordano Bruno, Das Aschermittwochsmahl. Einleitung von Hans Blumenberg, Frankfurt a. M. 1969, 7-51, 13.
- Blumenberg, Universum, 16.
- Fuchs, Momente, 22.
- A.a.O., 23 unter Bezug auf Blumenberg, Universum, 49.
- A.a.O., 24.
- Ebd.
- A.a.O., 25.
- Vgl. Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften. Erstes und Zweites Buch, Reinbek 1978, 16-18: „Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird bezweifeln, daß er seine Daseinsberechtigung hat, dann muß es auch etwas geben, daß man Möglichkeitssinn nennen kann. … So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als Fähigkeit definieren, alles, was ebensogut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist.“ (16).
- Sehr anregend sind hier die unterschiedlichen Hinweise aus dem Feld von Kunst, Literatur und Musik, die Fuchs gibt (a.a.O., 33-80.
- Alfred K. Treml, Nicole Becker, Lernen, in: Heinz-Hermann Krüger, Werner Helsper (Hg.), Einführung in die Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft, Opladen, Farmington Hills 92010, 103-114, 104.
- Zur kritischen Auseinandersetzung mit dieser Formel vgl. Martin Steinhäuser, „Kirche als Lerngemeinschaft“ – eine praktisch-ekklesiologische Leitformel der Gemeindepädagogik in kritischer Rekonstruktion, unter: https://gemeindepaedagogik.de/wp-content/uploads/Steinh-Lerngemeinschaft.pdf.
- „Verluste sind das schmutzige Geheimnis des Fortschritts.“ Die Zukunft ist für viele Menschen keine Verheißung, sondern eine Bedrohung. Was tun, wenn der Glaube an eine bessere Welt erlischt? Hier erklärt der Soziologe Andreas Reckwitz, wie die Politik das Schlimmste verhindern kann., in: DER SPIEGEL 42/2024, unter: https://www.spiegel.de/kultur/klimawandel-und-krisen-der-glaube-an-eine-bessere-welt-erlischt-was-die-politik-dagegen-tun-kann-a-29cc6723-fd43-4ee3-b0e1-9a2ae5ab32e1?sara_ref=re-so-app-sh.
- Reckwitz illustriert das an folgendem Beispiel: „Nicht die verschwundenen Industriejobs sind das Problem – sondern der fehlende Glaube, dass sie durch andere, bessere Jobs ersetzt werden.“
- Sehr anregende Gedanken zum Aufhören finden sich bei Harald Welzer, Nachruf auf mich selbst. Die Kultur des Aufhörens, Frankfurt a. M. 2021.
- Fuchs, Momente, 82.
- Dorothee Steiof, Was macht Gott in der Stadt? Erfahrungen aus einem Projekt der Präsenzpastoral im Süden von Stuttgart, unter: https://www.feinschwarz.net/was-macht-gott-in-der-stadt-erfahrungen-aus-einem-projekt-der-praesenzpastoral-im-sueden-von-stuttgart/.
- Jonas Grethlein, Hoffnung. Eine Geschichte der Zuversicht von Homer bis zum Klimawandel, München 2024, 16.
- Corine Pelluchon, Die Durchquerung des Unmöglichen. Hoffnung in Zeiten der Klimakatastrophe, München 2023, 9.
- Ebd.
- Ebd.
- A.a.O., 10.
- Grethlein, Hoffnung, 290.
- A.a.O., 270 unter Bezug auf Bruno Latour, Über die Instabilität (des Begriffs) der Natur, in: Kampf um Gaia. Acht Vorträge über das neue Klimaregime, Berlin 2017, 21-76, 31.
- Vgl. Fronçois Jullien, Ressourcen des Christentums. Zugänglich auch ohne Glaubensbekenntnis, Gütersloh 2019, 28.
- Terry Eagleton, Hoffnungsvoll, aber nicht optimistisch, Berlin 2015, 16f.
- Fuchs, Momente, 109.
- Ebd.
- A.a.O., 110.
- A.a.O., 160.
- A.a.O., 21.
- A.a.O., 95.
- Ebd. unter Bezug auf Karl Rahner, Erfahrungen eines katholischen Theologen, in: Karl Lehmann (Hg.), Vor dem Geheimnis Gottes den Menschen verstehen, Freiburg i.Br. 1984, 105-119.
- Ingolf Dalferth, Die Wirklichkeit des Möglichen. Hermeneutische Religionsphilosophie, Tübingen 2003, 430.
- Ebd.
- Fuchs, Momente, 25: „Das Schweben nimmt eine postkoloniale Haltung vorweg, die harte Grenzziehungen vermeidet und den Zwang des aristotelischen ‚entweder/oder‘ ersetzt durch das kleine ‚sowohl als auch‘. Es geht nicht um festumrissene Identitäten, die sich gegenüber stehen und in Verhandlungen eintreten. Übergänge werden geschaffen. Der Schwebezustand relativiert starre, eindeutige Grenzziehungen.“
- A.a.O., 110.
- Vgl. Navid Kermani, Jeder soll von da wo er ist einen Schritt näher kommen: Fragen nach Gott, München 2023.
- Fuchs, Momente 127.
- Ebd.
- „Es kam anders, als wir es gewünscht hätten, aber besser als befürchtet“ 30 Jahre Wiedervereinigung evangelischer Kirchen: Der frühere Magdeburger Bischof Axel Noack blickt zurück, unter: https://www.evangelisch.de/personen/axel-noack-0.