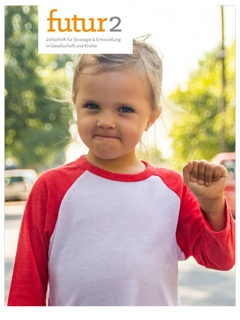Dritte Orte: Eine Agentur für Demokratie in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung
Was tun in einer Gesellschaft, die als zunehmend polarisiert wahrgenommen wird, in der Kommunikation immer schwieriger wird, weil der binäre Code fehlt und sich Systemlogiken derart selbstreferentiell gerieren, wie es derzeit der Fall ist? Die Demokratie wird infrage gestellt, manchmal nur, weil wir uns nicht mehr zuhören oder weil sich Menschen unerhört finden. Digitale Beschleunigung, soziale Netzwerke, eine immer mächtiger (manche befürchten sogar: allmächtiger werdende) künstliche Intelligenz führen zu Verunsicherung, Ängsten, Filterblasen und dem Gefühl, ausgeliefert zu sein. Der implizite und explizite Vorwurf richtet sich dann zumeist auf öffentliche und also staatliche Systeme, die vorgeblich Sicherheit und Gleichheit nicht mehr gewähren können. „Ein demokratisches System nimmt im Ganzen Schaden, wenn die Infrastruktur der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit der Bürger nicht mehr auf die relevanten und entscheidungsbedürftigen Themen lenken und die Ausbildung konkurrierender öffentlicher und das heißt: qualitativ gefilterter Meinungen nicht mehr gewährleisten kann.“1 Die Verinselung und ein digitales Biedermeier führen zum Rückzug in private Räume, die Kommerzialisierung unserer Umgebung und mangelnde Überschaubarkeit unserer Gegenwart führen zum Cocooning. Ein nicht zu unterschätzender Faktor sind im Ergebnis die von Steffen Mau et al. so benannten „Triggerpunkte“, also „jene neuralgischen Stellen, an denen Meinungsverschiedenheiten hochschießen, an denen Konsens, Hinnahmebereitschaft und Indifferenz in deutlich artikulierten Dissens, ja sogar Gegnerschaft umschlagen“2, verbunden mit emotionaler Reaktion oder gar Reaktanz.
Wie kann es gelingen, den demokratischen Prozess nicht nur zu erhalten, sondern zu stärken? Wie kann es gelingen, unterschiedliche Interessenslagen zusammenzubringen, sodass ein akzeptierter Kompromiss möglich ist? Wie kann das Einhalten von Vereinbarungen praktiziert werden in dem gleichzeitig unterschiedliche Perspektiven und Lebensentwürfe Berücksichtigung finden?
Ein Blick in die Wissenschaftsgeschichte führt uns zu dem „Begründer“ der deutschen Soziologie, Ferdinand Tönnies. Er unterscheidet in seiner bekanntesten Arbeit „Gemeinschaft und Gesellschaft“ zwei idealtypische Formen sozialer Interaktion. „Gemeinschaft“, das sind enge, persönliche und direkte soziale Beziehungen, geprägt durch gegenseitiges Vertrauen. Die „Gesellschaft“ hingegen ist durch formale und zweckgerichtete Beziehungen gekennzeichnet, die auf Verträgen und rechtlichen Verpflichtungen basiert. Für Tönnies illustrierten die Begriffe den Wandel von traditionellen zu modernen Gesellschaften und die damit verbundenen sozialen Dynamiken.3 Zu konstatieren ist, dass heute der gesellschaftliche Faktor – also die Einhaltung verbindlicher Normen und Regeln – infrage gestellt und die gemeinschaftliche Dimension mit ihren eigenen Dynamiken und dem Primat des Individuellen absolut gesetzt wird.
Die Diagnose ist bekannt und bleibt gleichwohl ernüchternd. Eine moderne Gesellschaft, so sie wahrhaft „bürgerlich“ ist, also ein Kollektiv von Bürgerinnen und Bürgern, steht hier vor einer immensen Herausforderung. Wie kann es gelingen, den demokratischen Prozess nicht nur zu erhalten, sondern zu stärken? Wie kann es gelingen, unterschiedliche Interessenslagen zusammenzubringen, sodass ein akzeptierter Kompromiss möglich ist? Wie kann das Einhalten von Vereinbarungen praktiziert werden in dem gleichzeitig unterschiedliche Perspektiven und Lebensentwürfe Berücksichtigung finden?
Die Begriffe Verinselung und die Filterbubble machen deutlich, dass es an gemeinsamen Räumen (analog wie virtuell) fehlt, in denen überhaupt Dialog möglich wird. Der Dialog trägt zur Legitimität des Systems bei. Norbert Elias hat den Begriff der „Figuration“ in die Soziologie gebracht. Er besagt, dass die soziale Interaktion von unterschiedlichen Personen zu einem Ergebnis führen kann, welches einzelne nicht erreichen konnten. Aus diesen Interdependenzen wird sozusagen Macht „gemacht“.4 Entwicklungen ergeben sich aus Wechselwirkungen von sozialen Figurationen.5 Jürgen Habermas spricht von Deliberation und meint einen öffentlichen, argumentativen Austausch, bei dem Bürgerinnen und Bürger gemeinsam über politische Angelegenheiten beraten und abwägen. Auch hier ist zentral, dass es nicht vordergründig um die Durchsetzung von Macht, eigenen Ansichten oder individuellen Interessen geht, sondern um die gemeinsame Suche nach dem besseren Argument und einer vernünftigen, für alle nachvollziehbaren und akzeptablen Lösung.6 Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es Räume für Figuration und Deliberation zur Stärkung und Legitimation der Demokratie benötigt.
Ein Begriff, der in diesem Kontext immer häufiger fällt, ist der der sogenannten „Dritte Orte“, die als analoge Räume für Dialog und Diskurs an Bedeutung gewinnen können. Schauen wir uns an, was diese Orte ausmacht, welche Rolle die Raumdimension spielt und ob sie geeignet sind, als reale Plattformen Menschen zu vernetzen.
Der Begriff des „Dritten Ortes“ geht auf den US-amerikanischen Soziologen Ray Oldenburg zurück. In seinem Werk „The Great Good Place* (1989) beschreibt er „Dritte Orte“7 als Treffpunkte, in denen sich Gemeinschaft (im Sinne des Kollektivs, nicht im Tönnies’schen Sinne gesprochen) konstituieren kann, jenseits des Arbeitsplatzes oder des familiären (räumlichen) Umfelds. Für Oldenburg waren solche „Dritten Orte“ Cafés, Buchhandlungen, Biergärten, Friseursalons oder sozial-kulturelle Zentren. Der Dritte Ort ist ein Raum, der Menschen die Möglichkeit bietet, sich außerhalb von Zuhause und Arbeit zu treffen, soziale Kontakte zu knüpfen, Gemeinschaftsgefühl zu erleben und am öffentlichen Leben teilzunehmen. An diesen Orten findet ein Ideenaustausch statt, sie bieten eine Gelegenheit zur sozialen Interaktion fernab der gewohnten privaten oder beruflichen Strukturen.Der Dritte Ort ist ein Raum, der Menschen die Möglichkeit bietet, sich außerhalb von Zuhause und Arbeit zu treffen, soziale Kontakte zu knüpfen, Gemeinschaftsgefühl zu erleben und am öffentlichen Leben teilzunehmen
Oldenburg beschreibt „Dritte Orte“ als neutralen Boden, auf dem Menschen ungezwungen zusammenkommen können. Er betont die zentrale Bedeutung dieser Orte sowohl für das individuelle Wohlbefinden als auch für die Lebendigkeit der gesamten Gemeinschaft. Sie wirken der Isolation und Fragmentierung entgegen, die in modernen Gesellschaften verbreitet sind, und fördern ein Gefühl der Zugehörigkeit und des gemeinsamen Interesses. Durch die Förderung informeller Begegnungen und den Aufbau von Netzwerken stärken „Dritte Orte“ das soziale Gefüge und tragen zur allgemeinen Lebensqualität bei.
Oldenburg benennt acht wesentliche Merkmale von „Dritten Orten“: Sie sind neutral aufgestellt und für jede Person zugänglich gestaltet, sie regen zu Gesprächen und zum Diskurs an, sind örtlich leicht erreichbar und verfügen über eine Ausstattung, die keinerlei Distinktion folgt. Typischerweise gibt es Gruppen, die sich regelmäßig treffen, ohne neu Ankommende zu exkludieren. „Dritte Orte“ sind so zu gestalten, dass man sich ‚zuhause fühlt, ohne zuhause zu sein‘ (Aat Vos), und sie werden oft als eine Art „zweites Zuhause“ wahrgenommen.
An diesem Punkt muss die Diskussion ansetzen und weiterentwickelt werden. „Dritte Orte“ sollen eigentlich zweckfrei sein. Doch die absolute Zweckfreiheit ist dann, wenn wir „Dritte Orte“ als Begegnungsräume der Demokratie und als Lernorte definieren, nicht durchzuhalten.8 Innerhalb der europäischen Kulturgeschichte sind „Dritte Orte“ eng mit der lokalen Identität und der Förderung demokratischer Werte (Versammlungsfreiheit) verknüpft.Innerhalb der europäischen Kulturgeschichte sind „Dritte Orte“ eng mit der lokalen Identität und der Förderung demokratischer Werte (Versammlungsfreiheit) verknüpft.
Letztlich haben wir es mit einer Definitionsfrage zu tun und selbst Oldenborg sprach von einer demokratischen Funktion, die er als Fortführung aus der amerikanischen Gesellschaftsgeschichte herleitetet. „Third places play a broader role than that involving the political processes of a community. They have been parent to other forms of community affiliation and association that eventually coexist with them. […] Free assembly does not begin, as so many writers on the subject seem to assume, with formally organized associations. It does not begin in the Labor Temple. […] It does not begin in fraternal orders, reading circles, parent-teacher associations, or town halls. Those bodies are drawn from a prior habit of association nurtured in third places. In eighteenth-century America, the habit of association was engendered in the ordinaries, or the inns and taverns of the towns and along the waysides between the towns. It was fostered in gristmills and gunshops; in printers‘ offices and blacksmith shops. The old country store provided the daily haunt for many a second-generation settler. To the stores and restaurants that hosted informal association were later added ice cream parlors, pool halls, and the big saloons. Schools and post offices were often the centers of public gathering. Emerging towns and cities were variously rich or poor in such informal village centers. Those that lacked them had little or no social life as a result.“9
„Dritte Orte“ sind in diesem Verständnis weit mehr als bloße Treffpunkte. Sie sind Orte lebendiger Demokratie. Die Theorie kann zur Grundlage werden, öffentlichen Raum für die Teilhabe, die Figuration, die Deliberation und vor allem, für den lebendigen Austausch ohne Konsumzwang, aber mit einem fundierten Bildungsangebot zur Verfügung zu stellen. Prädestiniert für diesen Weg sind insbesondere Bibliotheken und Volkshochschulen, und zwar aus dreierlei Gründen: Erstens sind sie fast flächendeckend und auch in ländlichen Gegenden vorhanden10, zweitens haben sie eine langjährige Erfahrung und Tradition im informellen Lernen und drittens sind sie mit konkreten Räumlichkeiten verknüpft, die für neue Aufgaben eventuell nur marginal neugestaltet werden müssen. Bringt man den Ansatz einer Weiterentwicklung der Idee „Dritter Orte“ mit den vorhandenen Institutionen der kulturellen Infrastruktur zusammen mit den Überlegungen, die Jürgen Habermas formuliert hat, so kann der Auftrag, Diskursräume zu entwickeln, dezidiert im Interesse der demokratischen Öffentlichkeit liegen, denn „ohne einen geeigneten Kontext finden die für eine demokratische Legitimation der Herrschaft wesentlichen Voraussetzungen deliberativer Politik keinen Halt [mehr, M.L.] in einer Bevölkerung, von der doch ‚alle Gewalt ausgehen‘ soll. Regierungshandeln, Grundsatzurteile der Obergerichte, parlamentarische Gesetzgebung, Parteienkonkurrenz und freie politische Wahlen müssen auf eine aktive Bürgergesellschaft treffen, weil die politische Öffentlichkeit in einer Zivilgesellschaft wurzelt, die – als der Resonanzboden für die reparaturbedürftigen Störungen wichtiger Funktionssysteme – die kommunikativen Verbindungen zwischen der Politik und deren gesellschaftlichen ‚Umwelten‘ herstellt. Die Zivilgesellschaft kann […] für die Politik nur dann die Rolle einer Art von Frühwarnsystem übernehmen, wenn sie die Akteure hervorbringt, die in der Öffentlichkeit für die relevanten Themen der Bürger Aufmerksamkeit organisieren.“11 In einer zunehmend fragmentierten Stadtgesellschaft bieten sie Möglichkeiten für intergenerationellen Austausch, Integration und das Aushandeln gesellschaftlicher Themen.12Dritte Orte sind in diesem Verständnis weit mehr als bloße Treffpunkte. Sie sind Orte lebendiger Demokratie.
Der faktische gesellschaftliche Mehrwert „Dritter Orte“ manifestiert sich in ihrer Funktion als Foren (oder, um es in Analogie zur digitalen Ökonomie zu setzen) Plattformen für Dialog und Diskurs. Sie bieten einen optimierten Rahmen, in dem vielfältige Meinungen und Personen zwanglos aufeinandertreffen und (strittige) Themen verhandelt werden können, ohne dass unmittelbare Einmütigkeit oder Konsens erforderlich werden. Insbesondere in unseren Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung und demokratischer Legitimationskrisen, in denen digitale Echokammern und Filterblasen den öffentlichen Diskurs prägen, sind solche analogen Begegnungsräume von unverzichtbarer Bedeutung. Hier können die „Triggerpunkte“ thematisiert und unter Umständen sachlich erörtert werden, eine gute Begleitung und Moderation vorausgesetzt, was wiederum ein originärer Ressourcenbeitrag „Dritter Orte“ wäre (in ihren Kapazitäten wie Bildungsangeboten, Workshops, Foren, Panels o.ä.). Sie bieten den räumlichen Rahmen, in dem das „Miteinander der Unterschiedlichen“ gestaltet werden kann, eine „Agency jenseits der Politik, die dennoch hoch politisch ist, [denn, Anm. M.L.] ohne diese Scharniere des gruppenübergreifenden Austausches, ohne das Wirken der Zivilgesellschaft ist Integration durch Konflikte kaum denkbar“.13 Spontane und ungeplante, auch kontroverse Gespräche könnten zumindest zu einem zivilisierten Umgang mit der Differenz – die im Übrigen jegliches demokratisches Gemeinwesen ausmacht – verhelfen, wenn nicht sogar zu sozialen Lernprozessen führen. Die Bubble kann, Struktur im Diskurs vorausgesetzt, unter Umständen argumentatorisch verlassen werden. „Womöglich legen diese [Strukturen und Aktivitäten in den dritten Orten] den Grundstein für weitere Begegnungen und schaffen im besten Fall Zugänge zu anderen gesellschaftlichen Teilsystemen.“14
„Dritte Orte“ sind mehr als bloße Treffpunkte, sie sind sogar mehr, als Oldenburg intendiert hat. Sie sind analoge soziale Labore innerhalb der demokratischen Gesellschaft, die geprägt ist durch die digitale Transformation, eine zunehmende Beschleunigung und Komplexität. Sie bieten eine neue Möglichkeit der (Um-)Weltwahrnehmung oder „Resonanz“, wie dies Hartmut Rosa benannt hat. „Nicht das Erobern und Kontrollieren von Welt, sondern ihr Vernehmbarmachen gilt es in den Fokus des Handelns zu rücken, und der Modus politischen Handelns sollte nicht von Motiven des Durchsetzens gegen andere und gegen die Welt, sondern von der Vision und Intention des kollektiven Gestaltens des Gemeinwissens bestimmt sein.“15 In einem von Konsumzwang befreiten und prinzipiell herrschaftsfreien, demokratisch legitimierten Raum ist ein kollektives Gestalten möglich. Diese Begegnungs- und Austauschorte leisten einen wesentlichen Beitrag zur Vorbeugung gesellschaftlicher Polarisierung und zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts. In einer Ära, in der der öffentliche Diskurs fast unmöglich erscheint, stellen „Dritte Orte“ einen unverzichtbaren Beitrag für eine lebendige, demokratische und resiliente Gesellschaft dar.
- Jürgen Habermas, Überlegungen und Hypothesen zu einem erneuten Strukturwandel der Öffentlichkeit. In: Leviathan 49, Sonderband 37 (2021), 470–500, 498.
- Steffen Mau (et al.), Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft, Berlin 2023, 246.
- Vgl. Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. 1880-1935., hrsg. v. Bettina Clausen und Dieter Haselbach, Berlin/Boston 2019 (Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe, Band 2).
- Vgl. Wolfgang Sofsky / Rainer Paris, Figurationen sozialer Macht. Autorität, Stellvertretung, Koalition, Frankfurt am Main 1994, 16.
- Vgl. Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation. 2 Bde., Frankfurt am Main 1976.
- Vgl. Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt am Main 198.1
- Vgl. Ray Oldenburg, The great good place. Philadelphia 1989
- Vgl. Martin Lätzel, Brücken bauen. Die Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek
als Dritter Ort. In: Auskunft 44 (2024), 277-288. - Oldenburg, 72.
- Wir wollen hier explizit nicht nur auf die Stadtgesellschaft rekurrieren. Vgl. Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Dritte Orte. Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum, Düsseldorf 2021, online: https://www.mkw.nrw/system/files/media/document/file/broschuere_dritte_orte_onlineversion_einzelseiten.pdf
- Habermas, Überlegungen, 479.
- https://koerber-stiftung.de/projekte/koerber-demografie-symposium/spotlight-demografie/dritte-orte/
- Mau, 420.
- Sabine Meier, Third Places: Sonderfall des öffentlichen Raumes, in: Magazin Innenstadt 01/2021, 4-7, 5. Online: https://www.innenstadt-nrw.de/fileadmin/user_upload/Service/Veroeffentlichungen/Magazin_Innenstadt/202101_Dritte_Orte/Mag01_21_Dritte_Orte_final_web.pdf
- Hartmut Rosa, Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Berlin 2019, 732.