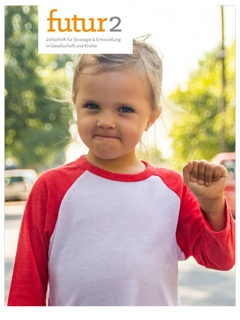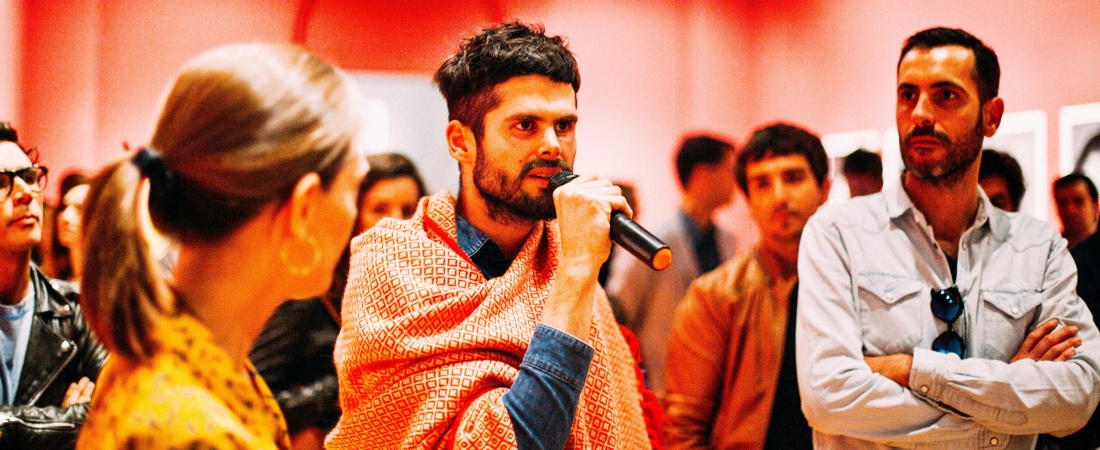„Die Verständigungsrepublik“ im Kleinen. Ein zukunftsfähiges Gesellschaftsmodell in polarisierenden Zeiten
Hinzu kommt eine konfliktscheue Alltagskultur. Viele Menschen weichen heiklen Themen aus, um Spannungen zu vermeiden. Ein gutes Drittel hat Beziehungskontakte schon abgebrochen. Und doch ist das Bedürfnis, gerade über strittige Fragen zu sprechen, unverkennbar. 64 Prozent führen solche Gespräche im geschützten Nahraum. Als geeignete öffentliche Verständigungsräume gelten vor allem (Bürger-)Versammlungen vor Ort. Sie werden von einer Mehrheit als tragfähige Umgebung für respektvolle, sachliche Auseinandersetzungen gesehen. Was dabei als entscheidend gilt, ist erstaunlich eindeutig: neutrale Moderation, klare Regeln, ein gemeinsam nutzbares Faktenfenster und ein Rahmen, der Würde und Sicherheit garantiert. Diese Konstellation ist kein Nischenwunsch, sondern Mehrheitsmeinung.
Ihr Versprechen ist nicht ausschließlich Einigkeit, sondern die verlässliche Erfahrung von Fairness.
Die Schattenseite ist ein Klima der Sorge. Eine übergroße Mehrheit fürchtet wachsenden Hass und eine Verrohung des Umgangs. Die Menschen erleben gesellschaftliche Konflikte nicht primär als inhaltliche Differenzen, sondern als Beziehungsrisiko und als Möglichkeit, beschämt, abgewertet oder abgehängt zu werden. Zugleich sind viele privat zufrieden und im Kleinen handlungsfähig. Genau diese Spannung nährt das Gefühl, dass die „große Welt“ nicht mehr verlässlich gestaltbar ist. Wer das ernst nimmt, muss Kräfte für Verständigung mobilisieren, ohne die Härte realer Zielkonflikte zu verharmlosen.
Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden für ein bewusst schlichtes, zugleich robustes Gesellschaftsmodell plädiert: eine deliberativ-solidarische Demokratie oder auch Verständigungsrepublik im Kleinen. Ihr Versprechen ist nicht ausschließlich Einigkeit, sondern die verlässliche Erfahrung von Fairness. Drei Pfeiler tragen diese Architektur. Erstens Wehrhaftigkeit, also die klare, rechtsstaatlich kontrollierte Abwehr menschenfeindlicher, gewaltförmiger und entwürdigender Praxis. Zweitens Deliberation, was strukturierte, regelgebundene Verständigung als selbstverständliche Infrastruktur meint, die nicht als Event-Zutat daherkommt. Inkludiert sind hierbei Verfahren, die aus Dissens Entscheidungen machen, ohne Minderheiten zu demütigen. Drittens Solidarität, also eine konkrete Rücksicht auf Verletzliche, die Beteiligung nicht vom Mut zur Selbstentblößung abhängig macht, sondern von zugesicherten Schutz- und Unterstützungsbedingungen.
Warum könnte dieses Modell zukunftsfähig sein, ohne auf Kosten einzelner Gruppen zu funktionieren?
Weil es nicht mit leeren Versprechungen, sondern mit verlässlichen Verfahren operiert. In einer Lage, in der 75 Prozent neutrale Moderation und 69 Prozent klare Kommunikationsregeln einfordern, kann die politische Antwort nicht nur der moralische Appell sein, sondern die Zusage, dass jede relevante Aushandlung nachvollziehbaren, überprüfbaren, inklusiven Regeln folgt und dies erkennbare Folgen hat. Die Verständigungsrepublik verspricht nicht, dass am Ende alle gewinnen, sondern dass niemand seine Würde verliert. Das schützt nicht bloß „Minderheiten“ im klassischen Sinn, sondern konkret jene, die im jeweiligen Konfliktfeld besonders verletzlich sind. Betroffene von Rassismus, andere diskriminierte Minderheiten, pflegende Angehörige, Personen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, Jugendliche ohne Lobby und ja, gelegentlich auch die „Leisen“, die in hitzigen Formaten sonst untergehen.
Kommunen, Hochschulen, Vereine, Kultur- und Religionsgemeinschaften u. a. werden zu Verständigungsorten der Bürgergesellschaft.
Zweitens rechnet sie ehrlich mit Pluralität. Polarisierung verschwindet nicht, verschwindet nicht durch gutes Zureden. Sie lässt sich nur bearbeiten. Dass eine Mehrheit (Bürger-)Versammlungen für geeignet hält, verweist auf ein lernfähiges Alltagswissen. Nähe, Konkretion, Überschaubarkeit und Ergebnisnähe sind Bedingungen produktiver Konfliktbearbeitung. Verfahren, die in der Nachbarschaft ansetzen und die Betroffenen nicht nur konsultieren, sondern Verantwortungen teilen lassen, befriedigen nicht jeden Anspruch. Aber sie machen bestimmte Dilemmata zum Gegenstand bewusster Entscheidungen. Das ist, anders als symbolische „Beteiligung“, anstrengend. Es ist zugleich die einzige Art politischer Arbeit, die Vertrauen reproduziert.
Drittens verknüpft die Verständigungsrepublik Deliberation mit sozialen Sicherheiten. Beteiligung kostet Zeit, Aufmerksamkeit, gelegentlich Geld und immer Nerven. Wer materiell verunsichert ist, meidet Debatten eher und misstraut Verfahren leichter. Deshalb gehören Aufwandsentschädigungen, Kinderbetreuung, barrierearme Formate und niedrigschwellige, mehrsprachige Zugänge zur Grundausstattung, ebenso Ombudsstellen und klare Sanktionspfade gegen Diffamierung. Damit wird Deliberation sozial überhaupt erst möglich.
Bausteine für eine gelingende „Verständigungsdemokratie“ im Kleinen
In der Praxis könnte das unspektakulär aussehen. Kommunen, Hochschulen, Vereine, Kultur- und Religionsgemeinschaften u. a. werden zu Verständigungsorten der Bürgergesellschaft. Sie laden ein, stellen Räume, qualifizieren Gastgeberinnen und Gastgeber, öffnen „Faktenfenster“, in denen geprüfte, laienverständliche Dossiers bereitstehen, und sichern Verfahren über Verhaltenskodizes ab.
Auf einer ersten, gelosten Spur arbeiten repräsentativ zusammengesetzte Bürgerräte an Optionen. Parallel öffnet eine zweite Spur niederschwellige Publikumsforen. Beide Spuren sind verbunden. Die Öffentlichkeit kann Input geben, die geloste Gruppe verhandelt, begründet, gewichtet und priorisiert. Abschließend erzwingt eine verbindliche Rückkopplung politische Folgebearbeitung. Zustimmen, begründet abweichen, aber nie „zur Kenntnis nehmen und ablegen“. So entstehen belastbare Brücken zwischen Expertise, gelebter Erfahrung und Entscheidung. Dass sich Menschen genau diese Elemente wünschen – Moderation, Regeln, Fakten, Schutz –, ist in der midi-Studie zu Verständigungsorten nicht zu übersehen.
Kirchen können in dieser Landschaft eine präzise, allerdings begrenzte Rolle übernehmen. Sie treten nicht als Weltanschauungsanbieterinnen auf, sondern als Gastgeberinnen.
Wie kommen wir dorthin, und zwar mit Menschen, die politisch Unterschiedliches wollen?
Drei Zugänge scheinen einladend. Freiheitlich-konservative Stimmen betonen Ordnung, Verlässlichkeit und Sicherheit. Sie gewinnen, wenn Beteiligung vor Überrumpelung schützt, Entscheidungen an nachvollziehbaren Prozeduren hängen und Respekt mehr ist als Etikette. Sozial-ökologische Stimmen ringen um Gerechtigkeit, Schutz der Lebensgrundlagen und Gleichwürdigkeit. Sie gewinnen, wenn Verfahren Verteilungsfragen nicht depolitisieren, sondern transparent verhandeln und in mandatierte Entscheidungen überführen, etwa in Bürgerhaushalte, Klima-Räte und Sozialausschüsse, die mit demokratischer Rückbindung experimentieren. Liberale und pluralitätsfreundliche Stimmen wollen offene Räume, Innovation und Unternehmungsgeist. Sie gewinnen, wenn die zweite Spur Beteiligung leicht macht, digital gestützt, gut moderiert ist mit niedriger Schwelle, jedoch klare Haltelinien gegen Hass und Manipulation setzt. Der kleinste gemeinsame Nenner ist überraschend stabil: Gewaltfreiheit, Unantastbarkeit der Würde, Vorrang fairer Verfahren, geteilte Faktenbasis und Ergebniswirksamkeit.
Rolle der Kirchen
Kirchen können in dieser Landschaft eine präzise, allerdings begrenzte Rolle übernehmen. Sie treten nicht als Weltanschauungsanbieterinnen auf, sondern als Gastgeberinnen. Sie verfügen über Raum, Rituale, Ehrenamtserfahrung und Seelsorgekompetenz. Dass religiöse Gemeinden als primäre Verständigungsorte aktuell nur von einer Minderheit als geeignet angesehen werden, ist eher Auftrag als Hindernis. Wer sich sichtbar professionell an Moderation, Regelklarheit und Schutz hält, kann Vertrauen herstellen, gerade weil die Studie zeigt, wie hoch die Nachfrage nach neutraler Moderation und geschützten Rahmen ist. Kirchen können zudem das stützen, was Menschen in Krisen tatsächlich Kraft gibt: Beziehungen, Freizeit- und Sinnpraktiken. Für ein Drittel spielt auch Religiosität eine Rolle. Das ist keine „Vergeistigung der Politik“, sondern eine Ressourcenpflege.
Hoffnungszeichen … dass die Sehnsucht nach Verständigung kein Elitenprojekt ist. Sie findet sich in den Küchen, auf Vereinsbänken, in WhatsApp-Gruppen …
Politischer Rahmen
Selbstverständlich stellt sich die Frage nach der politischen Übersetzung. Ohne Rahmensetzung bleibt vieles Kosmetik. Nötig wären Mindeststandards für öffentliche Beteiligung (Transparenz, Inklusion, Qualitätssicherung), eine Finanzierung, die Armut nicht zur Teilnahmebarriere macht, Kompetenzzentren für Kommunen, ein verpflichtender Einsatz deliberativer Verfahren bei besonders konfliktträchtigen Großvorhaben und eine digitale Öffentlichkeit, die dem Gemeinwohl dient. Nichts davon ist spektakulär. Aber genau diese unscheinbare Technik der Demokratie schafft das, was dem Betrieb am stärksten fehlt: Verlässlichkeit.
Gegen diese Vorschläge stehen vertraute Einwände.
- „Das dauert alles zu lange.“ Ja, Verfahren kosten Zeit. Aber gescheiterte Implementierungen, Boykotte und Gerichtsverfahren kosten mehr.
- „Die Lauten dominieren am Ende doch.“ Darum Losverfahren, Redezeit-Balance, trainierte Hosts, Sanktionsmechanismen.
- „Fakten sind umstritten.“ Eben deshalb kuratierte Dossiers mit Quellenpluralität und Peer-Review statt Link-Schlachten.
- „Schönwetter-Demokratie!“ Im Gegenteil: Wer 89 Prozent Sorge vor Hass und 86 Prozent Sorge um den gesellschaftlichen Umgang ernst nimmt, baut nicht auf Harmonie, sondern auf Strukturen, die Konflikte aushaltbar und produktiv machen.
Ausblick „Hoffnungszeichen“
Zwei Hoffnungszeichen tragen das Konzept. Erstens, dass die Sehnsucht nach Verständigung kein Elitenprojekt ist. Sie findet sich in den Küchen, auf Vereinsbänken, in WhatsApp-Gruppen u. v. a. Dass 64 Prozent im geschützten Raum über strittige Themen sprechen, zeigt eine Erfahrungsschule, an die öffentliche Verfahren anschließen können. Zweitens: Menschen wissen ziemlich genau, was sie dafür brauchen, nämlich Moderation, Regeln, Fakten und Schutz. Sie nennen zudem als geeigneten Ort die (Bürger-)Versammlung im Nahraum. Die Verständigungsrepublik knüpft daran an. Sie organisiert Streit anständig, schützt die Würde der Beteiligten und verpflichtet Entscheidungen auf begründete Verfahren. Wenn Bürgerinnen und Bürger diese Erfahrung wiederholt machen, dass sie gehört werden, dass Fakten nicht als Waffe, sondern als gemeinsame Ressource dienen, dass Ergebnisse Folgen haben, wächst Vertrauen: ineinander, in Institutionen und in die Zukunft.
Wir leben nicht im Endspiel der Demokratie, sondern am Anfang einer Lernphase mit hoher Erschöpfung, aber der Ressource Sehnsucht.
Das ist keine Utopie, sondern eine Praxis. Sie beginnt mit kleinen, nahen Formaten, in denen die Stadt über die Wärmewende im Quartier berät, Eltern und Lehrkräfte Lernzeiten fair austarieren, Pendlerinnen und Einzelhändler Lieferverkehre neu strukturieren, Migrantenvereine und Nachbarschaften über Teilhabewege verhandeln. Sie braucht politische Rückendeckung, aber noch mehr braucht sie Gastgeberinnen, die den Tisch decken, beispielsweise Kommunen, Kultureinrichtungen, Vereine, Medienhäuser, Religionsgemeinschaften u. a. m. Und sie rechnet mit Brüchen, Fehlern, Rückschlägen. Genau deshalb ist ihr Fundament nicht moralische Überlegenheit, sondern überprüfbare Fairness. Die Studie legt nahe: Wir leben nicht im Endspiel der Demokratie, sondern am Anfang einer Lernphase mit hoher Erschöpfung, aber der Ressource Sehnsucht. Wenn wir dieser Sehnsucht Formen geben, entsteht Schritt für Schritt die Kultur, die wir vermissen. Die Verständigungsrepublik wäre der nüchterne Name dafür.
- Daniel Hörsch, Verständigungsorte in polarisierenden Zeiten. Studie zur Stimmungslage in der Gesellschaft, Berlin 2025, https://www.mi-di.de/publikationen/verstaendigungsorte-in-polarisierenden-zeiten (abgerufen am 02.09.2025).