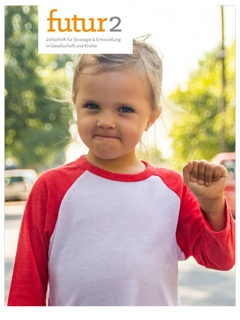Weiberwirtschaft? Ein gutes Leben für ALLE – und was das mit einem Frauenverband zu tun hat
Was ist eigentlich ein gutes Leben?
Bei der kfd, einem großen Frauenverband, sind wir uns einig, dass Menschenwürde, Solidarität, gute Beziehungen und Gemeinschaft, ökologische Nachhaltigkeit, gleiche Rechte und Teilhabe ALLER unbedingt dazu gehören.
Allerdings sehen wir uns aktuell einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber, die nicht gerade für ein gutes Leben stehen: Klimawandel, die Bedrohungen von rechts, fehlender Zusammenhalt in der Gesellschaft, zunehmender Pflegenotstand oder Wohnungsnot: Vieles scheint nahezu unüberwindbar – sowohl aus globaler Perspektive als auch auf nationaler Ebene. Neben dem Gegensatz von arm und reich erschrecken auch diskriminierende Strukturen, die Frauen, queere Menschen ebenso benachteiligen wie Menschen mit Migrationsgeschichte oder Behinderungen. Als Frauenverband setzen wir uns täglich mit solchen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten auseinander, denen Frauen immer noch und immer wieder ausgesetzt sind. Dies ist nicht nur ethisch fragwürdig, sondern bringt auch einen immensen Schaden für unser Zusammenleben und ein gesellschaftliches Zusammenwirken mit sich.
Als Frauenverband setzen wir uns täglich mit solchen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten auseinander, denen Frauen immer noch und immer wieder ausgesetzt sind. Dies ist nicht nur ethisch fragwürdig, sondern bringt auch einen immensen Schaden für unser Zusammenleben und ein gesellschaftliches Zusammenwirken mit sich.
Warum leistet sich eine Gesellschaft solche Risiken? Denn insbesondere die soziale Ungleichheit bietet viel Sprengstoff für unsere Gesellschaft. Warum fällt es ihr so schwer, sich dem Thema zu stellen und tatsächlich Veränderungen herbeizuführen?
In den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts war ich für einen längeren Zeitraum in Brasilien. Im Rahmen meines Studiums habe ich mich dann intensiv mit Einkommensverteilungen auseinandergesetzt und hier ein besonderes Augenmerk auf Brasilien gelegt. Anders als damals in Deutschland war die Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen in Brasilien seinerzeit sehr stark ausgeprägt. Begleitet wurde sie durch diskriminierende, rassistische und frauenfeindliche Strukturen, sehr ungleiche Chancen auf Bildung und Teilhabe, korrupte Strukturen in der Politik und ein zunehmend neoliberal geprägtes Wirtschaftssystem. Neben kolonialen Vermächtnissen und ausbeuterischer globaler Wirtschaftsweise war die Politik seinerzeit in Brasilien jedoch nicht willens oder in der Lage, dieser Ungleichheit etwas entgegenzusetzen.1
Viele der Phänomene, die seinerzeit in Brasilien zu beobachten waren, wie eben die Einkommens- und Vermögensverteilung, aber auch soziale Ungleichheit oder ein unbefriedigendes Bildungssystem mit ungleichen Chancen, sehen wir heute in unserer Gesellschaft. Und die Entwicklung dahin ist seit langem absehbar. Trotzdem haben wir die Risiken, die eine solche Entwicklung für die gesamte Gesellschaft mit sich bringen, in Kauf genommen. Nun sind alle von den extremen Ausprägungen betroffen und diese machen Angst. Trotzdem scheint ein Umsteuern schwerzufallen.
Entscheidend dafür ist sicherlich das Wirtschaftssystem und die Art und Weise, wie sehr die Wirtschaft im Vordergrund steht.
Während der Wende gab es wenig Diskussion darüber, welches Wirtschaftssystem das richtige ist. Es schien gesetzt zu sein, dass es nur das kapitalistische sein kann. Dementsprechend richtete sich die Politik auch eben daran aus. Der Neoliberalismus war nicht zu stoppen und volkswirtschaftliche Prinzipien, wie die Existenz meritorischer Güter2 wurde nicht mehr beachtet. Es wurde viel privatisiert und auf die Kraft des Marktes gesetzt. Die Folgen dieser Privatisierungen spüren wir heute sehr stark, z. B. am Pflegenotstand oder am Klimawandel. Die Kosten werden externalisiert und Frauen sind von den Auswirkungen erwiesenermaßen deutlich stärker betroffen als Männer.Während der Wende gab es wenig Diskussion darüber, welches Wirtschaftssystem das richtige ist. Es schien gesetzt zu sein, dass es nur das kapitalistische sein kann.
Unterstützt wird dies bis heute durch eine Ausrichtung der Wirtschaftslehre an der neoklassischen Theorie. Diese ist grundsätzlich als theoretischer Hintergrund hilfreich, aber aufgrund ihrer Prämissen und Bedingungen nicht geeignet, so in die Realität umgesetzt zu werden. Leider nutzen trotzdem immer noch einige Politiker genau dieses Narrativ des Marktes im Sinne der neoklassischen Theorie für ihr Handeln. Dies führt dann zu weiteren Reduzierungen von Sozialleistungen oder dem Abbau eines solidarischen Sozialsystems. Die Dominanz einer ökonomischen Sicht auf die Welt ist unübersehbar und selbst Finanzcrashs führen nicht dazu, dass das System hinterfragt wird.
Muss das so sein oder gibt es auch Alternativen dazu?
Klare Antwort: Ja, die gibt es!
Hier möchte ich die Gemeinwohl-Ökonomie herausheben, da sie ein umfassendes alternatives und enkeltaugliches Wirtschaftssystem darstellt. Interessanterweise ist eine Ausrichtung des Wirtschaftens am Gemeinwohl in vielen Verfassungen – sowohl denen der Bundesländer als auch im Grundgesetz – bereits festgeschrieben. Es gibt darüber hinaus weitere sehr gute und wichtige Ansätze, mit denen es zahlreiche Gemeinsamkeiten und Überschneidungen gibt.3 Aber unabhängig davon, wo der jeweilige Schwerpunkt liegt: Die Haltung ist entscheidend – die Wirtschaft muss menschlicher, sozialer und verteilungsgerechter, nachhaltiger, demokratischer und ethischer werden!4Hier möchte ich die Gemeinwohl-Ökonomie herausheben, da sie ein umfassendes alternatives und enkeltaugliches Wirtschaftssystem darstellt.
Zweck der Gemeinwohl-Ökonomie, auch GWÖ genannt, ist ein gutes Leben für ALLE. Sie basiert auf Kooperation und auf fairem Umgang mit Mitarbeiter*innen, Kund*innen, Lieferant*innen und allen weiteren Berührungsgruppen von der Mikro- bis zur Makroebene. Eine besondere Bedeutung kommt dabei auch den Unternehmen zu als wichtigen Akteuren im Wirtschaftssystem. Die GWÖ zeichnet sich durch eine Komplexität aus, die dem Verständnis des gesamten Systems angemessen ist.
Voraussetzung für einen Veränderungsprozess hin zu einer solchen Wirtschaftsweise ist auf jeden Fall ein Haltungsprozess: Es geht nicht darum, dass ich persönlich den größten Nutzen oder Profit von einer Transaktion habe. Es geht darum, wie ich so einkaufen, verkaufen oder Dienstleistungen erbringen kann, dass auch alle anderen Beteiligten sich fair behandelt fühlen und auskömmlich beteiligt sind. Geld ist nicht Selbstzweck – wie wir es heute oftmals erleben –, sondern nur ein Mittel zum Zweck.Es geht nicht darum, dass ich persönlich den größten Nutzen oder Profit von einer Transaktion habe. Es geht darum, wie ich so einkaufen, verkaufen oder Dienstleistungen erbringen kann, dass auch alle anderen Beteiligten sich fair behandelt fühlen und auskömmlich beteiligt sind. Geld ist nicht Selbstzweck – wie wir es heute oftmals erleben –, sondern nur ein Mittel zum Zweck.
Die zentralen Werte der GWÖ und allen Handelns im Sinne des Gemeinwohls sind:
- Menschenwürde
- Solidarität und Gerechtigkeit
- Ökologische Nachhaltigkeit
- Transparenz und Mitbestimmung
Diese Werte sind nicht nur Schlagwörter, sondern sie bestimmen das alltägliche Handeln und werden auch überprüft.
Einige Beispiele für Ansatzpunkte sind etwa:
- Gehaltsgefüge in einem Unternehmen: Wie groß ist die Spannweite zwischen höchstem und niedrigstem Einkommen? Je kleiner der Faktor, desto gerechter (derzeit erleben wir jedoch sehr große Unterschiede)
- Mitbestimmung von Mitarbeiter*innen
- Sinnstiftende Arbeitsplätze
- Mitbestimmung von Kund*innen und Lieferant*innen, z. B. bei der Produktentwicklung
- faire, ökologisch nachhaltige und durchgängig bekannte Lieferketten
- ökologisch und sozial nachhaltige Geldanlagen
Die GWÖ-Community ist eine internationale Bewegung mit dem Ziel, die GWÖ auch in der Politik zu verankern. Auf EU-Ebene gab es ebenso wie im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung bereits Bestrebungen und Ansätze dazu. Leider ist im aktuellen Koalitionsvertrag zu GWÖ-Zielen nur sehr wenig zu finden. Dennoch gibt es ermutigende Erfolge. Inzwischen haben sich zahlreiche Unternehmen, Organisationen und selbst Kommunen bilanzieren lassen und arbeiten nach den Prinzipien der GWÖ. Beispiele dafür sind Vaude oder Werkhaus, aber auch lokale Unternehmen oder die Wirtschaftsförderung Münster.5 Außerdem gelingt es zunehmend gerade auf kommunaler Ebene, dass die GWÖ als Instrument mit in den Blick genommen wird.Inzwischen haben sich zahlreiche Unternehmen, Organisationen und selbst Kommunen bilanzieren lassen und arbeiten nach den Prinzipien der GWÖ.
Aktuelle Messinstrumente beschränken sich zwar oftmals auf eine quantitative, rein an Euro-Beträgen ausgerichtete Richtgröße, sagen aber nichts über die Qualität des Wirtschaftens oder des Unternehmenserfolgs aus. Wirtschaftswachstum kann auch mit umweltzerstörenden Industrien oder mit der Herstellung von (Atom-)Waffen erzielt werden. Ob diese den Wohlstand oder ein gutes Leben für ALLE bedeuten, darf aber bezweifelt werden. Genauso ist es auf Unternehmensebene oder bei der Betrachtung einzelner Investitionen. Alle Unternehmen müssen Finanzbilanzen erstellen, aber auch diese sagt nichts über einen potenziellen Beitrag zum Gemeinwohl aus.
Instrument zur Orientierung, aber auch zur Überprüfung ist die Gemeinwohlmatrix, in der die zentralen Werte zu den Berührungsgruppen in Beziehung gesetzt werden.
Daraus ergeben sich alternative Messinstrumente, die eben genau diese Ausrichtung am Gemeinwohl abbilden:
- Makroebene: Gemeinwohl-Produkt vs. BIP (Bruttoinlandsprodukt)
- Mesoebene: Gemeinwohl-Bilanz vs. Finanzbilanz
- Mikroebene: Beitrag einer Investition zum Gemeinwohl vs. RoI (Return on Investment)
Die kfd im Bistum Münster hat eine solche Gemeinwohlbilanz mit positivem Ergebnis erstellt. Aber warum erstellt ein Frauenverband überhaupt eine solche Bilanz?
Auch wenn die kfd als Verband kein profitorientiertes Unternehmen ist, ist sie doch Akteurin im ökonomischen System:
- Sie kauft ein und hat somit Einfluss auf die Lieferketten.
- Sie ist Arbeitgeberin und somit verantwortlich für die Bezahlung und Mitbestimmung der Mitarbeiter*innen.
- Sie erbringt Leistungen und pflegt somit einen Umgang mit Kund*innen.
- Sie hat Mitglieder und entscheidet, wie demokratische Teilhabe und Transparenz im Verband gelebt wird.
- Sie will authentischer Lobby-Verband für Frauen* sein, hat Einfluss auf sein Handeln und die gesellschaftliche Wirkung.
Als Frauenverband setzt sich die kfd für Gleichstellung und Solidarität in Gesellschaft und Kirche ein, konkret etwa für gleiche Bezahlung und gleiche Chancen. Dementsprechend ist eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ein gerechtes Entlohnungssystem mit einer sehr geringen Spannweite zwischen den Einkommen selbstverständlich. Die kfd setzt sich ein für demokratische Teilhabe von Frauen. Das demokratische Prinzip mit größtmöglicher Transparenz ist deshalb ein Muss. Solidarität und Schöpfungsverantwortung haben natürlich zur Folge, dass die eigenen Lieferketten analysiert und entsprechend ausgerichtet werden. Dies ist mit Blick auf den gesellschaftlichen Impact und den „Social Return on Investment“ unabdingbar für den Zusammenhalt und für eine gerechte und solidarische Gesellschaft.
Traditionelle Vereinsstrukturen werden auch in einem Frauenverband in Zukunft nicht mehr in der Form funktionieren, wie sie das in der Vergangenheit getan haben. Die Lebenswelten von Frauen haben sich grundlegend verändert und es bestehen ganz andere Bedürfnisse und Notwendigkeiten als noch vor einigen Jahren. Dies bringt gesellschaftliche Umbrüche mit sich. Daher stellt sich die kfd im Bistum Münster gerade einem intensiven Zukunfts- und Veränderungsprozess. Die kfd entwickelt neue Ansätze und Betätigungsfelder, um die Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Damit wird die kfd auch ihr Dienstleistungsspektrum erweitern und tritt damit am Markt auf. Dies geschieht immer vor dem Hintergrund der Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung von Frauen*.Die Lebenswelten von Frauen haben sich grundlegend verändert und es bestehen ganz andere Bedürfnisse und Notwendigkeiten als noch vor einigen Jahren.
Sei es die katholische Soziallehre, sei es das Evangelium, sei es ein intrinsisches Gerechtigkeitsbedürfnis und der Wunsch nach Solidarität und Gleichberechtigung: Es gibt sehr viele Ansatzpunkte für einen Frauenverband, im Sinne der Gemeinwohl-Ökonomie zu agieren und für Gleichstellung zu kämpfen. Wenn es darüber hinaus gelingt, die GWÖ damit weiter zu etablieren – vielleicht auch in Bereichen, in denen sie bisher noch keine Rolle spielte – kann dies ein bedeutender Beitrag sein zu mehr Gerechtigkeit, mehr Solidarität und mehr ökologischer Nachhaltigkeit. Und das zum Wohl aller Frauen* und für ein gutes Leben für ALLE. Und das ist doch was, oder?
- Auf eine detaillierte Beschreibung der Ursachen für die Ungleichverteilung wird an dieser Stelle verzichtet.
- Meritorische Güter sind Waren und Dienstleistungen, die sich nicht dafür eignen, über den Markt gehandelt zu werden, denn ein Ausgleich von Angebot und Nachfrage funktioniert nicht. Beispiele dafür sind Umwelt/Klima oder Gesundheitsleistungen.
- Exemplarisch seien hier die Postwachstums- und die Donut-Ökonomie genannt oder die Ansätze für Kehrtwenden im neuen Bericht an den Club of Rome („Earth for All“).
- Eine sehr gute Einführung in die GWÖ gibt das Buch „Gemeinwohl-Ökonomie“ von Initiator Christian Felber und die Website https://germany.econgood.org/ [abgerufen: 16.09.2025].
- Ein Prinzip der GWÖ ist Transparenz – somit können alle Unternehmen, Organisationen und Kommunen auf der Website eingesehen werden.