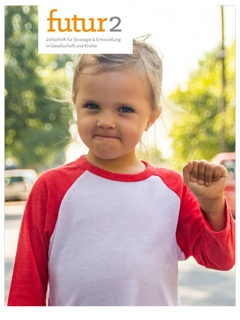Wege zu einer sorgenden Gesellschaft: Modelle für ein zukunftsfähiges Miteinander
1. Die Suche nach dem dritten Weg
Unsere Gesellschaft steckt in einem Paradox: Nie waren die technischen Möglichkeiten für ein gutes Leben für alle größer, nie war das Bewusstsein für globale Herausforderungen ausgeprägter – und gleichzeitig scheinen die bewährten Lösungsmodelle an ihre Grenzen zu stoßen. Der Markt verspricht Wohlstand, produziert aber Ungleichheit und ökologische Zerstörung. Der Staat soll es richten, wird aber zunehmend als träge und bürgerfern erlebt. Die traditionellen Kirchen predigen Nächstenliebe, verlieren aber durch Machtmissbrauch und Hierarchiedenken ihre Glaubwürdigkeit als moralische Instanzen.
Zwischen neoliberaler Vereinzelung und institutioneller Erstarrung wächst eine Sehnsucht nach echtem Miteinander – authentisch, solidarisch, zukunftsfähig. Menschen suchen nach Gemeinschaftsformen, die weder in die Atomisierung des „jeder für sich“ noch in die Bevormundung durch Expertokratien führen. Sie wollen Verantwortung übernehmen, ohne überfordert zu werden. Sie wollen helfen, ohne paternalistisch zu werden. Sie wollen Spiritualität leben, ohne sich religiösen Machtstrukturen zu unterwerfen.
Diese Suche ist nicht romantisch, sondern realistisch. Denn die großen Krisen unserer Zeit – Klimawandel, Demografiewandel, soziale Spaltung – lassen sich weder durch Marktmechanismen noch durch staatliche Verordnungen allein lösen. Sie brauchen eine sorgende Gesellschaft: Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen, ohne dabei einzelne Gruppen zu überlasten oder auszuschließen.
2. Modelle mit Zukunftspotenzial: Caring Communities und Sorgenetzwerke
Die gute Nachricht: Solche Modelle entstehen bereits. Von Caring Communities über Solidarische Landwirtschaft bis zu Bürgerräten experimentiert eine wachsende Bewegung mit neuen Formen des Zusammenlebens. Die Herausforderung: Aus diesen Experimenten ein gesellschaftliches Modell zu entwickeln, das mehr ist als die Summe seiner Teile.
Zwischen neoliberaler Vereinzelung und institutioneller Erstarrung wächst eine Sehnsucht nach echtem Miteinander – authentisch, solidarisch, zukunftsfähig.
Das Netzwerk Caring Communities Schweiz definiert eine Caring Community als „eine Gemeinschaft in einem Quartier, einer Gemeinde oder einer Region, in der Menschen füreinander sorgen und sich gegenseitig unterstützen. Jeder nimmt und gibt etwas, gemeinsam übernimmt man Verantwortung für soziale Aufgaben.“
Caring Communities entstehen dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen – im Stadtteil, im Dorf, in der Nachbarschaft. Anders als die traditionelle Kirchencaritas funktionieren sie nicht nach dem Prinzip „die Guten helfen den Bedürftigen“, sondern nach dem Grundsatz „wir sind alle Teil der Sorge“. Jede und jeder kann gleichzeitig geben und empfangen, je nach Lebenssituation und Fähigkeiten.
3. Risiken und blinde Flecken
Doch bei aller Begeisterung für neue Gemeinschaftsformen wie den Caring Communities dürfen die Schattenseiten nicht übersehen werden. Auch die besten Absichten können zu problematischen Ergebnissen führen, wenn strukturelle Dynamiken nicht mitgedacht werden.
Exklusion trotz Inklusionsversprechen
Caring Communities versprechen Offenheit für alle – aber wer kann sich dieses Engagement tatsächlich leisten? Wer Zeit für Nachbarschaftshilfe hat, wer Energie für Bürgerräte aufbringt, folgt oft einem ähnlichen Profil: gebildet, finanziell abgesichert, zeitlich flexibel. Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen, Alleinerziehende oder Pflegende haben oft schlicht nicht die Ressourcen für zusätzliches Engagement. So entstehen ungewollt neue Formen der Privilegierung. Die „sorgende Mittelschicht“ schafft sich lebenswerte Quartiere, während andere außen vor bleiben.
So entstehen ungewollt neue Formen der Privilegierung. Die „sorgende Mittelschicht“ schafft sich lebenswerte Quartiere, während andere außen vor bleiben.
Neue Formen von Moralismus und sozialer Kontrolle
Wo Gemeinschaft entsteht, entstehen auch Normen – und damit Druck zur Anpassung. In Caring Communities kann ein subtiler Zwang zur Dankbarkeit entstehen: Wer Hilfe empfängt, soll sich „richtig“ verhalten. Diese neue Sittlichkeit versteckt sich hinter dem Anspruch der Gemeinschaftlichkeit und ist dadurch schwerer zu durchschauen.
Alte Muster in neuen Bewegungen
Viele alternative Bewegungen reproduzieren unbewusst Muster, die sie eigentlich überwinden wollen. Da entstehen in Care-Communities informelle Hierarchien zwischen „Gebenden“ und „Nehmenden“, die an paternalistische Armenbetreuung erinnern. Das Problem liegt nicht in den guten Absichten, sondern in unreflektierten Machtstrukturen. Wer definiert, was „gute Sorge“ ist? Ohne bewusste demokratische Kontrolle können auch emanzipatorische Bewegungen zu neuen Formen der Bevormundung werden.
Überforderung und Vereinnahmung
Schließlich droht die Gefahr der systematischen Überforderung. Wenn der Staat sich aus der Daseinsvorsorge zurückzieht und gleichzeitig von Bürgern erwartet, diese Lücken durch Engagement zu füllen, wird aus Solidarität Ausbeutung. Caring Communities werden dann zur billigen Alternative zu professioneller Pflege. Diese Vereinnahmung ist besonders problematisch, weil sie die moralische Autorität der Engagierten nutzt.
Reproduktion religiöser Dominanz
Eine besondere Herausforderung liegt im Umgang mit religiösen Traditionen. Diese verfügen über jahrtausendealte Erfahrungen mit Gemeinschaftsbildung, Sorgearbeit und Sinnstiftung. Diese Ressourcen zu ignorieren wäre töricht. Sie unkritisch zu übernehmen aber ebenso.
Die Deutungshoheit liegt bei denen, die sich engagieren – nicht bei denen, die predigen.
Der Ausweg liegt in der bewussten Säkularisierung religiöser Praktiken. Klöster haben jahrhundertelang gezeigt, wie nachhaltige Gemeinschaften funktionieren – ohne dass man an Gott glauben muss, um von ihren Organisationsprinzipien zu lernen. Kirchliche Diakonie hat Methoden der Sorgearbeit entwickelt – ohne dass man christlich sein muss, um sie zu nutzen.
Wichtig ist dabei die Umkehrung der Machtverhältnisse: Nicht religiöse Institutionen laden gnädig zur Mitarbeit ein, sondern säkulare Bewegungen nutzen selektiv religiöse Ressourcen. Die Deutungshoheit liegt bei denen, die sich engagieren – nicht bei denen, die predigen.
4. Was Menschen wirklich verbindet: Jenseits der Unterschiede
Caring Communities funktionieren nicht trotz, sondern wegen ihrer Vielfalt. Warum? Weil grundlegende menschliche Bedürfnisse universell sind: Respekt, Sicherheit, Zugehörigkeit, das Gefühl, gebraucht zu werden.
Diese Bedürfnisse äußern sich unterschiedlich: Die Klimaaktivistin und der Rentner haben verschiedene Dringlichkeiten, aber beide wollen wirksam sein. Menschen mit Migrationshintergrund bringen andere Gemeinschaftsverständnisse mit – sie kennen sowohl die Stärken enger sozialer Bindungen als auch deren Grenzen. Ihre berechtigte Skepsis gegenüber Inklusionsversprechen ist wichtig, denn sie wissen, wie es sich anfühlt, nicht dazuzugehören.
Unterschiedliche Klassenlagen prägen verschiedene Vorstellungen von gutem Leben: Wer um Existenz kämpft, hat andere Prioritäten als wer nach Selbstverwirklichung sucht. Wer körperlich arbeitet, versteht Solidarität anders als wer im Büro sitzt. Diese Unterschiede sind nicht zu überwinden, sondern anzuerkennen.
Eine Caring Community funktioniert, weil alle mal Hilfe brauchen – egal ob jung oder alt, religiös oder säkular, einheimisch oder zugewandert.
Spiritualität spielt dabei eine besondere Rolle: Post-religiöse Spiritualität sucht Sinn jenseits etablierter Konfessionen und will spirituelle Ressourcen nutzen, ohne Machtstrukturen zu übernehmen. Menschen mit traditionellen religiösen Bindungen bringen jahrhundertealte Erfahrungen mit Gemeinschaftsformen mit. Beide können praktische Weisheit weitergeben – die einen durch neue Rituale, die anderen durch bewährte Strukturen.
Die Stärke von Caring Communities liegt darin, diese verschiedenen Motivationen zu respektieren und trotzdem gemeinsame Ziele zu verfolgen. Ein Nachbarschaftsgarten funktioniert, weil alle gutes Essen wollen – egal ob aus Sparsamkeit, Bio-Überzeugung oder kultureller Tradition. Eine Caring Community funktioniert, weil alle mal Hilfe brauchen – egal ob jung oder alt, religiös oder säkular, einheimisch oder zugewandert.
5. Strategien für den Übergang: Kritischer Pragmatismus
Wie aber können Caring Communities authentisch bleiben und trotzdem politisch wirken? Die Lösung liegt in dem, was sich „kritischer Pragmatismus“ nennen lässt: der strategischen Verbindung von authentischem Engagement und politischer Kritik durch kluge Arbeitsteilung.
Das Prinzip der intelligenten Arbeitsteilung
Die Communities selbst helfen, weil sie helfen wollen. Sie dokumentieren Bedarfe, bauen Vertrauen auf, lösen konkrete Probleme. Ihre Stärke liegt in der Unmittelbarkeit und Glaubwürdigkeit. Gleichzeitig entstehen Netzwerke, die diese praktische Arbeit in strukturelle Kritik übersetzen: „Dass unsere Communities gebraucht werden, zeigt Systemversagen.“
Diese Arbeitsteilung hat mehrere Vorteile: Sie schützt die Communities vor Überforderung. Sie ermöglicht es Menschen, sich zu engagieren, ohne sich politisch verstehen zu müssen. Sie nutzt trotzdem die politische Sprengkraft ihrer Arbeit. So wird aus privater Hilfe politischer Skandal, ohne die Helfenden zu instrumentalisieren.
Strategische Allianzen statt Einzelkämpfertum
Einzelne Communities bleiben Nischen, wenn sie isoliert agieren. Eine strategische Care-Allianz könnte verschiedene Kräfte bündeln: Caring Communities, Transition Towns, Genossenschaften, Bürgerräte. Jede Bewegung bleibt bei ihrer Spezialität, aber gemeinsam entwickeln sie eine umfassende Kritik des gegenwärtigen Systems.
Wie aber können Caring Communities authentisch bleiben und trotzdem politisch wirken?
Historische Beispiele zeigen: Die erfolgreichsten sozialen Bewegungen kombinierten praktische Hilfe und strukturelle Kritik. Die Arbeiterbewegung gründete Genossenschaften UND kämpfte für politische Rechte. Die Frauenbewegung schuf Frauenhäuser UND forderte rechtliche Gleichstellung.
Machtfragen und demokratische Kontrolle
Doch strategische Netzwerke schaffen auch neue Machtstrukturen. Wer spricht „im Namen der Communities“? Diese Fragen müssen von Anfang an mitgedacht werden: durch transparente Entscheidungsprozesse, Rechenschaftspflicht gegenüber den Communities, demokratische Kontrolle. Sonst werden aus heutigen Alternativen die Hierarchien von morgen.
Konfliktfähigkeit als Voraussetzung
Echter gesellschaftlicher Wandel entsteht nicht durch Harmonie, sondern durch produktive Konflikte. Neue Gemeinschaftsformen müssen lernen, Konflikte auszuhalten und zu nutzen. Die Kunst liegt darin, unterschiedliche Bedürfnisse so zu verhandeln, dass am Ende etwas Neues entsteht – statt dass sich die Stärksten durchsetzen.
6. Die Vision einer post-konfessionellen sorgenden Gesellschaft
Eine andere Gesellschaft ist möglich – diese Gewissheit wächst in kleinen Experimenten und großen Visionen gleichermaßen. Die sorgende Gesellschaft, die sich abzeichnet, ist post-konfessionell: Menschen müssen weder an denselben Gott glauben noch dieselbe politische Theorie teilen, um gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Was sie verbindet, ist die Praxis – die gemeinsame Arbeit an lebenswerten Verhältnissen. Diese Gesellschaft baut auf drei Säulen: Authentisches Engagement schafft Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Strategische Vernetzung übersetzt lokale Erfahrungen in politische Macht. Demokratische Kontrolle verhindert, dass aus Alternativen neue Herrschaftsstrukturen werden.
Es braucht strategische Allianzen zwischen verschiedenen Bewegungen. Es braucht Netzwerke, die aus lokaler Hilfe politische Kritik machen. Es braucht die Bereitschaft zum Konflikt mit denen, die von den gegenwärtigen Verhältnissen profitieren.
Doch Transformation ist kein Selbstläufer. Deshalb braucht es mehr als gute Beispiele. Es braucht strategische Allianzen zwischen verschiedenen Bewegungen. Es braucht Netzwerke, die aus lokaler Hilfe politische Kritik machen. Es braucht die Bereitschaft zum Konflikt mit denen, die von den gegenwärtigen Verhältnissen profitieren.
Die sorgende Gesellschaft entsteht durch kluge Arbeitsteilung: Menschen schaffen lokale Alternativen – aus welcher Motivation auch immer. Gleichzeitig entstehen Netzwerke, die diese Arbeit in politischen Druck übersetzen. Die Nachbarin hilft aus Nächstenliebe. Das Netzwerk macht daraus strukturelle Kritik. Niemand muss alles können. Aber alle können beitragen: die einen durch authentisches Engagement, die anderen durch strategische Vernetzung. Die Kunst liegt darin, verschiedene Beiträge so zu verbinden, dass sie sich gegenseitig verstärken. Jeder kann seinen Teil beitragen – mit dem, was er am besten kann.