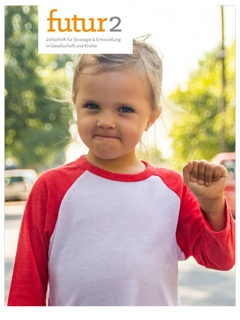Neue Lebenswelten: Zwischen Autarkie und magischen Technologien
Moderne Technologie ermöglicht es den Menschen, autarker zu leben als jemals zuvor. Es ist daher wenig verwunderlich, dass gerade technologisch affine Zukunftsvisionen weniger das Zusammengehen und Zusammenarbeiten von Individuen und Gruppen in neuen Gesellschaften in den Vordergrund stellen und eher eine dezentralisierte Lebenswelt skizzieren, in der das Individuum so leben kann, wie es möchte, und mehr Ellenbogenfreiheit hat. Natürlich stellt sich die Frage, wie autark diese dezentralen Communities tatsächlich sein werden: Hier entsteht durch zentrale Technologien die Möglichkeit, diese Communities auf subtile Art und Weise, „magisch“, zu steuern, ohne dass sie sich dessen bewusst werden.
Sphären & Schäume
In Gesellschaften, in denen von Robo-Bossen geleitete, automatisierte Fabriken und Agri-Tech-Landwirtschaften, die Abdeckung von Grundbedürfnissen übernehmen, werden die Menschen frei, „so zu leben, wie sie wollen“, so das Szenario des Robotikwissenschaftlers Hans Moravec für die 2050er-Jahre. Dieser hatte bei dieser Betrachtung Schweizer Kantone, aber vor allem die arabischen Golfstaaten als Vorbilder im Blick, die durch ihre Öleinnahmen bereits heute asiatische Arbeiter als Robotersubstitute nutzen und so einen sorgenlosen Lebensstil für die Einheimischen ermöglichen.1 Menschen würden sich also mit tendenziell Gleichgesinnten in kleineren, autarkeren Gemeinschaften zusammenschließen und diese den anonymen großen Gemeinschaften bevorzugen, zu denen es immer schwierig ist, eine „direkte und unmittelbare Emotionalität und Motivation“ zu empfinden.2 Im Mittelpunkt dieser Community steht die dezentrale Energieproduktion. „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften“ ermöglichen eine gewisse Autarkie und sind bereits mit heutigen Mitteln durchaus umsetzbar.3 Die Mitglieder dieser „Tribes“ werden trotz Automatisierung produktiv bleiben: Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz, Smart Machines und 3D-Druckern, welche unterschiedliche Produkte „ausdrucken“, produzieren sie für den eigenen Bedarf, aber auch für andere. Diese persönliche Produktion vermeidet zugleich lange Transportwege, Ausschuss und Überproduktion.4 Die Mitglieder der Community werden zudem kreativer: Anstatt nur Musik zu hören, mit Hilfe von KI selbst Stücke zu komponieren und zu editieren, anstatt Filme nur zu konsumieren, selbst als Avatar Rollen in diesen zu spielen. Betrachtungen zu einer autarken Gemeinschaft fanden zuletzt bei Hardt und Negri und ihren Skizzen zu MASCHINISCHEN COMMUNITIES eine neue demokratiepolitische Bewertung als Gegenentwurf zu hierarchischen Gesellschaftsmodellen und Hegemonien.5 Diese Kommunen besitzen die notwendigen Produktionsmittel/Maschinen und sie werden sich mit anderen Gemeinschaften vernetzen, um notwendigen Austausch und Technologieentwicklung zu betreiben (Kleine-Welt-Modell). Für die Schweiz existieren etwa Vorstellungen, welche das Land in sieben Regionen einteilen und ihren jeweiligen Städten, Quartieren und Nachbarschaften neu konfigurierte lokale, industrielle und landwirtschaftliche Kapazitäten sowie Dienstleistungen zuteilen. Diese Skizze beinhaltet auch Architekturen, etwa für zentrale Räume in Zürich und Genf (Metro Foyers), welche Vertretungen anderer Zentren als auch „Inventorien“ und „Kooperatorien“ beinhalten, in welchen öffentliche Projektentwicklungen stattfinden sollen (Abb. 1).6

Abb. 1. Metro-Foyer Zürich. Quelle: neustartschweiz.ch
Moderne Technologie ermöglicht es den Menschen, autarker zu leben als jemals zuvor.
In der Architektur waren mögliche neue Lebensverhältnisse bereits seit den Automatisierungswellen der 1950er und 1960er Jahren thematisiert worden, oftmals jedoch verknüpft mit einer ganz anderen Facette: Es war vor allem das Thema der Abkapselung bzw. Isolierung auffällig. F. Buckminster Fuller entwickelte etwa Kuppeln als Designelemente, unter denen die bedrängte Natur und Menschen leben bzw. überleben werden.7 Ihren Endpunkt fanden diese Designs in der in den 1970er Jahren populären Idee von gigantischen orbitalen Raumstationen, welche Hunderttausenden Menschen eine neue Heimat bieten sollten – dieses Projekt wurde trotz erfolgreicher Vorarbeiten abgeblasen, da die NASA sich für das kostengünstigere Raumshuttle-Projekt entschied.8 Peter Sloterdijk abstrahierte zuletzt derartige Konstrukte, um zu sozialen Konzepten wie schützenden „Sphären“ bzw. „Blasen“ zu gelangen, welche er auch als isolierende Reaktion auf die Globalisierung verstand.9 Und er fügte das eher heitere Element des „Schaums“ hinzu, um eine Verbindung dieser Sphären zu beschreiben: Diese können sich überlagern und sind durchlässig – vergleichbar mit den Blasen in einem Schaum.
In jüngster Zeit werden derartige Projekte vor allem unter dem Label der digitalen Smart-City konzipiert. Schließlich findet eine Vielzahl der Applikationen der Sozialen Medien innerhalb der Community bzw. Nachbarschaft ihr bestes Wirkungsgebiet (z.B. Mobilitätsplattformen).10 Erste Proteste, welche diese Sphären als Einengung empfinden – vor allem Widerstände gegen die sog. 15-Minuten-Stadt, die Wege innerhalb des urbanen Raums reduzieren soll –, machen auf eine weitere Entwicklungsmöglichkeit aufmerksam: Die Community als autonome, aber vor allem elitäre Blase, die sich gegenüber Klimakatastrophen und Migrationsbewegungen bzw. generell Außenstehenden verbarrikadieren kann und in Projekten wie etwa „The Line“ in Saudi Arabien und den Seestädten Peter Thiels ihren Ausdruck findet.11 Die Dezentralisierung verliert hier zunehmend ihre befreiende Konnotation und entwickelt sich zur Idee einer Sphäre, welche zwar autark und vielleicht nachhaltig sein mag, sich aber zugleich vor der Außenwelt verschanzt. Die ultimative Sloterdijksche Blase.
Letztes Abendmahl & Magie
Andererseits konzentriert sich die Entwicklung der Technologien dieser Communities heute zumeist in den Händen weniger Unternehmen, die in den jeweiligen konkurrierenden hegemonialen politischen Machtblöcken angesiedelt sind. Schließlich sind diese Technologien derart kapitalintensiv und komplex, dass ihre Entwicklung – so eine Folgerung aus dem berühmten Marxschen Maschinenfragment – Ergebnis gesamtgesellschaftlicher Investitionen sein muss und hierzu umfassendes, gesellschaftliches Wissen (General Intellect) kapitalisiert wird, welches global nicht gleich verteilt ist.12 Digitale Landwirtschaftssysteme sind hier ein Beispiel für monopolistische Technologien, welche sich über dezentrale Communities wölben: Dem Bauern wird über eine App eine tagesaktuelle Satellitenauswertung mitgeteilt, welche anzeigt, welches Feld jetzt zu bewässern und zu düngen ist. Im Gegenzug für die Informationen, welche etwa in Indien über Microsoft bereitgestellt werden, müssen dann online Dünger von BASF gekauft werden. In China sind ähnliche Strukturen und Technologien im Einsatz: Hier wird die bäuerliche Kommune zentral von einem staatlichen Unternehmen (Syngenta) mit Daten, Ratschlägen und chemischen Produkten versorgt.13
Die Investitionen in diese Technologie können riesenhaft sein und verlangen dann nach überschaubaren und kontrollierbaren Strukturen. Ein historisches Vorbild hierfür liefert die sog. „Last Supper“-Strategie. Diese basiert auf einem Abendessen des amerikanischen Verteidigungsministers im Pentagon mit Rüstungsvertretern im Juli 1993, bei dem er seinen erstaunten Gästen verkündete, dass er von ihnen erwartet, dass sich ihre Unternehmen zusammenschließen und so die Schaffung besser steuerbarer, quasi-monopolistischer Strukturen in der Industrie den Weg ebnen würden: Die Zahl der Rüstungspartner wurde schließlich von 51 auf fünf reduziert.14
Dabei werden quasi „magische“ Technologien eingesetzt, welche völlig neue Formen der Bewusstseinsbeeinflussung und -manipulation ermöglichen (Psyop-Kapitalismus).
Trotz der Möglichkeiten der Dezentralisierung wird der Nationalstaat wohl keinesfalls überflüssig sein. Er müsse sich jedoch – so die Befürworter der Dezentralisierung – transformieren und zum „Befähiger“ und „Partner“ der Community werden, auch wenn – oder gerade, weil – er bereits unter Druck steht.15 Die Zentralisierung technologischer Entwicklung wird dann zu einer Verschmelzung/Annäherung von staatlichen Strukturen und Technologieunternehmen führen können. Die resultierende TECHNOKRATIE kann zwar weiterhin demokratische Grundstrukturen aufweisen, hat allerdings bestimmte zusätzliche Charakteristika: In der Technokratie werden Positionen zunehmend „nominiert“ und Experten haben eine gewichtige Rolle; schließlich gilt es Probleme unparteiisch durch wissenschaftliche und technische Lösungen anzugehen.16 In diesem auf Lösung und Leistung fokussierten System spielt deshalb die Meritokratie eine zunehmend wichtige Rolle, was zwangsläufig zur Unterteilung der Bevölkerung in „Smarte“ bzw. „Leistungsfähige“ und diejenigen, die es trotz Zugang zu Bildung „eben nicht geschafft haben“ („Deplorables“), führen wird. Es werde – so ein Kritiker – den „unteren Schichten“ dann zwar vielleicht Gerechtigkeit angeboten, es fehlt jedoch an Wertschätzung und sozialer Anerkennung, was zu Spaltungen in der Gesellschaft führen wird.17 Um diese Spannungen und generell Widerstände zu minimieren und handlungsfähig zu bleiben, ist erwartbar, dass Staaten Technologie auch zur Unkenntlichmachung von etwaigen Widersprüchen für den Einzelnen, also zur „unsichtbaren“ Beeinflussung eines vorgeblich autarken, kreativen und selbstbestimmten Individuums verwenden werden. Dabei werden quasi „magische“ Technologien eingesetzt, welche völlig neue Formen der Bewusstseinsbeeinflussung und -manipulation ermöglichen (Psyop-Kapitalismus). Wenn etwa KI eine Partnerin und Ratgeberin des Menschen in allen Lebensbelangen werden soll, wird sich die Technik auf das Individuum einstellen müssen, um personalisierte Vorschläge zu machen.18 Dieser „Lebenspartner“ gehört allerdings nicht dem Individuum, sondern den Technologiekonzernen. So ist es erwartbar, dass sich deren Interessen auch in den Ratschlägen widerspiegeln können: „Eines Tages wird dein Avatar etwa zu dir sagen, ‚Du siehst schlecht aus, proprobiere doch einmal diesen Monster Energy Drink …‘“.19
Ein offenes Rennen?
Das Verhältnis zwischen zentralen und dezentralen Ebenen wird abhängig von zwei Ereignissen sein: Einerseits des Wettrennens zwischen dem digital aufgewerteten Individuum und der technologischen Kontrolle/Manipulation: Vielleicht, aber nur vielleicht, ist Technologie diesmal so mächtig, dass die digitale Befähigung des Individuums zur selbstbestimmten Assoziation und Counter-Culture nicht mehr unterdrückt werden kann. Technologie wäre dann eine Art automatisierter Revolutionsagent: „Was passiert, wenn jeder von uns das Äquivalent des klügsten Menschen für jedes Problem in der Tasche hat?“20 Andererseits zwischen dem Kampf um das Eigentum an Technologie. Das Bestreben der Hegemonien, Technologie zu monopolisieren, würde einer wirklichen Dezentralisierung entgegenstehen. Und würde die Klimakrise nicht eine Bündelung und Zentralisierung von Ressourcen und Macht verlangen? André Gorz war sich bei den ersten Betrachtungen zur Umweltpolitik in den 1970ern klar, dass es hier nur zwei Möglichkeiten gäbe: Entweder assoziiert sich das Individuum selbst oder ein übermächtiger Staat muss die notwendigen Anpassungen an die Klimakrise diktieren.21Vielleicht, aber nur vielleicht, ist Technologie diesmal so mächtig, dass die digitale Befähigung des Individuums zur selbstbestimmten Assoziation und Counter-Culture nicht mehr unterdrückt werden kann.
- Hans Moravec, Robot. Mere Machine to Transcendent Mind. New York 1999, S. 137ff.
- Dieter Claessens, Das Konkrete und das Abstrakte, Frankfurt/M. 1980, S. 17.
- Kohai Saito, Systemsturz. Der Sieg der Natur über den Kapitalismus, München 2023, S. 193. Dieser Umbau wird eine „neue“ Phase des Kapitalismus einleiten, da die Form der Energieproduktion auch die gesellschaftlichen Strukturen beeinflusst: Jeremy Rifkin, The Third Industrial Revolution. How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World, New York 2011, S. 36.
- Zu diesen „persönlichen Produktionen“ bereits: André Gorz, Ecology As Politics. London 1976.
- Michael Hardt & Antonio Negri, Assembly. Die neue demokratische Ordnung, Frankfurt/M. 2018. Weitergedacht kämen für Hardt & Negri wohl Regierungsformen wie direkte Demokratie oder basisdemokratische Strukturen, kommunale Selbstverwaltung, netzwerkbasierte Governance, technokratische oder algorithmische Verwaltung, aber auch Hybridformen in Frage. Letztlich sind der möglichen Vielfalt bei technologischer Autarkie aber wenig Grenzen gesetzt und sie sind auch abhängig von historischen Einflüssen bzw. Erfahrungen und den Persönlichkeiten ihrer Mitglieder. Es könnte in Anlehnung an Philip J. Farmers „Flusswelten“-Zyklus genauso gut zu theokratische Enklaven, kultischen Persönlichkeitsregimen bis hin zu posthumanen Experimenten kommen, in denen die menschliche Regierung ganz aufgeben wird und Entscheidungen komplett an eine autonome Maschine delegiert, die als „Instanz“ akzeptiert wird. Beispiel: Eine Community lässt eine KI die Nahrungsproduktion steuern und akzeptiert ihre „Urteile“ als Gesetz. Generell kritisch gegenüber derartigen Communities: Slavoy Žižek, Der Mut der Hoffnungslosigkeit, Frankfurt/M. 2017, S. 80ff., welcher hier die Gefahr direkter Herrschaftsbeziehungen erkennt, im Gegensatz zu Marktbeziehungen, welche indirekte, unsichtbarere Herrschaft ausüben.
- Neustart Schweiz, Nachbarschaften entwickeln, in: Neustartschweiz.ch (o.D.).
- Vgl. Douglas Murphy, Last Futures. Nature, Technology and the End of Architecture, London 2022.
- Gerard K. O’Neill, The High Frontier. Human Colonies in Space, New York 1976.
- Peter Sloterdijk, Sphären III, Schäume. 2004 Frankfurt/M.
- Letztlich liegt hier ja der Kern der Demokratie: „Democracy must begin at home, and its home is the neighborly community.“ John Dewey, The Public and its Problems, Athens/Oh. 2016, S. 229.
- Ayad Al-Ani: In Zukunft könnte es Unternehmensstaaten geben, in: zeit.de, September 2015.
- Christian Lotz, Karl Marx. Das Maschinenfragment, Hamburg 2014, S. 10. Žižek (a.a.O., S. 79) erkennt natürlich richtig, dass Marx die Privatisierung der gesellschaftlichen Intelligenz durch Google etc. nicht voraussah.
- Grain, Techno Feudalism Takes Root on the Farm in India and China, in: grain.org, 24.10.2024.
- Mit aktuellen Bezügen: Noah Robertson, The Pentagon Wants Industry to Transform Again to Meet Demand. Can It?, in: defensenews.com, 20.02.2024. Zu Entsprechungen in der KI-Industrie vgl. Interviews von Marc Andreessen etwa bei JRE (26.11.2024, 02:27:57).
- “The transformed state becomes the enabler of cosmo-localism (…). It creates multistakeholder
coalitions that support domain-specific mutualization and localization efforts.“ P2P Wiki, Twitter Thread on the Role of the State in a Commons-Centric Society, in: wiki.p2pfoundation.net - Neil Postman, Technopoly. The Surrender of Culture to Technology, New York 1992, S. 31, hatte die „Unterscheidung zwischen moralischen und intellektuellen Werten“ als eine der wesentlichen Säulen der Technokratie definiert. Zu demokratisch-technokratische Strukturen in den USA: Parag Khanna, Technocracy in America. Rise of the Info-State, o.O. 2017.
- Michael J. Sandel, Vom Ende des Gemeinwohls: Wie die Leistungsgesellschaft unsere Demokratien zerreißt, Frankfurt/M. 2020, S. 329.
- Für das Beispiel der KI als religiöse Ratgeberin: Ayad Al-Ani & Martin Lätzel, KI als neue Religion, in: Stimmen der Zeit, Heft 7 Juli 2024, S. 485ff.
- Trevor Paglen, You’ve Just been Fucked by Psyops, in: Media.ccc.de, 27.12. 2023.
- Vgl. Brian Willems, Automating Economic Revolution: Robert Heinlein’s The Moon is a Harsh Mistress, in: William Davies (Hrsg.), Economic Science Fiction, London 2018, S. 73–93. Das Zitat ist von Eric Schmidt: Office Chai, Vast Majority of Programmers Will be Replaced With AI Programmers in a Year, in: Officechai.com, 15.04.2025. Diese „Versorgung“ des Individuums mit maschinischer Hilfe wird seitens des Silicon Valleys auch als eine Art „Grundeinkommen“ betrachtet (Universal Basic Compensation): Kevin Okemwa. Microsoft’s AI CEO Mustafa Suleyman Says We Won’t Need Hard Dollars in the AI Era – Intelligence Will Be the Next Currency, in: Windowscentral.com, 17.4. 2025.
- Gorz (a. a. O., S. 15). Er war hier möglicherweise auch von den erstaunlichen Bemerkungen des Historikers der industriellen Revolution, Karl Polanyi, beeinflusst, welcher in seiner Betrachtung eine derartige widersprüchliche Rolle des Staates früh erahnte: Indem der Schutz der Natur wichtiger würde, könnten Freiheiten eingeschränkt werden. Polanyi plädierte dann auch für „Blasen“ des Widerstandes: „Compulsion should never be absolute. The ‘objector’ should be offered a niche to which he can retire …” Karl Polanyi, The Great Transformation, London 1944, S. 371.