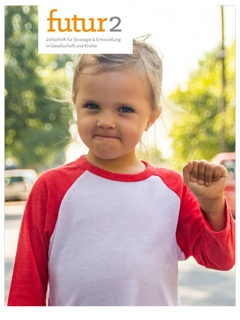Mit der Freiheit umgehen. Von der Aufgabe der Kirche für eine begründete Hoffnung
Spätestens seit Pegida ist der Osten der Problembär der Nation. In der Öffentlichkeit als rechts gebrandmarkt, bestätigen regelmäßig Übergriffe und AfD-Wahlerfolge, wie schlimm es um den Osten steht. Tatsächlich ist es eine Region, die seit einigen Jahren um den gesellschaftlichen Zusammenhalt ringt. Es ist ein Landstrich, der wie ein Vulkangebiet ist – mit seinen Vulkanschloten, die ausbrechen, und jener Magma-Schicht, die heiß und brennend zu Tage bricht, wo die bedeckende Oberfläche für Risse empfindlicher ist. Wo aber auch manche ein Interesse daran haben, dass der Druck unter der Oberfläche steigt.
In Ost wie West dürfte ein Phänomen gleichermaßen raumgreifend sein und als Ursache benannt werden: Unser Leben in der Moderne bedeutet auch Enttraditionalisierung. Normative, fest vorgegebene Formen, wie das Leben zu führen ist, gehen verloren. Es erfolgt eine Freisetzung, die von vielen als Selbstbestimmung erlebt wird. „Ich darf mich entscheiden“ wird zum zentralen Faktor. Dies gilt eben auch für das Sittengebäude. Mag dies auch für Umstehende und Institutionen als schmerzhaft empfunden werden, bedeutet ein solcher Bruch mit Milieugewohnheiten eine Enttraditionalisierung zugunsten eines Gewinns an Freiheit und Autonomie. Aber – und der Punkt gehört eben auch mit dazu – alles der Verantwortung des Einzelnen zu überlassen, ist einerseits ein wunderbarer Zugewinn an Freiheitsgestaltung und Lebensoptionen.
Aber andererseits steigt gleichzeitig der Entscheidungsdruck, wie ich leben will und wofür ich mich entscheide. Die gewonnene Freiheit auf Dauer gestellt wird sich rasch für den Einzelnen als eine enorme Anforderung herausstellen. Es gibt keine Lebensentscheidung elementarer Art, die nicht immer überfrachtet ist von der Frage „Wie entscheide ich mich?“ Damit heißt es aber auch: Ich habe es – unvertretbar – zu verantworten. Wer ein Leben in Freiheit führen will, entkommt der Freiheit nicht. Weil alle Entscheidungen, die ich treffe, meine Wahl und mein Willensentschluss sind. Und selbst „Das sollen andere entscheiden“ ist meine Entscheidung, die Verantwortung abzugeben.Spätestens seit Pegida ist der Osten der Problembär der Nation.
Gesamtgesellschaftlich bedeutet Individualisierung das anstrengende Aushalten mit Blick auf die vielfältigen Lebensmodelle, die einem sehr fremd sind und die man nicht teilt – aber die man in einem normativen Pluralismus ertragen muss, weil es niemanden mehr gibt, der zentral vorzugeben hat, wie wir gemeinsam leben.
Der Kipppunkt, der zur Krise führt, ist sozusagen eine Überdehnung der Pluralität unseres Zusammenlebens. Dies ist kein Vorwurf, sondern eine Beschreibung der Situation. Durch diese Überdehnung wird aber die Frage des Zusammenhalts zu einer offenen Frage. Denn keiner Institution wird es mehr zugestanden, eine verbindliche Antwort auf die Frage zu geben, worauf unsere kollektive Identität beruht und was uns verbindet. Der Wertehimmel ist nicht mehr der Gemeinsame. Die Kirchen verlieren in diesem Prozess ihre weltanschauliche Deutungshoheit. Und sie verlieren ihre Gestaltungsmacht zur sozialen Integration. Immerhin haben wir es gleichzeitig in der Moderne mit einem Zerfall metaphysischer, kultureller und religiöser Weltbilder zu tun. Wir haben nicht mehr die normativ eine vorgegebene Kultur. Folglich sind aber auch die Ordnungsvorstellungen, die Werte und die orientierungsgebenden Leitideen, die wir haben, um ein bewusstes Leben mit Bewandnis zu führen, nicht mehr eindeutig, sondern ebenso pluralisiert.
Diese Situation ist genau diejenige, die man als Überforderung der individuellen Freiheit bezeichnen muss. Die Krise unserer Demokratie ist im Wesentlichen eine Krise der Freiheit. Das Individuum ist mit der subjektiven Wahrnehmung und Inanspruchnahme der Freiheit überfordert. Auch der Staat ist nicht der autoritäre Bevormundungsstaat, der uns vorschreibt, wie wir zu leben haben. Sondern er ist das Regulativ unserer Freiheit. Das ist seine einzige Aufgabe. Das bedeutet aber auch, dass der Staat nicht garantieren kann, welche Traditionen für uns wichtig sind oder wie wir zu leben haben. Die Selbstbeschränkung des Staates, die er sich an dem vulnerablen, prekären Punkt auferlegt, ist eine Selbstbeschränkung zugunsten der Freiheit des Einzelnen. Die Selbstbeschränkung des Staates als Ordnungssystem zugunsten der Freiheit beschränkt auch seine Möglichkeiten, für Halt und emotionale Sicherheit zu sorgen. Rechtssanktionen und Zwangsbefugnisse sind Instrumente des Staates für die Erhaltung der Freiheit. Die stärkste Waffe des Rechtsstaates ist die Rechtssetzung und -durchsetzung.Die Krise unserer Demokratie ist im Wesentlichen eine Krise der Freiheit. Das Individuum ist mit der subjektiven Wahrnehmung und Inanspruchnahme der Freiheit überfordert. Auch der Staat ist nicht der autoritäre Bevormundungsstaat, der uns vorschreibt, wie wir zu leben haben. Sondern er ist das Regulativ unserer Freiheit. Das ist seine einzige Aufgabe.
Gilt dies als Zeitbefund für die gesamte Bundesrepublik, braucht es einen spezifischen Blick auf die von der DDR geprägten Menschen. In Sachsen wird seit mehreren Jahren der Sachsenmonitor erstellt, der letztlich ein Trendmonitor für gesellschaftliche Stimmungen im Freistaat ist.1 Im zuletzt veröffentlichten Sachsenmonitor aus dem Jahr 2023 zeigt sich eine ausgeprägte Ambivalenz mit Blick auf das Demokratieverständnis und die politischen Einstellungen: Die Demokratie als Regierungsform wird überwiegend bejaht, gleichzeitig ist das Vertrauen in deren praktische Ausgestaltung und die politischen Institutionen deutlich gesunken. 83 Prozent der Sachsen halten die Demokratie für eine gute Regierungsform. Die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie liegt jedoch nur bei 41 Prozent für Deutschland. Das Vertrauen in die Landesregierung ist auf 44 Prozent gesunken, ebenso in den Landtag (44 Prozent); dem Bundestag vertrauen nur noch 23 Prozent der Sachsen. Parteien genießen nur noch bei 10 Prozent großes Vertrauen; 46 Prozent der Befragten können keiner der existierenden Parteien Sympathie entgegenbringen. 63 Prozent finden, dass der Mehrheitswille der Bevölkerung auch gegen Gerichte und das Grundgesetz durchgesetzt werden sollte. Im Vergleich zur vorangegangenen Erhebung im Jahr 2021 zeigen alle Werte eine erhebliche Verschlechterung. Auffällig sind jedoch die Daten zur Identität als Ostdeutsche: 86 Prozent der Befragten sind stolz auf das, was seit 1990 in Sachsen erreicht wurde. Dabei ist der Stolz unabhängig vom persönlichen Maß an Zufriedenheit, Alter oder Bildungsabschluss sehr breit getragen. Die historische Bewertung als Unrechtsstaat hat zugenommen: 60 Prozent aller Befragten stimmen zu, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung wünscht sich, dass deutschlandweit stärker über die Umbrüche und Erfahrungen nach der Wiedervereinigung gesprochen wird. Die Zahlen lassen den Schluss zu, dass die Menschen im Osten der Republik nicht die DDR zurückwollen, aber sich zu wenig in den Strukturen und Mechanismen der Bundesrepublik angenommen fühlen.
Der Bruch (von 1989) hat eine Dynamik entwickelt, der die Identitätsfrage neu aufwirft. Dies hilft, die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern vorschnell zu stigmatisieren, wie es in den vergangenen Jahren oft artikuliert wurde.2 Im Konglomerat der Ursachen für die Resonanz auf Thesen populistischer Parteien sind dabei folgende Beobachtungen besonders in den Blick zu nehmen sowie Antwort-Möglichkeiten christlicher Theologie:
- Ein System- und Wertewandel ist für die Ostdeutschen keine erfahrungsleere Warnung, sondern ein in der eigenen Biografie zutiefst verankerter Prozess. Schon einmal erlebten die Menschen die Veränderung der eigenen Heimat in einem Maß, das über die eigenen Anpassungswünsche hinausging und sich der eigenen Kontrolle ab einem gewissen Punkt entzog. Mit der Flüchtlingskrise und den daraus erwachsenden Wahrnehmungen erhalten solche Verlustängste eine Renaissance. Das Gefühl der Machtlosigkeit angesichts der ‚von oben‘ verordneten Veränderungen äußert sich in Form – übrigens nicht erst 2015 während der Migrationskrise, sondern bereits vorher 2003/4 während der Veränderungen der Hartz-reformen. Aber auch die Krisen der vergangenen Jahre, vor allem der gesellschaftliche Umgang mit Corona und die Positionierung im Ukraine-Krieg sind dafür Beispiele.
Die Theologie hat in ihrer begründeten Hoffnung auf das schon angebrochene Reich Gottes die Möglichkeit, mit ihrem Handeln eine verbindliche Hoffnung zu vermitteln, die einen staatlich vorgegebenen wie auch individuellen Horizont übersteigt. Dabei kann es nicht nur um eine Stärkung der Glaubenden gehen, sondern um eine stete Bereitschaft, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach dieser Hoffnung fragt. Andererseits ist es eine zentrale Aufgabe der pastoralen Mitarbeiter, in allen innerkirchlichen – notwendigen – Strukturprozessen die Verunsicherung durch sich verändernde Verantwortlichkeiten zu vermeiden, um einen weiteren Heimatverlust zu erzeugen.
Politische Entscheidungsprozesse konnten nicht Step by Step erlernt und verstanden werden. Fertig ausgebildete Strukturen wurden nach 1989 übernommen. Mit dem Systemwandel stand die Bevölkerung der ehemaligen DDR damit vor der Herausforderung, im alltäglichen Handeln die Notwendigkeit, Regeln und Verhaltensweisen der völlig anderen, sehr von sich überzeugten und rechtlich hoch komplizierten bundesdeutschen Ordnung zu verstehen und für ihr Leben zu transferieren. Hinzu kam die Fremdheit des politischen Prozesses des deliberativen, langwierigen Interessenausgleichs.Um aber in der aktuellen Situation die Akzeptanz für die demokratischen Entscheidungsprozesse zu fördern, kann es zum Dienst der Kirche werden, partizipative Prozesse mit den verschiedenen Gruppen der Gesellschaft einzuüben.
Weil die Kirche die freiheitliche Demokratie als die beste aller Staatsformen anerkannt hat, kommt ihr auch die Aufgabe zu, sich in ihr zu engagieren und für sie zu werben. Es kann nicht darum gehen, einzelne Parteien zu (dis-)qualifizieren, sondern sie aus der Perspektive des christlichen Menschenbilds für ein Engagement zugunsten der Menschenwürde, der daraus resultierenden Menschenrechte und des nachhaltigen und solidarischen Gemeinwohls zu motivieren. Um aber in der aktuellen Situation die Akzeptanz für die demokratischen Entscheidungsprozesse zu fördern, kann es zum Dienst der Kirche werden, partizipative Prozesse mit den verschiedenen Gruppen der Gesellschaft einzuüben und dafür notwendige Bildungsangebote zu unterstützen sowie eigene Entscheidungsstrukturen auf die partizipative – synodale – Verwirklichung hin zu überprüfen.
Hans Joachim Meyer erläutert, dass viele Ostdeutsche nach ersten Enttäuschungen aufgegeben haben, sich in das (vor-)strukturierte Spiel ‚Demokratie’ einzubringen und damit Energie und Augenmaß, Ausdauer und Konfliktbereitschaft, kommunikative Kompetenz und Argumentationsfähigkeit zu investieren.3 Aber gerade im realen Sozialismus blieb die Fähigkeit zur öffentlichen Kommunikation unterentwickelt, was nach der Wiedervereinigung spürbar auffiel. Bis heute halten sich Ostdeutsche im politischen Engagement auffällig stark zurück und scheuen sich vor der Übernahme öffentlicher Aufgaben. Zugleich wird zunehmend kritisiert, dass herausragende gesellschaftliche Positionen für Menschen aus den Neuen Bundesländern immer noch schwerer zu erreichen sind, weil Westdeutsche weiterhin auf Führungspositionen in Ostdeutschland folgen. Dies schließt jedoch die Bürger von wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Gestaltungsmacht weiterhin aus.Es geht daher also nicht nur darum, das Evangelium auf mitteldeutsch zu buchstabieren, … sondern die Menschen guten Willens zu ermutigen, sich in das (vor-)strukturierte Spiel ‚Demokratie’ hineinzubegeben und in der öffentlichen Kommunikation eigene Positionen deutlich zu vertreten.
Der christliche Glaube lebt aus der Tat, aber eben auch in besonderer Weise aus dem Wort. Ist es einerseits Aufgabe der Kirche, ihre Verkündigung immer wieder auf die sprachliche Anschlussfähigkeit gegenüber der Welt zu überprüfen, kommt es den Christen ebenso zu, prophetisch das Wort zu erheben. Dass dies nicht von allein geschieht, berichten zahlreiche biblische Berichte. Es geht daher also nicht nur darum, das Evangelium auf mitteldeutsch zu buchstabieren, wie es vor einigen Jahren der inzwischen emeritierte Bischof von Erfurt Joachim Wanke forderte, sondern die Menschen guten Willens zu ermutigen, sich in das (vor-)strukturierte Spiel ‚Demokratie’ hineinzubegeben und in der öffentlichen Kommunikation eigene Positionen deutlich zu vertreten.- Mit der Wiedervereinigung wurden etablierte westdeutsche Narrative übernommen, die sich in den zurückliegenden Jahrzehnten dort herausgebildet haben, aber von den Ostdeutschen nur schwer nachvollzogen werden können. Hierzu gehört aus christlicher Perspektive die starke Prägung der Würde des Menschen als Reflexionsebene gegen Nationalismus und Rassismus. Aber auch die Erfahrungen der ‚68er’ fehlen in einem Land, das im gleichen Jahr mit dem Prager Frühling eine Einengung der gesellschaftlichen Freiheit erlebte. Die Weitergabe von solchen biografischen Erfahrungen geschieht weniger durch Gesetze als durch eigenes Reden und Handeln. Mit dem Austausch der DDR-Eliten in Legislative, Judikative und Exekutive als auch in Wirtschaft und Medien durch westdeutsche Experten gelang zwar der Wissenstransfer und ein rascher wirtschaftlicher sowie administrativer Transformationsprozess, jedoch unterband dies zugleich auch die weitere Tradierung ostdeutscher Erfahrungen. Kaum eine Folge der Transformation nach der Wiedervereinigung dürfte so ambivalent sein und die sich entwickelnde Ostalgie sowie einen subjektiven Minderwertigkeitskomplex befördert haben, der viele Ostdeutsche nach ihrer Identität in einem vereinten Deutschland suchen lässt.
Kirchliche Räume waren nicht erst während der Friedlichen Revolution Orte freien Denkens, sondern bereits in den Jahrzehnten zuvor. Es gibt daher eigene Narrative von der Sehnsucht nach Freiheit, die es sich zu erzählen lohnt, ohne in eine Ostalgie oder Abgrenzung gegenüber anderen Bürgerinnen und Bürgern zu verfallen. Sie dürfen aber nicht andere Erfahrungen verdrängen, sondern sich gegenseitig bereichern. 35 Jahre nach der Wiedervereinigung gehört es – glücklicherweise – zur gesellschaftlichen Realität, dass Menschen mit Erfahrungen aus allen Landesteilen der Republik in Ostdeutschland leben. Deswegen muss die Kirche ihre Stimme erheben, wo die gesellschaftliche Suche nach Identität zur patriotischen Abgrenzung von ‚uns Ostdeutschen’ gegen ‚den Rest der Welt’ geschieht.
Mit dem Systemwandel einher ging eine Differenzierung in Gewinner und Verlierer der Friedlichen Revolution. Dies bezieht sich einerseits auf die wirtschaftliche Dimension, weil in den Anpassungsprozessen der ostdeutschen Wirtschaft in den 1990er Jahren ganze Familien durch Arbeitslosigkeit und den Verlust von eigentlich erwarteten Ansprüchen wie etwa bei Sozialleistungen ihren wirtschaftlichen Halt verloren. Damit einher ging ein sozialer Rückzug. Die sich daraus perpetuierende Spannung materieller Unterschiede förderte eine Haltung der Missgunst und des Neids, bei dem Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und Personen mit subsidiärem Schutz aufgrund der ihnen zuerkannten Leistungen als weitere Konkurrenten gelten. Das Problem war nicht die Hilfsbereitschaft gegenüber den Notleidenden, sondern die dadurch entstehende Verletzung des Gerechtigkeitsgefühls verbunden mit einem diffusen Gefühl des Zukurzkommens.Gerade für jene Familien aber, deren wirtschaftlicher Verliererstatus sich verfestigt und über Generationen inzwischen verfestigt hat, kommt der Pastoral eine dreifache Aufgabe zu.
Zur wirtschaftlichen Perspektivlosigkeit kam aber auch eine ideelle Differenzierung. Wer wenige Monate zuvor noch auf der gesellschaftlichen ‚Sonnenseite’ stand, erlebte nach der Friedlichen Revolution eine neue gesellschaftliche Skepsis gegenüber der eigenen Lebensleistung. Jene aber, die während der DDR für ihre Überzeugungen Nachteile in Kauf nahmen und denen es gelang, sich in dem neuen System zurecht zu finden, konnten sich zu den Gewinnern der Friedlichen Revolution zählen.
Die Christen in den Bistümern haben vielfach von den Chancen, die sich auch wirtschaftlich aus der Friedlichen Revolution ergaben, profitiert. Teilweise profitierten die durch die Gemeinden ausgebildeten Netze, um sich gerade in den Transformationsprozessen gegenseitig zu tragen. Mit der Möglichkeit, dass sich soziale Einrichtungen der Caritas frei entwickeln konnten, nahm die Kirche in den letzten Jahrzehnten auch ihre diakonische Aufgabe auf neue Weise wahr. Gerade für jene Familien aber, deren wirtschaftlicher Verliererstatus sich verfestigt und über Generationen inzwischen verfestigt hat, kommt der Pastoral eine dreifache Aufgabe zu: Zum einen, die Sensibilität für sie wach zu halten und die nötige Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten, zum zweiten darauf hinzuwirken, dass sich Ungerechtigkeit nicht verfestigt und Strukturveränderungen als Anwalt dieser Betroffenen zu werden, sowie drittens jenen, die zutiefst von einem materialistischen Weltbild geprägt sind und deren prekäres Wirtschaftsverhältnis dafür umso einschränkender wirkt, ein Gespür für die eigene, tragende Hoffnung zu geben. Dabei stehen die Gemeinden in Ostdeutschland vor der enormen Herausforderung, über Jahrzehnte gepflegte Ablehnungen und Verurteilungen gegenüber Menschen, die im System der DDR zu den Gewinnern gehörten, abzulegen und den Dialog mit ihnen zu suchen. Es geht hierbei nicht um die Verharmlosung – vielfach am eigenen Leib vieler Christen – erlebter Schuld, sondern um den barmherzigen Umgang im Wissen um die letzte Unverfügbarkeit gerechten Handelns.
Religiöse und kulturelle Vielfalt sind in Ostdeutschland auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung noch fremd. In den Neuen Bundesländern besitzt beispielsweise die Diskussion um einen Sprachkurs im Vorschulalter keine Relevanz, weil dies in den meisten Städten nicht zur Erfahrung ostdeutscher Familien gehört. Nicht selbst erlebt, kennen sie die Probleme und Herausforderungen nur aus den Medien und politischen Diskursen. Da dort aber die Situationsbeschreibung eine Zuspitzung erfährt, werden auch die Probleme vielfach übersteigert wahrgenommen, während für die Chancen einer kulturell pluralen Gesellschaft die Wahrnehmungskraft fehlt. So fremd vielen Menschen der Islam oder andere religiöse Praktiken sind, so fremd sind ihnen oftmals auch die eigenen religiösen Wurzeln. In einem Landstrich, in dem nur noch maximal ein Viertel der Bevölkerung getauft ist und bereits über mehrere Generationen jeglicher Kontakt zum Christentum verloren gegangen ist, erscheint eine bislang kulturell nicht beheimatete Religion als Fremdkörper, der – insofern er sich auch innerhalb der Gesellschaft durch Zeichen und Rituale äußert – als gesellschaftlicher Rückschritt empfunden wird. Hatte doch die DDR-Regierung über vierzig Jahre das Ende des Aberglaubens und der Religion propagiert, indem sie dem Glauben die Vernünftigkeit abgesprochen hatte. In Ostdeutschland geht es daher nicht um die Frage der ‚wahren Religion’ oder einer Sehnsucht nach der künftigen kulturprägenden Existenz des Christentums. Stattdessen bietet die Wiederkehr des Religiösen an sich im öffentlichen Raum innerhalb einer nachreligiösen Gesellschaft das Konfliktpotential.Angesichts der Konzilsdokumente Lumen Gentium und Nostra Aetatae kommt der Pastoral gerade in Mitteldeutschland die Aufgabe zu, das Wissen um die eigene Religion, aber auch um die anderen Religionen zu stärken.
Das (Nicht-) Wissen um andere Religionen und die damit einhergehende Angst unterscheidet sich in den katholischen Gemeinden kaum vom Rest der Gesellschaft. Angesichts der Konzilsdokumente Lumen Gentium und Nostra Aetatae kommt der Pastoral gerade in Mitteldeutschland die Aufgabe zu, das Wissen um die eigene Religion, aber auch um die anderen Religionen zu stärken, damit die Christen verkürzte Sichtweisen in einer weitgehend postmodern-unreligiösen Gesellschaft entlarven, die in den anderen Religionen göttliche Wahrheit aufleuchten lassen und im Dialog mit anderen Positionen ihre Sichtweise argumentativ belegen können.
Christinnen und Christen können mit ihrem Vertrauen auf Transzendenz einen entscheidenden Beitrag inmitten einer polarisierten Gesellschaft leisten. Es geht um die Verwirklichung eines auf dem christlichen Glauben fußenden Menschenbilds. Und um die Annahme der Lebenswirklichkeit vor Ort, die aus der Erfahrung von Generationen gespeist ist. Wer sie übergeht, wird die Polarisierungen im Land nicht abbauen können. Letztlich sollten dafür Christen mit Orten der Intellektualität und Spiritualität Möglichkeiten schaffen, wo sich Menschen begegnen, ihr Bild vom Menschen ins Hier und Jetzt übersetzen sowie ihre Vorstellungen von Verantwortungsübernahme inmitten der Freiheit einüben können. Denn weder Staat noch Kirche können dem Einzelnen abnehmen, was die liberale Gesellschaft im 21. Jahrhundert täglich fordert: Entscheidungen zum Guten.Christinnen und Christen können mit ihrem Vertrauen auf Transzendenz einen entscheidenden Beitrag inmitten einer polarisierten Gesellschaft leisten.
- Vgl. im Internet: https://www.staatsregierung.sachsen.de/sachsen-monitor-2023-8897.html (abgerufen am 30. September 2025). Alle nachfolgend genannten Zahlen sind daraus entnommen.
- Hierbei sei nicht nur an das Titelthema des Stern „Sachsen, ein Trauerspiel“ (Ausgabe 43/2016) oder der Tweet des damaligen Kölner Mediendirektors Ansgar Mayer in Folge der Ergebnisse der Bundestagswahl 2016 erinnert („Tschechien, wie wär’s: Wir nehmen Euren Atommüll, Ihr nehmt Sachsen?“, 24. September 2017), sondern auch an die pauschalen Beschimpfungen von Politikern „Neonazis im Nadelstreifen“ (Ralf Jäger, 11. Dezember 2014), „Komische Mischpoke“ (Cem Özdemir, 14. Dezember 2014) und „Schande für Deutschland“ (Heiko Maas, 15. Dezember 2014), welche eine Akzeptanz politischer Verantwortungsträger weiter schwächt und einem gesellschaftlichen Dialog damit entgegensteht (vgl. hierzu Frank Richter: Stadtgespräche. Politische Bildung als Seelsorge?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 66 [5–7/2017], https://www.bpb.de/apuz/219409/stadtgespraeche-politische-bildung-als-seelsorge?p=all, abgerufen am 30. September 2025).
- Hans Joachim Meyer: Weder abweisende Festung noch bunte Karawanserei. Alternativen für Deutschland, in: Stefan Orth / Volker Resing: AfD, Pegida und Co. Angriff auf die Religion?, Freiburg/Br. 2017, 134–163, 127.