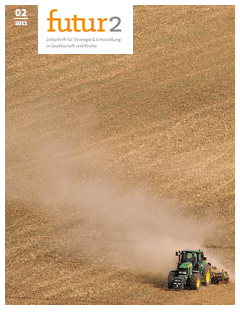Gestaltung kirchlicher Transformationsprozesse aus biblischer Perspektive
1. Die Schrift und der Handlungsprimat Gottes – Einführungsgedanken
Gerade in den derzeitigen Umgestaltungsprozessen von Kirche und Pastoral, die zunächst vordergründig organisatorisch-strukturellen, durch den gesellschaftlichen Wandel bedingt jedoch einen grundlegenden Charakter tragen, mag ein Blick auf biblische Perspektiven von Transformationsprozessen angelegen erscheinen. Das mir gestellte Thema ist jedoch im Rahmen von Überlegungen nach Innovation und Strategie, die aus sozialwissenschaftlicher Perspektive unter Zuhilfenahme von Organisationsentwicklung zu einer Kirche als einer lernenden Organisation beitragen sollen, eine Herausforderung. Dies aus mehreren Gründen: Zum einen ist die Bibel im Verständnis der offiziellen Theologie „Gotteswort im Menschenwort“. Das heißt, sie ist in ihrer Entstehung nicht „vom Himmel gefallen“, sondern in raumzeitlichen Abfassungsverhältnissen entstanden. Sie ist somit sozio-kulturell, sozio-historisch und sprachlich gebunden und damit geprägten Denkvorstellungen und Formulierungen verhaftet. Gleichzeitig gilt sie für Glaubende als von Gottes Geist geoffenbarte Ur-Kunde, in der Gott nicht nur „etwas“ über sich aussagt, sondern sich selbst und die Gemeinschaft mit ihm dem Menschen als Kommunikationspartner anbietet und sich so finden lässt. Dies geschieht im „Vollziehen“ der Schrift, verstanden als singuläres und kommunitäres Lesen, Deuten, Umsetzen, Sich-diesem-Aussetzen. So wird die Schrift gewissermaßen zur „Meta“-Erzählung der angebotenen Gottesfreundschaft. Sie verweist immer wieder über die Historizität ihrer Entstehungssituation hinaus. In diesem Sinne trägt sie also überzeitliche und transkulturelle Züge, sie wird zum „Symbol“, zur Anregung zur Gestaltung des Lebens im Glauben immer wieder neu und in unterschiedlichen Zeiten und Kontexten.
Zum zweiten ist die Heilige Schrift der Christen wie auch die Teile in ihr, die Heiligen Bücher des Judentums (Torah, Propheten, Schriften, also das so genannte Alte Testament; E. Zenger hat es aus christlicher Sicht treffender das Erste Testament genannt), nicht ein „Rezeptbuch für Veränderungsprozesse“, die man einleiten kann, sondern ein Glaubensbuch. Es ist der wirkende Gott, es ist die Geschichte Israels und der Kirche als von der Gottesbeziehung her gedeutete Geschichte mit Gott, die den Atem der Schrift ausmachen. Die Bibel fokussiert weniger auf Tun und Leistungen von Menschen, sondern formuliert in ihren Erzählungen und anderen Textgenres gerade den Primat Gottes im Handeln. Glaubende Menschen – so erzählt die Schrift und lädt den Lesenden dazu ein – sollen sich diesem Gott für sein Handeln öffnen und sich auf ihn einlassen, der oft überraschend, manchmal befremdlich beschrieben wird und in den biblischen Texten oft so anders wirkt, als es die Menschen erwarten. Natürlich wird auch das Handeln von Menschen in den Blick genommen, jedoch nicht, um Geschichte voranzutreiben, sondern, vielmehr auf diesen Gott zu reagieren und im Sinne seines Willens zu agieren. Die Kritik der prophetischen Schriften im AT an der Sozial- und Außenpolitik der Könige Israels wurzelt in der Vorstellung, dass eigentlich Gott selbst der König Israels ist. Die sozialen, politischen und gesellschaftlichen Handlungen des Menschen werden in der Schrift so als gläubige Antwort auf die vorgängige Berufung und Offenbarung durch Gott – oder als deren Perversion – gedeutet. In diesem Sinne sind Menschen gerufen, an einer neuen Welt mitzubauen, sozusagen Mitarbeiter Gottes zu sein. Wo das nicht geschieht, wo Menschen und das Volk Israel auf eigene Leistungen bauen, sich sozusagen an die Stelle Gottes setzen, geht die Menschheit, geht Israel in die Irre. So Adam und Eva, für die es eine verlockende Vorstellung ist, die Welt mit den Augen Gottes sehen (Genesis 3,4-7) oder die Hybris der Turmbauer von Babel (Genesis 11), die sich mit dem Turm, der bis an den Himmel reichen soll, einen Namen machen wollen. Dies ist jedoch kein blindes Schicksal, sondern als Führung und Leitung durch Gott begriffen.
Gleichzeitig ist – und auch dies muss im Rahmen eines Beitrages zur Gestaltung von Transformationsprozessen genannt werden – Veränderung, Transformation auf jeder Seite der Bibel spürbar, auf der Inhaltsebene des Erzählten, wie auch auf der Meta-Ebene der Reflexion des Werdens der Schrift selbst. Die Entstehung der Schrift ist ihrerseits Transformation: Die Entstehung des Kanon wird heutzutage von der biblischen Wissenschaft nicht als eine nachträgliche autoritative Auswahl von vorliegenden Schriften, sondern ein inner-literarischer Prozess des Weiterschreibens und Reflektierens der vorgängigen Erfahrungen in neuer geschichtlicher Situation verstanden. Die Bibel ist somit, obwohl als literarisches Dokument „abgeschlossen“, durch die Beziehung auf heutige Kontexte weiter zu „schreiben“. Interpretation wird so zur Fortschreibung der Schrift, innerhalb wie außerhalb ihres eigentlichen Schriftkorpus. Die jüdisch-christliche Bibel ist also nur in sehr eingeschränkter Betrachtungsweise die historische Beschreibung dessen, was „war“, sondern ein bereits mit Deutung durchdrungenes Erzählzeugnis gelebten Glaubens von Einzelnen und der Glaubensgemeinschaft Israels und der Kirche, das für die Reflexion der eigenen Erfahrungen der Nachgeborenen mit sich selbst, Gott, Welt und Mitmensch Bedeutung und Gehalt gewinnt.
Auf der Makroebene des biblischen Kanons wird jedenfalls deutlich, dass die Kategorie Gottes nicht die Beibehaltung des Status Quo, das „Alte“, sondern das „Neue“ ist, die kreative Veränderung des Bestehenden. Wenn die Offenbarung des Johannes als das letzte und abschließende Buch der christlichen Bibel in der Vision des Sehers Johannes einen „neuen Himmel und eine neue Erde“ (Offenbarung 21,1) vor Augen stellt, die von Gott heraufgeführt werden („Siehe, ich mache alles neu“, v5), so wird hier vom Ende des Kanons her der biblische Ur-Anfang der Schöpfung am Beginn des biblischen Erzählstranges kommemorierend aufgenommen: „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ (Genesis 1,1, vgl. die entsprechende abschließende Rahmungsformulierung der Schöpfungserzählung in Genesis 2,4: „Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden.“) Schöpfung wird hier nicht als ein einmaliger göttlicher Initialakt verstanden, der etwas bewirkt und dann eine Entwicklung in Gang setzt, mit der die „Welt“ alleine wie ein Uhrwerk weiterlaufen könnte. Vielmehr wird Anfang und Vollendung und alles, was sich in Raum und Zeit dazwischen abspielt, als immerwährende schöpferisch-kreative Initiative Gottes „zwischen Himmel und Erde“ gedeutet. Im Prophetenbuch Jesaja wird diese immerwährende innovierende Kreativitätsinitiative Gottes als ein allen beobachtbaren Entwicklungsprozessen zu Grunde liegendes Prinzip wahrgenommen, wenn das Jesajabuch Gott zu Israel sprechen lässt: „Denkt nicht an das Vergangene, und auf das Frühere achtet nicht. Siehe ich wirke Neues, Jetzt sprosst es auf. Erkennt ihr es nicht?“ (Jes 43,18f).
Mit diesen Überlegungen im Hinterkopf wollen wir uns nun einigen exemplarischen Strängen biblischer Entwicklungsüberlieferung zuwenden, die wir hier nur ansatzweise im Rahmen einer biblischen Hermeneutik (Verstehenslehre) entfalten können. Möglicherweise verbleibt auch ein Ertrag für das organisationsentwicklerische Interesse an der Veränderungsgestaltung von Kirche und Gesellschaft.
2. Wachstum und Reifung – Jakob wird am Jabbok zum Gottesstreiter Israel
In Genesis 32 tritt im Rahmen der Patriarchenerzählungen ein Erzählstrang zutage, der sich um die Person des Jakob rankt. Obwohl hier eine Einzelperson im Mittelpunkt der Erzählung steht, gilt Jakob in der biblischen Tradition als Korporativpersönlichkeit, in der sich das Volk Israel als Kollektiv selbst reflektiert. Insbesondere in poetischen Texten wie den Psalmen werden die Bezeichnungen „Jakob“ und „Israel“ im Parallelismus der Vershälften synonym verwendet: Die Jakobs-Texte müssen somit immer auf der Ebene des Einzelschicksals als auch als Teil der Erfahrung Israels als Ganzes mit seinem Gott gelesen werden. Die Vorgeschichte der uns interessierenden Stelle ist schnell erzählt: Jakob, der jüngere Sohn Isaaks, erschleicht sich durch Betrug das Erstgeburtsrechts seines älteren Bruders Esau, die Segnung durch den erblindeten Vater. Er flieht ins Ausland, nach Haran, lebt dort und erwirbt Frauen, Familie und Eigentum. Der Aufforderung Gottes folgend, kehrt er zurück nach dem gelobten Land. Die Situation des Kapitels 32 ist die des Übergangs über den Jabbok, einen Nebenfluss des Jordan, und wird so zur Symbolerzählung für den Übergang Jakobs über seinen persönlichen „Rubikon“ in ein neues Leben. Lapidar wird geschildert, dass Jakob in der Furt in der nächtlichen Dunkelheit mit einem Mann kämpft, bis die Morgenröte kommt. Der Mann, der bis zur Dämmerung merkt, dass er ihn nicht überwinden kann, will von Jakob ablassen, der ihn aber seinerseits festhält. Jakob will ihn erst loslassen, wenn er ihn segnet. Im Verlauf der Erzählung, in der oft gar nicht deutlich ist, welcher der beiden ringenden Kontrahenten mit „er“ gemeint ist, wird erst am Ende klar, (vgl. die Namensnennung des Ortes am Ende durch Jakob, Pnuel: „Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen.“), dass Jakob mit Gott ringt. Bereits vorher schon ist dem Jakob von seinem ominösen Kontrahenten eine Namensänderung zuteil geworden. Jakob soll Israel heißen, Gottesstreiter, „denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und warst überlegen“. Die Namensnennung lässt in schillernder Weise mitschwingen, dass Israel als Streiter für Gott und mit/gegen Gott verstanden werden kann. In dieser Nacht, die das Leben Jakobs verändert, wird er zum Stammvater des Volkes Israel. In der ringenden Begegnung mit Gott wächst und reift Jakob, er findet zu seiner Bestimmung. Als er am Morgen die Furt verlässt und weiter in seine Heimat zieht, ist er ein anderer geworden. Er übernimmt Verantwortung und wird sich mit seinem Bruder Esau versöhnen. Die biblische Erzählung lässt ihn zweierlei gezeichnet aus der Begegnung mit Gott hervorgehen. Er ist ein Gesegneter und ein Gezeichneter zugleich. Die Hüfte Jakobs bleibt durch die Berührung mit dem Kämpfer verrenkt, Jakob hinkt und bleibt von dieser Begegnung mit Gott bleibend affiziert.
Im Erzählzusammenhang der Schrift geschieht hier an einer wichtigen Stelle des Übergangs ein Ringen mit Gott, ein Wachsen und Reifen an der Auseinandersetzung. In dieser Weise ist Gottes Veränderungsschule zur Reifung, die Vorbereitung für seine Aufgabe in Szene gesetzt. In der Nacht am Jabbok kulminiert dieses Veränderungsgeschehen Jakobs-Israels und wird als von Gott her in Gang gesetzt gedeutet, um Jakob für seine ihm zugedachte Aufgabe in Dienst zu nehmen. Israel reflektiert sich selbst in dieser Jakobspersönlichkeit im Spannungsfeld von Segen und Verwundung. Der Gott Israels ist kein einfacher Automaten-Gott, kein Bitte-bitte-lieber-Gott, sondern einer, der seinem Volk das Ringen um ihn und somit um seine Zukunft zumutet. Nur so geschieht Entwicklung und Wachstum in der biblischen Perspektive Israels.
3. Durch die Wüste ins Land der Verheißung
Während die Jabbok-Erzählung einen Einzelnen als Teil einer kollektiven Erfahrung in den Blick nimmt, erzählen die Texte, die ab dem Buch Exodus vom Auszug Israels aus Ägypten und der vierzigjährige Wanderung durch die Wüste ins verheißene Land der Zukunft handeln, direkt von der gemeinschaftlichen Transformation des Volkes. Die „Fleischtöpfe Ägyptens“ werden zum Zeichen des zurückliegenden Zustandes in relativem Wohlstand, gleichwohl der Unfreiheit, als lockende Herausforderung des „Zurückliegenden“, von dem Israel aufgebrochen ist und wohin es nicht wieder zurück soll. Gott ruft sein Volk heraus zu einem neuen Zustand, dem Leben im Verheißenen Land, in der Gemeinschaft mit Gott. Es ist die Vision von einer Ganzheit und Heilheit, auf die hin Menschen im Glauben unterwegs sind. So wird das „Aufbrechen“ und „Herausgehen“ aus dem Haus der Knechtschaft Ägypten, hebräisch iaza’, für Israel zum Terminus technicus des Neuanfangs, der Berufung und Sendung. Wie geht dieser Transformationsprozess vonstatten? Auch hier geht die Initiative wieder von Gott aus. Am Auszugsabend, dem Pessach, soll das gebratene Lamm ohne Rest aufgegessen werden, hastig, mit Schuhen an den Füßen, gegürtet und mit Wanderstab. Die Hast des Aufbruchs, die Forderung, zum Marsch vorbereitet zu sein, wird für Israel zur Grunderfahrung. Die erzählte Wanderung durch die Wüste findet unter Gottes Führung statt, er gewährt Hilfe und Schutz gegenüber der ägyptischen Militärmaschinerie, die die Israeliten am Auszug hindern will (Exodus 14f). In Zeiten des Mangels, als die Israeliten angesichts des Hungers die zurückliegende Knechtschaft Ägyptens der verheißenen Freiheit Gottes vorziehen wollen, erzählt das Buch Exodus von dem salzigen Wasser, das trinkbar wird, von Wachteln und dem seltsamen Manna (Exodus 16,2-22), das als Essbares vom Himmel her geschenkt wird. Das Mannah ist für jeden aktuellen Tag (v4) geschenkt, was mehr gesammelt wird, verdirbt. Wenn Gott sich um sein Volk sorgt, so die Erfahrung Israels, braucht es keine Vorratshaltung, kein Horten von Ressourcen. Vielmehr erhält jeder ausreichend und kann sammeln nach dem Maß seiner Bedürfnisse (v18).
Im Rahmen der Wüstenwanderung wird erstmals ein im engeren Sinne organisationales Geschehen geschildert. Mose, als Anführer des Volkes und Vermittler zu Gott, hat durch die vielen Anfragen des Volkes zuviel zu tun. Das Volk kommt zahlreich zu ihm, um Gott zu befragen, und damit er Recht spricht (Exodus 18,15). Sein Schwiegervater Jitro weist ihn darauf hin, dass diese Aufgaben zu schwer für ihn seien, um sie allein zu bewältigen (Ex 18,18). Jitro rät Mose, einen bestimmten Aufgabenkatalog, nämlich die Vertretung des Volkes vor Gott, selbst zu leisten und im Übrigen aus dem Volk Männer zu wählen, die für das Volk Recht sprechen. Große Angelegenheiten sollen für Mose reserviert werden, kleinere können sie selbst richten (v22). Hier ist erstmalig von einer Delegation von Verantwortung die Rede, die zu einer Spezialisierung und Arbeitsteilung einerseits, zu einem gestuften Verständnis von Verantwortung (Management by exception) andererseits führt. Einer allein kann nicht alles machen und nicht alles kontrollieren, es braucht eine Abgabe von Verantwortlichkeit, damit im Zusammenwirken Vielfalt zur Lösung vielfältiger Problemszenarien deutlich wird und in einer gewisse „Differenzierung“ – auch unter ökonomischen Gesichtspunkten – Ressourcen eingesetzt werden. Wir stehen hier vor den Anfängen einer Ausdifferenzierung von Ämtern, Diensten und Zuständigkeiten, die in der Aufgabenteilung zwischen den Aposteln und ihrem Dienst am Wort und dem Gebet einerseits und den Diakonen mit dem Dienst an den Tischen, dem Sozialdienst, andererseits in Apostelgeschichte 6 aufgenommen wird. Eine solche in einer Charismentheologie ruhende Gestaltung von unterschiedlichen und komplementären Diensten und Ämtern scheint mir für eine kirchliche Entwicklung – insbesondere derzeit – grundlegend zu sein.
In den erzählerischen Zusammenhang der Wüstenwanderung fügt der Pentateuch (Bezeichnung für die 5 Bücher Mose, Genesis bis Deuteronomium) in Exodus 20-23 juristische Texte ein, die so in kunstvoller Weise als Bundesurkunde die rechtliche Grundlage für den am Berg Sinai zwischen Gott und Israel geschlossenen Bund darstellen. Das so genannte Zehnwort („Die Zehn Gebote“) leiten diesen Abschnitt ein, der gemeinhin als „Bundesbuch“ bezeichnet wird. Als kultisches und soziales Recht stellt dieses Bundesbuch die Rechtsordnung dar, die einzuhalten und mit Leben zu erfüllen die glaubende Antwort des Volkes Israel auf die Erwählung, Befreiung Israels und die Landgabe durch Gott ist. Es geht also bei den geltenden Verordnungen und Rechtsvorschriften weniger um autoritative Setzungen oder um reinen „Kadavergehorsam“, vielmehr sind sie Ausdruck der Liebe zu Gott und die Antwort auf die Verheißung. Die spätere Rechtsordnung Israels in der institutionalisierten Staatlichkeit des Landes wird somit als Rechtsordnung für Israel „on the way“ an die Frühzeit (Jugendzeit) der Beziehung mit Gott, in die Wüstenzeit, literarisch zurückverlegt. Somit weist die Schrift den Ordnungen und Rechtsvorschriften keinen absoluten Charakter zu, sondern gibt ihnen eine Deutung im Rahmen des Heilswillens Gottes „auf dem Weg durch die Wüste“. Institutionalisierte Ordnungen in der Situation der stabilen organisational-staatlichen Identität werden in Erinnerung an den Auszug und die Befreiung konstituiert, damit aber auch in gewisser Weise als fluide und anwendungsorientiert konzipiert.
In der großen paradigmatischen Gesetzesrede des Mose kurz vor Einzug ins Gelobte Land, die das Buch Deuteronomium (Dtn) darstellt, macht Mose als Leiter der Wüstenzeit deutlich, dass er selbst das verheißene Land nicht mehr sehen wird. Sein Nachfolger, der das Volk über den Jordan in das Land führen wird, wird Josua (Dtn 31). Die Schrift erzählt so von Beauftragungen und Verantwortlichkeiten, die nur für partikuläre Zeiten übergeben und übernommen werden. Es braucht bei Veränderungsprozessen auch Nachhaltigkeit. Mancher übernimmt Verantwortung für Veränderungen auch für solche Zeiten, die nach seiner eigenen (Lebens-)Zeit liegen. Gerade im Blick auf die Halbwertszeit politischer Veränderungsprozesse von großer Tragweite, die allzu oft lediglich im Rahmen und mit Wirkung auf die aktuelle Legislatur entschieden werden, macht die Bibel deutlich: Der Ertrag einer grundsätzlichen Veränderungsstrategie geht über die Zeit des eigenen Wirkens hinaus. Möglicherweise bezieht sich der Ausspruch Martin Luthers, dass er heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen würde, auch wenn morgen die Welt untergehen sollte, auf den Gedankengang des Paulus in 1 Korinther 3,6-11, dass ein weiser Baumeister den Grund legt, ein anderer darauf weiter baut. Gott selbst schenkt das Wachstum, auch wenn einer pflanzt und ein anderer gießt, der Grund, den kein anderer legen kann, ist Jesus Christus.
4. Das Christusereignis und seine verwandelnde Kraft
Zwischen dem Ersten und dem Erneuerten Bund (AT und NT) steht transzendentallogisch das Christusereignis, das Leben und Predigen des Jesus von Nazaret, die biblische Deutung seines stellvertretenden, heilsmittlerischen Sterbens und die Erweckung und Erhöhung durch Gott, wie es die Evangelien und die übrigen Schriften des Neuen Testaments – zumeist in (authentischer und literarischer) Briefform – bezeugen. Christus als der österlich durch Gott Auferweckte ist nach dem Zeugnis der Schrift durch den Geist in seiner Kirche präsent. Der Durchgang vom Tod zum Leben, das Pascha-Mysterium, gilt als der christologische Transformationsprozess schlechthin. Die Erfahrungen von Transformation des Volkes Israel werden hinein genommen und gedeutet auf dem Hintergrund der für das Christentum zentralen Präsenz Gottes in Jesus Christus. Dies bringt für den seinem Herrn und Meister nachfolgenden Christen seinerseits Transformationen mit sich. Einerseits ist die Taufe die existentielle Hineinnahme des Glaubenden in dieses Schicksal Jesu, des Durchgangs durch den Tod zum Leben. Nach Römer 6 stirbt der alte Mensch und seine alte sündhafte Existenz mit Christus am Kreuz, der neue Mensch wird mit der Auferweckung Christi zum Leben erweckt und lebt nun in Christus und auf ihn hin. Dies geschieht bereits in der Taufe in wirksamer Weise, aber zeichenhaft und in Hoffnung auf eschatologische Vollendung. Andererseits bedeutet dies in der Tradition Israels auch eine Transformation der Kirche: Sie muss sich als Gemeinschaft der Glaubenden, wenn sie von diesem auferweckten Christus zeugen will, einlassen auf die neue Seinsqualität, die neue Gottesgemeinschaft, die durch das Christusereignis erwirkt und eröffnet ist. Auch die Kirche muss das Schicksal Jesu Christi an sich geschehen lassen, immer wieder sterben und sich von Neuem und möglicherweise in veränderter Gestalt erwecken lassen.
5. Der „neue Weg“ – Die Junge Kirche aus dem Judentum
Die junge Kirche versteht sich am Anfang noch als ein „neuer Weg“ im Kontext der jüdischen Heilsverheißungen als die endzeitliche Sammlung des Gottesvolkes Israel durch den auferstandenen, aber in ihrer Mitte präsenten Herrn (Kyrios) Jesus Christus. Auf dem Hintergrund dieser Kontinuität entwickelt sich jedoch allmählich auch eine als Diskontinuität interpretierbare Weiterentwicklung und Differenzierung, die allmählich von der jüdischen Herkunftsidentität wegführt. Dies realisiert sich insbesondere durch die Thematik, wer denn in welcher Weise zu dieser endzeitlichen Gemeinschaft hinzugehören kann. Mit Hilfe der Fragstellung der Zugehörigkeit zwischen Israel und den Völkern, also der Frage nach Universalität und Partikularität ist auch das Verhältnis von Identität und Offenheit thematisiert.
Dies kann an einigen paradigmatischen Akzenten aufgezeigt werden. So zeigen sich Facetten vom Selbstverständnis der jungen Kirche, die sich in Herkunft wie in Abgrenzung von ihrem Ursprung sowohl in den Evangelien als auch in den anderen neutestamentlichen Schriften reflektiert und so neu entwirft. Dies wird offensichtlich bei der Frage der Integration von Nichtjuden, kurz: Hellenen. Bereits das Judentum hatte sich als heiliges Priestervolk zur Heiligung der Welt verstanden. Die „Völker“ (hebr. gojim, griech. ethnoi, despektierlich: „Heiden“) stehen für die universale Perspektive des göttlichen Heilswillens. Jesus selbst verstand sich zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesendet (Matthäus 15,24), verstand seine Sendung als Sammlung Israels. Das Christusereignis jedoch führt dazu, die Bedeutsamkeit der Verkündigung der Frohen Botschaft des Evangeliums durch Jesus und seine Jünger in universaler Perspektive zu verstehen. Potenziell ist jeder Mensch „bis an die Enden der Erde“ (Apostelgeschichte 1,8) angesprochen. Die entscheidende Frage ist, wie eng oder weit der Begriff „Israel“ verstanden wird. Die Zugehörigkeit zum erwählten Bundesvolk Gottes, zunächst einmal manifestiert durch Geburt von einer jüdischen Mutter sowie Beschneidung als Bundeszeichen, macht aus dem Einzelnen einen Teil des jüdischen Volkes Israel, das in der Konzeption der endzeitlichen Völkerwallfahrt zum Zion (Jesaja 2; Micha 4) die Völker der Welt dem Schöpfergott heiligend anbietet. In dieser Perspektive muss man nicht Jude sein, um zur Vollendung in Gott zu gelangen. Die Frage der jungen Christengemeinde ist nun, ob man als „Heide“ (Nicht-Jude) zunächst Jude werden muss, d.h. die Beschneidung und die jüdischen Gebote, insbesondere die Speisevorschriften observieren muss, um zur Gemeinschaft Jesu Christi hinzuzugehören und gerettet zu werden. Die Situation löst sich im so genannten Apostelkonzil (Apg 15), bei dem den Bekehrten eben nicht die Beschneidung und die Gebote auferlegt werden. Hier ist ein entscheidender Punkt in der Entwicklung des neuen Weges, der sich durch diese „Entscheidung“ für differenzierte Zugangswege öffnet. Gleichzeitig entwickelt sich die bereits im Judentum angelegte Differenzierung von Hebräisch und Griechisch sprechenden Juden in der jungen Christengemeinde institutionell weiter. Jüdische Inhalte werden in universaler Weise umgedeutet. Durch die Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahre 70 n. Chr. in den Jüdisch-Römischen Kriegen entsteht die Notwendigkeit, sich ohne zentrales Kultheiligtum als Gemeinschaft Identität zu geben. Während im rabbinischen Judentum die bereits vorher entstandene Synagoge sich zum alleinigen Gebets- und Versammlungshaus entwickelt, versteht sich die christliche Gemeinde, die sich zunächst in Privaträumen trifft, ohne eigene Kulträume zu errichten, zunehmend selbst als neuen Tempel, aus lebendigen Steinen erbaut (1 Petrus 2,5). Jesus Christus, durch die Taufe als Auferweckter in ihnen als Einzelne und als Gemeinschaft gegenwärtig, ist der neue und ewige Hohepriester, der ein für alle das Opfer des Neuen Bundes, nämlich sein Kreuzesopfer dargebracht hat (Hebräer 10,10). Einen Kulttempel benötigt es nicht mehr, wenn sich die christliche Gemeinde als neuen Tempel versteht, in dem sie die universale Welt zum Opfer darbringt. Das Verständnis vom handelnden Gott bleibt auch in der jungen Christengemeinschaft wach: Die Heiligung und Rettung der Menschen ist nicht ihr Verdienst aus Leistung, sondern Gottes Kraft, die im Kreuzesgeschehen Christi an den Menschen wirkt. Deshalb ist die Entwicklung der Kirche nicht der eigenen Leistung geschuldet, sondern bezieht sich zurück auf das demütig verkündete Wort vom Kreuz. Den Juden, die sich einen solchen Gott nicht vorstellen können, ist es ein Ärgernis, den gebildeten Griechen, die alles erklären können wollen, ist es eine Dummheit. (1 Korinther 1,23ff).
Hinzu kommt, dass die Christengemeinde sich in ihrem Selbstverständnis zunehmend differenziert. Auch wenn sich in den Pastoralbriefen die Entwicklung von Ämtern und Hierarchie zur funktionalen Entwicklung institutioneller Organisationswirklichkeit verfolgen lässt, bleibt hierzu in produktiver Spannung doch das Verständnis von dem Zusammenwirken von unterschiedlichen, von Gott geschenkten Begabungen (Charismen) aller getauften Mitglieder, die zum Aufbau des Ganzen beitragen und von daher auch ihre Kriteriologie finden. Insbesondere in den Briefen des Paulus ist der antike Gedanke von dem einen Leib und den vielen Gliedern entfaltet, die zusammenwirken (Römer 12,4). Paulus entwirft eine Lehre von den Gnadengaben des Geistes (Charismen), die zum Nutzen des Ganzen eingesetzt werden sollen (1 Korinther 12,4-31). Hier deutet sich die positive Nutzung von Vielfalt zur Weiterentwicklung und Gestaltung einer Gemeinschaft an, die in modernen Konzepten wie Inklusion, Gender oder Diversity Management zur produktiven Organisationsentwicklung aufgegriffen wird. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt für Paulus ist die adäquate, auf den Adressaten bezogene Gestaltung der Verkündigung. Wer noch am Anfang des Glaubensweges steht, benötigt die Verkündigung des Evangeliums im Sinne von „Milch statt fester Speise“ für den Fortgeschrittenen (1 Korinther 3,2). Es zeigt sich hier das Bewusstsein für eine Adressatenorientierung, wie sie in modernen Marketingkonzepten der internen und externen Kommunikation oder in lebensraumorientierten Pastoralkonzepten (Orientierung an gesellschaftlichen Milieus, Lebensweltforschung) ihren Ausdruck findet.
So realisiert sich die christliche Gemeinde als Organisation im Spannungsfeld von Aufnahme und Neuinterpretation ihrer Wurzeln, zwischen profilierter Entschiedenheit des Glaubens (Identität) und Offenheit auf die Welt des „ganz Anderen“ im Rahmen der universalen Potenzialität der Gottesbotschaft an alle Menschen.
Lernende Kirche und Glauben in der Unbeschnittenheit – eine Schlussbemerkung
Gerade in der von Modernisierungsprozessen geprägten Gegenwart, in der die Frage der Zugehörigkeit nicht mehr allein an quantitativ feststellbaren Merkmalen festzumachen ist, sondern vielmehr das Bewusstsein für eine fluide oder punktuelle „Mitgliedschaft“ wächst, entstehen Perspektiven für neue Partizipations- und Aktionsmodelle von Kirche. Israel und die Frühe Christengemeinde haben sich, wie wir gesehen haben, in je veränderter Zeit als lernfähig erwiesen und erneuerte Sozialgestalten und Handlungsformate ausgebildet. Wenn derzeit auf vielen Ebenen intensiv die Grundthematik einer missionarischen Kirche oder der Evangelisierung bedacht wird, so meint dies einen Prozess der Erneuerung und der „Innovation“, der im Blick auf die eigentliche Sendung der Kirche, nämlich die Verkündigung des Evangeliums, im Blick auf die eigene sozio-kulturelle Situation der Christen wie auch auf die Lage und Situation von Mensch und Gesellschaft in der Gegenwart als Adressaten eine Vertiefung und Verheutigung des Glaubens meint. Das Ziel ist, lernfähig für die unterschiedlichen Ausprägungsformen des Evangeliums innerhalb und außerhalb der verfassten Kirche zu werden. Ziel ist auch, die unterschiedlichen Arten und Weisen der Menschen, nach Sinn zu suchen, mit der christlichen Botschaft von Gottes Gegenwart in Kontakt zu bringen und beides dadurch lebensweltlich weiterzuentwickeln. Eine lernende Kirche ist (sprechende) Botschafterin des Evangeliums, indem sie (hörende) Kundschafterin nach den Facetten des Lebens der Menschen ist. Eine lernende Kirche sorgt sich um eine fruchtbare Einheit von Sprechen und Hören. Der Römerbrief stellt Abraham als den Vater der Glaubenden dar, nicht nur der Beschnittenen, sondern auch der Unbeschnittenen. „Er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war.“ So wird er zum Vater aller, die „im Unbeschnittensein glauben“, zum „Vater der Beschneidung (…) auch derer, die in den Fußspuren des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war.“ (Römer 4,11f) Die Herausforderung einer Gestaltung von kirchlichen Veränderungsprozessen ist aus biblischer Perspektive, eine fruchtbare Spannung von Entschiedenheit (Identität) und Offenheit aufrecht zu erhalten, sowie sensibel zu bleiben für unterschiedliche Manifestationen des göttlichen Wirkens, auch in ungewohnten Gestaltungsformen.