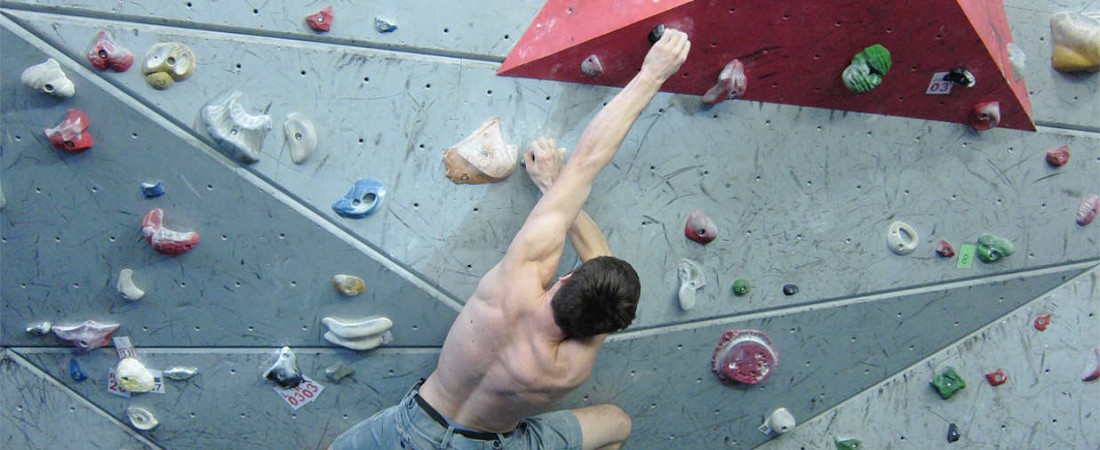Auf dem Innovationspfad? Zur Wirksamkeit diözesaner Strategieprozesse
Haupt- und Ehrenamtliche wurden (je nach Prozess in verschiedenem Ausmaß) in die pastorale Planung oder ihre Vorphasen (wie Analyse und Leitbildentwicklung) einbezogen, weswegen zusammenfassend von partizipativen Strategieprozessen gesprochen werden kann. Eine Reihe von Publikationen hat sich bereits ausführlich mit Verlauf und Ergebnissen dieser Bistumsprozesse beschäftigt.1 Die folgenden Überlegungen konzentrieren sich vorrangig auf ihre Auswirkungen in der Seelsorge und verfolgen die Frage, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen sie pastorale Innovationen anstoßen können.2
Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Ausführungen in fünf Abschnitte aufgeteilt, denen jeweils eine zusammenfassende These vorangestellt wird.
1. Ortskirchlicher Pragmatismus
Während der Prozesse der 1980er und der frühen 1990er Jahre wurde teilweise sehr engagiert über gesamtkirchliche „heiße Eisen“ diskutiert, also über Fragen wie die Priesterweihe von viri probati oder über den Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen. Da diese Themen über die Entscheidungsbefugnis der einzelnen Ortskirchen hinausgehen, wurden dazu Voten an den Apostolischen Stuhl verabschiedet, die allesamt unbeantwortet geblieben sind. In der Folge wurden solche gesamtkirchlichen Konfliktthemen bei Strategieprozessen ab Ende der 1990er Jahre entweder ausdrücklich ausgeklammert oder in einem Themenspeicher gesammelt, um eventuell später durch den Diözesanbischof weitergeleitet werden zu können.
Dass die Bearbeitung gesamtkirchlicher Fragen zurückgegangen ist, hat einen doppelten Effekt: Einerseits werden die Bistumsprozesse durch die Beschränkung auf tatsächliche ortskirchliche Gestaltungsmöglichkeiten entlastet und so unnötige Frustrationen vermieden. Andererseits vertieft sich dadurch aber auch der Graben zwischen den Normen der Kirchenleitung und dem Glaubensleben von Seelsorgern und Gläubigen.
Mit dieser inhaltlichen Verschiebung haben sich zugleich Pastoralgespräche und Leitbild- und Organisationsprozesse zu den dominierenden Formen diözesaner Beteiligungsprozesse entwickelt. Sie zielen primär auf praktische Veränderungen in der jeweiligen Ortskirche, demgegenüber hat die Diskussion und Verabschiedung von Dokumenten eher eine Dienstfunktion. Um eine tragfähige gemeinsame Basis für eine Neuorientierung der Seelsorge zu erreichen, wird verstärkt in einen (geistlichen) Dialog von Bistumsleitung und kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern investiert (Pastoralgespräche) oder auf Methoden aus der Organisationsentwicklung zurückgegriffen (Leitbild- und Organisationsprozesse). Während in den Diözesansynoden und Diözesanforen der 80er Jahre die Umsetzungsphase eher ungeregelt war, ist sie insbesondere bei Leitbild- und Organisationsprozessen von Anfang an in die Planungen integriert. Außerdem sind Energie und Zeit in Beteiligungsprozessen der letzten Jahre stärker auf die Realisierung konzentriert (z.B. durch Modellprojekte und eine konsequente Evaluation), während in vielen frühen Prozessen die Verwirklichung der Beschlüsse nicht weiter verfolgt und überprüft wurde.
Unter dem gewachsenen Druck durch Gläubigen-, Finanz- und Personalmangel konzentrierten sich Strategieprozesse in den letzten zehn Jahren immer mehr auf Strukturfragen. Insgesamt wird die diözesane Leitungsverantwortung offensiver wahrgenommen: Bischöfe geben für Beteiligungsprozesse einen klaren Rahmen vor, treffen nach der Konsultation verbindliche Entscheidungen und kontrollieren ihre Umsetzung. Dabei hat die Finanzkrise des Erzbistums Berlin Ende der 1990er Jahre wie ein „Weckruf“ gewirkt, sie scheint für die stärkere Top-down-Ausrichtung der Prozesse eine legitimatorische Funktion übernommen zu haben.
Etwas holzschnittartig lassen sich diese Entwicklungen als Tendenz zu verstärktem ortskirchlichem Pragmatismus beschreiben: Strategische Beteiligungsprozesse deutschsprachiger Diözesen haben in den letzten 20 Jahren ihren Fokus stärker auf Veränderungen gelegt, die unter den gegebenen gesamtkirchlichen Rahmenbedingungen in der jeweiligen Ortskirche angestoßen werden können und die angesichts des Mangels an Ressourcen umgesetzt werden müssen.3
2. Haltungsänderung als Partizipationsgewinn
Vergleicht man die pastoralen Leitlinien, die in partizipativen Strategieprozessen erarbeitet wurden, mit Planungsprioritäten, die von Bistumsleitungen „beteiligungsarm“ vorgegeben wurden, so findet man kaum inhaltliche Unterschiede. Vielmehr sind seit Mitte der 90er Jahre in den Dokumenten aller deutschsprachigen Diözesen vier wiederkehrende Grundorientierungen für die pastorale Entwicklung zu entdecken, die mit den Schlagworten „missionarischer Aufbruch“, „geistliche Erneuerung“, „diakonisches Engagement“ und „ökumenische Zusammenarbeit“ umschrieben werden können.
Dieser Befund mag auf den ersten Blick erstaunen, bei ausgesprochenen „Beteiligungsoptimisten“ und Fürsprechern einer synodaleren Kirche wird er sogar ein skeptisches Stirnrunzeln hervorrufen. Aber der Partizipationsgewinn entsteht offenbar nicht primär auf der Ebene der Inhalte, sondern er zeigt sich vor allem in der Haltung der Beteiligten, die sich aufgrund ihrer Identifikation mit dem Prozess und seinen Ergebnissen in der Umsetzung vor Ort engagierter zeigen und einen längeren Atem beweisen als bei Prioritäten, die von der Leitung festgesetzt werden. Erwiesenermaßen sind es in vielen Fällen fast identische Aussagen zur pastoralen Planung, die bei Nichtbeteiligung der Diözesanen im Entstehungsprozess gerne als „großkopfert“ und „übergestülpt“ abgelehnt werden, während im Kontext von Partizipationsprozessen die Wahrscheinlichkeit deutlich steigt, dass sie von den Beteiligten so verinnerlicht werden, dass diese sie in den Gemeinden und Einrichtungen wieder aufgreifen und in die Diskussion vor Ort einbringen.
Nicht die Inhalte selbst ändern sich, wohl aber die Identifikation mit ihnen – und damit die Chance, dass Kernaussagen bistumsweit popularisiert und zumindest in Teilen veränderungsrelevant weitergetragen werden können.
3. Nachhaltigkeit durch dezentrale Umsetzung
In der letzten Formulierung („zumindest in Teilen weitergetragen“) klingt Skepsis durch, ob pastorale Grundsatzentscheidungen und gemeinsame Prioritäten überhaupt bistumsweit umgesetzt werden können. Die Diözesen im deutschsprachigen Raum sind in Bezug auf Gläubigenzahl und Fläche so groß und in ihrer Struktur so vielschichtig, dass Ungleichheiten und Ungleichzeitigkeiten zwischen einzelnen Pfarreien, Gemeinschaften und Einrichtungen nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. Neben historischen Wachstumsprozessen, die nicht systematisch gesteuert waren, muss als ein ausschlaggebender Grund dafür die kirchliche Organisationskultur genannt werden, die den lokalen Subsystemen eines Bistums häufig einen ausgeprägten Autonomiestatus einräumt. Die Kirche profitiert von dieser besonderen Form der Unverbindlichkeit, weil sie bei stabilen Zielen der Gesamtorganisation eine flexible lokale Präsenz und eine anpassungsfähige Konzentration auf die dortigen Zielgruppen ermöglicht. Andererseits ist die Umsetzung strategischer Maßnahmen damit aber in hohem Maße von der Akzeptanz an der Basis abhängig.
Der charakteristische lokale Freiheitsraum relativiert das gängige öffentliche Image der katholischen Kirche als Hort bischöflich-hierarchischer Durchgriffs- und Sanktionsmacht. Er hängt eng damit zusammen, dass Kirche zugleich professionelle Bürokratie und Freiwilligenorganisation ist, so dass Bistumsleitungen zur Einflussnahme auf die Seelsorge vor Ort vor allem auf Überzeugungsarbeit gegenüber den Haupt- und Ehrenamtlichen setzen müssen. Dafür und ebenso für wechselseitige Aushandlungsvorgänge zwischen Gläubigen und Seelsorgern kann ein Synodalprozess ein angemessener Ort sein, wo Dialogforen für unterschiedliche pastorale Fragen organisiert und ihre dezentrale Bearbeitung in Gemeinden, Gemeinschaften und Einrichtungen anregt werden.
Diese Bearbeitung vor Ort kann nicht von oben verordnet, sie darf aber auch nicht dem Zufall überlassen werden. Um eine nachhaltige Verankerung und fortschreibende Rezeption zu erreichen, haben einige Diözesen Strategie- und Strukturentwicklung verknüpft, indem die neu gebildeten pastoralen Einheiten dazu verpflichtet wurden, die Ergebnisse des Strategieprozesses aufzugreifen und daraus in einer beteiligungsorientierten Form ihr Seelsorgekonzept zu entwickeln.4
Diözesane Beteiligungsvorgänge brauchen im Vergleich zu Organisationen, in denen Strategien stärker von der Führung geplant und wirksam durchgesetzt werden können, deutlich mehr Zeit und komplexere Prozessdesigns, in denen einzelne Verhandlungsverläufe und Lernzyklen ineinander greifen und sich wechselseitig befruchten können. Synodale Strategieentwicklung setzt also auf Seiten der Verantwortlichen systemische Kompetenz und auf Seiten aller Beteiligten Geduld und Frustrationstoleranz voraus. Für eine nachhaltige Umsetzung in den lokalen Subsystemen gibt es zu diesen langwierigen und komplizierten Verläufen aber keine Alternative.5 Will eine Diözese bei der Realisierung pastoraler Innovationen „kurzen Prozess machen“, programmiert sie Widerstände und riskiert, dass die Impulse an der Basis weitgehend ignoriert werden.
In der pastoralen Entwicklung gibt es keine Abkürzungen!6
4. Gesteuerte Partizipation
Die beschriebenen aufwendigen Konsultationszyklen können für Seelsorger und für Gläubige, die sich in erster Linie ihrer Gemeinde oder Einrichtung verpflichtet fühlen, zu einem echten Problem werden, insbesondere dann, wenn sich Diskussionen wiederholen und aus ihrer Sicht ohne Ertrag für die eigene Arbeit bleiben. In einigen Strategieprozessen konnte beobachtet werden, dass die Bereitschaft zur weiteren Mitarbeit dann deutlich sank, wenn dieselben Fragen mehrfach behandelt wurden. Außerdem muss sich auch der zeitliche Aufwand für Haupt- und Ehrenamtliche in einem klar begrenzten Rahmen halten, um nicht zu Überlastung, Enttäuschung und Ärger zu führen.
Im mehreren Prozessen hat es sich als wenig hilfreich oder sogar als kontraproduktiv erwiesen, wenn von den Verantwortlichen in unspezifischer Weise (d.h. ohne erkennbaren Bezug zur Zielsetzung des Synodalvorganges und ohne Zuspitzung auf bestimmte Erfahrungsträger) allgemeine Fragen zur aktuellen Situation der Kirche oder zu pastoralen Herausforderungen gestellt wurden.7 Um die Beteiligten eines Synodalprozess vor Überforderung und vor unfruchtbaren Diskussionen zu schützen, ist seine Leitung gefordert, ein effektives Gesamtdesign vorzulegen, das von Beginn an festsetzt, welche Personen, Gruppen und Einrichtungen für die zu behandelnden Fragen in besonderer Weise von Belang sind und wie diese angemessen in die Meinungsbildung einbezogen werden sollen. Vorentscheidung, Vorauswahl und Vorstrukturierung sind unverzichtbar, damit einzelne Konsultationsschritte auf Erfahrungen und Expertise der jeweiligen Dialogpartner eingehen und diese für den Gesamtprozess fruchtbar gemacht werden können.
Hier wird deutlich, dass Strategieprozesse nicht naiv nach dem Motto „So viel Beteiligung wie möglich!“ vorgehen können, sondern dass effektive Partizipation Leitungswahrnehmung und Steuerung voraussetzt. Gerade weil die Verhandlungen in der Kirche oft langwierig verlaufen (siehe oben Abschnitt 3), müssen die Verantwortlichen entscheiden, welche diözesanen Einheiten für bestimmte Fragen zu berücksichtigen sind – und wer ungestraft weggelassen werden kann. Dies ist notwendig, um Komplexität zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Letztlich ist diese Vorgehensweise aber auch im Blick auf die Beteiligten alternativlos: Es ist zwar möglich, alle Diözesanen undifferenziert und ohne Vorauswahl um ihre Meinung zu bitten, dies kann aber schnell als Alibiveranstaltung und vorgetäuschte Beteiligung missverstanden werden, wenn nicht zeitnah klar wird, welchem Zweck ihre Mitarbeit dient.
5. Zielfokussierung gegen Erwartungsdiffusion
Dass selbst die Beteiligten eines Synodalvorganges nicht immer wissen, wozu er initiiert wurde und was sie von ihm erwarten dürfen, ist kein hypothetisches Gedankenspiel, sondern wurde schon 2005 in einer vergleichenden Studie als folgenschweres Hauptproblem vieler Synodalprozesse ausgemacht.8 Entweder seien ihr Charakter und ihre Ziele nicht gemeinsam definiert oder diese Klärung sei nicht in entsprechende Verfahren umgesetzt worden, so dass Enttäuschungen und Folgenlosigkeit geradezu vorprogrammiert worden seien. Transparente Prozessgestaltung ist also eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Synodalvorgänge in der Seelsorge anschlussfähig sind, da ansonsten nicht alle diözesanen Ressourcen wirksam eingebracht werden können.
Natürlich ist die Initiierung eines Bistumsprozesses nicht für alle anstehenden pastoralen Fragen ratsam und nicht zur Bearbeitung jeder Problemsituation angezeigt. Vielmehr muss sinnvollerweise eine außergewöhnliche Krise vorliegen, die die gesamte Ortskirche betrifft und die mittel- und langfristige Festlegungen erfordert, also nicht durch kurzfristige Entscheidungen entschärft werden kann, denn für schnelle Maßnahmen sind synodale Vorgänge zu schwerfällig. Nur wenn der Prozess sich auf eine Herausforderung von erheblicher strategischer Tragweite bezieht, hat er realistische Chancen, dass er genug Energie und Bereitschaft zu anhaltendem Engagement mobilisiert. Pfarreien, Einrichtungen und andere diözesane Subsysteme werden angesichts einer solchen Herausforderung, die sie selbst angeht und die unausweichlich auf sie zukommt, schon aus purem Eigennutz bereit sein, praktische Lösungsideen mit zu entwickeln, sie auf ihre Konsequenzen hin zu bedenken und ihre Umsetzbarkeit im eigenen Arbeitsfeld zu erproben.
Hat eine Bistumsleitung beschlossen, dass eine bestimmte Herausforderung den Aufwand für eine synodale Konsultation rechtfertigt, und wurde klar kommuniziert, welches Ziel mit welchem Prozessdesign (Organe, Beteiligungsformen, Zeitrahmen) erreicht werden soll, müssen die Verantwortlichen im weiteren Verlauf als Anwälte dieses Zieles agieren und in der Vielstimmigkeit der divergierenden Einschätzungen und Vorschläge den Prozess „in der Spur halten“. Dazu ist einerseits eine Distanzierungsfähigkeit gegenüber allzu großen Erwartungen nötig, andererseits kluge Zurückhaltung gegenüber thematischen Nebengleisen wie auch gegenüber Inhalten, die mit dem Prozessziel verwandt sind. Bistümer sind derart unübersichtliche Gefüge, sie versammeln derart unterschiedliche Interessen unter einem organisatorischen Dach, dass im Verlauf eines Strategieprozesses immer viele berechtigte Themen verfolgt werden wollen, zusätzliche Arbeitsgruppen zu bilden wären, ergänzende Konsultationen unverzichtbar scheinen. Ehrliche Zwischenreflexionen und externe Begleitung haben sich als Mittel bewährt, um als Steuerungsgremium in dieser Situation Prioritäten und Posterioritäten zu unterscheiden. Um den Synodalprozess immer wieder auf das vereinbarte Ziel hin zu fokussieren, sind entschlossene Leitungsvorgaben notwendig. Diese können sowohl inhaltliche Festlegungen umfassen als auch prozessuale Nachjustierungen und Weichenstellungen.9 Nur wenn dies geschieht und nur wenn sich eine konkrete Spur mit Lösungsperspektiven zu der aktuellen Herausforderung durch den Gesamtprozess zieht, kann ein Synodalvorgang bistumsweit „landen“ und in den unterschiedlichen diözesanen Subsystemen anschlussfähig werden.
Es gibt angesichts der dargestellten (teilweise nicht leicht sicherzustellenden) Voraussetzungen für die innovative Nachhaltigkeit von Synodalprozessen durchaus gute Gründe, andere Formen der Beteiligung und der pastoralen (Neu-)Orientierung zu favorisieren. So können die Verantwortlichen etwa auf ein koordiniertes Beratungsprojekt in den diözesanen Gremien setzen oder in ausgewählten Regionen Pilotprojekte initiieren und darauf bauen, dass best practice-Modelle in die ganze Diözese hinein Kreise ziehen. Darüber hinaus kann ein Diözesanbischof bewusst auf Beteiligungsformen verzichten, weil die ortskirchlich drängenden Fragen für einen Gesprächsprozess inhaltlich wenig geeignet oder nicht ohne erhebliche Belastungen für die kirchliche Einheit und Frustrationen für alle Beteiligten zu beantworten sind.
Dass Synodalvorgänge maßgeblich zu nachhaltigen Veränderungen in der Seelsorge beitragen, erscheint nach allen genannten Bedingungen zwar möglich, ist aber mit einem kaum zu unterschätzenden Aufwand und einigen Risiken verbunden. Synodalprozesse stellen exemplarische Lernorte dar, an denen angesichts einer besonderen Herausforderung christliche Identität und gesellschaftliche Relevanz der Ortskirchen neu ausbalanciert und in innovative pastorale Projekte übersetzt werden können. Es ist aber davor zu warnen, sie in ihren Möglichkeiten zu überschätzen und quasi als „Königsweg“ zu einer zeitgemäßen Seelsorge zu verstehen.
- Als wichtigste Publikationen der letzten Jahre sind zu nennen: HEINZ, HANSPETER / PÖPPERL, CHRISTIAN: Gut beraten? Synodale Prozesse in deutschen Diözesen. In: Herder Korrespondenz, Jg. 58, Nr. 6, 2004. 302-306. DEMEL, SABINE / HEINZ, HANSPETER / PÖPPERL, CHRISTIAN: „Löscht den Geist nicht aus“. Synodale Prozesse in deutschen Diözesen. Freiburg im Breisgau: Herder, 2005. BURKARD, DOMINIK: Diözesansynoden und synodenähnliche Foren sowie Kirchenvolksbegehren in den deutschsprachigen Ländern. In: Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, Jg. 101, 2006. 113-140. POCK, JOHANN: Gemeinden zwischen Idealisierung und Planungszwang. Biblische Gemeindetheologie in ihrer Bedeutung für gegenwärtige Gemeindeentwicklungen. Eine kritische Analyse von Pastoralplänen und Leitlinien der Diözesen Deutschlands und Österreichs. Wien: Lit-Verlag, 2006. SPIELBERG, BERNHARD: Kann Kirche noch Gemeinde sein? Praxis, Probleme und Perspektiven der Kirche vor Ort. Würzburg: Echter, 2008. JOHANN E. HAFFNER: Selbsterregung. Organisierte Interaktion der diözesanen Reformprozesse in Deutschland seit der Würzburger Synode (1971-74). In: KARLE, ISOLDE (Hg.): Kirchenreform. Interdisziplinäre Perspektiven. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2009. 97-120.
- Der vorliegende Aufsatz fasst unter dem Aspekt der innovativen Wirkung einige Ergebnisse meiner Dissertation prägnant zusammen. In der Buchversion werden die Beobachtungen anhand einzelner Prozesse ausführlich belegt sowie theologisch und organisationswissenschaftlich reflektiert. Vgl. EQUIT, THOMAS: Seelsorge erneuern durch Vision und Partizipation. Strategieprozesse deutschsprachiger Diözesen. Würzburg: Echter, 2011.
- Exemplarisch für die frühen Ausprägung von Synodalprozessen (breites Diskussionsspektrum, wenig Aufmerksamkeit für die Umsetzung) seinen genannt: Das Freiburger Diözesanforum 1991-1992, bei dem 46 Voten ohne Planungen für ihre Umsetzung verabschiedet wurden. Auch das Pastoralgespräch im Erzbistum Köln 1993-1996 lieferte über 200 Voten, sah aber kein Instrumentarium für deren Implementierung vor. Vom Diözesanforum Regensburg wurden 1994-1995 sogar 235 Beschlüsse gefasst – ohne Priorisierungen. Vgl. dazu DEMEL/HEINZ/PÖPPERL: „Löscht den Geist nicht aus“, 57-63.70-82. – Auf der anderen Seite können als Beispiele für die neue Art von ortskirchliche fokussierten Prozessen gelten: Der Prozess 2010 in der Diözese Graz-Seckau 1998-2008, die Diözesanreform im Erzbistum Salzburg 1998-2001, die Entwicklung pastoraler Prioritäten in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 2000-2004, das Pastoralgespräch „Das Salz im Norden“ im Erzbistum Hamburg 2004-2006 und der Pastorale Entwicklungsplan im Bistum Basel 2004-2006. Vgl. EQUIT: Seelsorge erneuern, 211-224.
- Z.B. fordert das Bistum Magdeburg für die neuen Gemeindeverbünde Pastoralvereinbarungen, die die Prozessbeschlüsse auf die Anforderungen vor Ort hin konkretisieren. Für die Errichtung der Pastoralräume im Bistum Basel sind Pastoralraumkonzepte verbindlich, in die die inhaltlichen Schwerpunkte des Pastoralen Entwicklungsplanes einfließen müssen. Vgl. dazu EQUIT: Seelsorge erneuern, 274-275.313.
- Für die Identifikation der Diözesanen mit dem Prozess und für die Breite, in der seine Ergebnisse an der Basis verankert und umgesetzt werden können, spielen außerdem die Beteiligung der Leitungsgremien und der Basis in der Prozesssteuerung eine zentrale Rolle, weil auf diese Weise schon in der Prozessarchitektur symbolisiert wird, dass die prägenden Themen nicht top-down vorgesetzt, sondern aus einem Dialog mit den einzelnen Subsystemen (Pfarreien, Orden, Beratungsstellen, Verbänden usw.) und ihren Anliegen entwickelt werden. Zur Bedeutung einer partizipativen Prozesssteuerung für die Nachhaltigkeit der Ergebnisumsetzung vgl. EQUIT: Seelsorge erneuern, 133-140.363-364.
- Zumindest gilt dies für Bereiche, die nicht ausschließlich der Entscheidung der Bistumsverwaltung unterliegen (z.B. bei Haushalts- und Finanzfragen), sondern die in der Umsetzung auf die Motivation und die Identifikation der theologischen Hauptamtlichen und der freiwillig engagierten Gläubigen angewiesen sind, also etwa für typische Fragen nach der zukünftigen Seelsorge.
- Zwei Beispiele: Im Bistum Basel forderte Bischof Dr. Kurt Koch die Gläubigen zur Eröffnung des Pastoralen Entwicklungsplans auf, ihm als Ausgangspunkt und zur Wegweisung für den Prozess „erfreuliche Erfahrungen von Kirche“ zu berichten. Die Ergebnisse dieser Umfrage wurden anschließend transparent gemacht, sie hatten aber für den weiteren Fortgang des Beteiligungsvorganges keine erkennbare Bedeutung. – Im Pastoralen Zukunftsgespräch im Bistum Magdeburg wurden Einzelpersonen und kirchliche Gruppen zur Themensammlung eingeladen, ihre Wahrnehmungen und Erfahrungen in der Seelsorge aufzuschreiben. Anhand der dabei eingegangenen Vorschläge (mehr als 700) wurden für eine Dialogphase selbstorganisierte AGs gebildet. Unklarheit der Beteiligten über die Zielrichtung des Prozesses, Koordinationsprobleme zwischen den AGs und Dopplungen zwischen Themenfindungs- und Dialogphase lösten an der Bistumsbasis Irritation und Frustration aus. Die Dialogphase des PZG wurde in der Folge als „dunkelster Punkt des Prozesses“ erlebt, so dass Nachsteuerungsmaßnahmen (nachträgliche Orientierungshilfen und prozessualen Vorgaben) erforderlich wurden. – Zu Details vgl. EQUIT: Seelsorge erneuern, 255-265.300-302.
- Vgl. DEMEL/HEINZ/PÖPPERL: Löscht den Geist nicht aus, 113-114.239.249. – Die Studie nennt es einen durchgängig zu beobachtenden „Geburtsfehler“ der untersuchten Prozesse, dass es zwischen Synodalen und Bistumsleitung unvereinbare Vorstellungen darüber gegeben habe, ob es sich um eine unverbindliche Konsultation handele oder um die Beteiligung an einem Entscheidungsprozess.
- Zu erfolgreichen Beispielen, wie durch Entscheidungen der Leitung im Verlauf von Strategieprozessen die konzentrierte Weiterverfolgung des Zieles ermöglicht wurde, vgl. EQUIT: Seelsorge erneuern, 388-389.