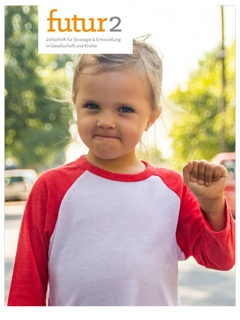Allgemeine Dienstpflicht – ein Mittel gegen autoritäre Tendenzen?
Die Menschenwürde ist das Fundament unserer freiheitlichen Ordnung. Nicht umsonst geht im Grundgesetz die Garantie dieser Würde den Freiheitsrechten voraus. Der unendliche Wert, der dem Menschen zukommt, zeigt sich demnach in seiner umfassenden Selbstbestimmtheit. Man könnte auch sagen: Nur ein selbstbestimmtes Leben ist eines, das dem Menschen würdig ist. Und weil das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit jedem Individuum zukommt, existieren in einer freiheitlichen Gesellschaft viele verschiedene Lebensentwürfe, Interessen und Überzeugungen. Oft genug widersprechen sie einander, was zu Konflikten und Streit führt. So wurzeln die Dissonanzen einer pluralistischen Gesellschaft in der Menschenwürde selbst. Zugleich werden sie jedoch von ihr begrenzt. Denn die freie Selbstentfaltung des Einzelnen bleibt Maßstab auch des Streits. Das bedeutet, dass dieser Streit immer auf den Kompromiss hin orientiert sein muss. Denn nur, wenn sich niemand vollkommen – und auf Kosten aller anderen – durchsetzt, bleibt jedem genug Raum, das Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.
Diese Kompromissbereitschaft hat jedoch eine wesentliche Voraussetzung: Der Einzelne muss die Positionen des Gegenübers als legitim anerkennen. Denn nur dann besteht überhaupt die Bereitschaft, in Austausch zu treten und sich auf eine tatsächliche Güterabwägung einzulassen, die ja immer eine Selbstbeschränkung bedeutet. Diese Toleranz fehlt dem autoritären Denken. Stattdessen brandmarkt es bestimmte Existenzformen und deren Artikulation als illegitim und entzieht sich so dem mühevollen politischen Streit. Darin gleichen sich alle autoritären Strömungen. Unterscheiden tun sie sich allein darin, welcher Gruppe sie die Legitimität absprechen. Bei der autoritären Rechten sind es deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund, derer man sich entledigen will, indem man sie „remigriert“. Die identitätspolitische Linke legt entlang von Kriterien wie Hautfarbe und Geschlecht fest, wer zum Kollektiv der Täter gehört. Da die ganze Daseinsweise eines solchen Täters auf der Unterdrückung aller anderen Gruppen beruht, verstetigt seine Meinungsäußerung nur die zu überwindenden Verhältnisse. Er darf daher keinesfalls gehört, sondern muss „gecancelt“ werden. Für den Islamismus schließlich ist eine Debatte mit den Ungläubigen schon deshalb überflüssig, weil deren eingeschränkte Rechte von vorneherein im Koran festgelegt und daher gar nicht verhandelbar sind.
Delegitimierung und Selbstdurchsetzung
Auffällig ist: Alle drei Strömungen wollen gerade jene Gruppen an der Artikulation ihrer Interessen hindern, auf deren Kosten der eigene Lebensentwurf durchgesetzt werden soll. Hier zeigt sich ein Kernaspekt autoritären Denkens, nämlich dessen Nullsummenlogik. Die Visionen der Autoritären – Ethnostaat, woke Gesellschaft und Kalifat – kann es nur ganz oder gar nicht geben. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass sich die eigene Identität nur dann verwirklichen lässt, wenn eine andere Identität an genau dieser Selbstverwirklichung gehindert wird. Oder anders herum formuliert: Die bloße Existenz einer anderen Lebensform ist eine latente Bedrohung der eigenen Existenz. Dann heißt es: sie oder wir. Jeder Ausgleich wird so zum Verrat an der eigenen Sache. Das wichtigste Forum dieses Ausgleichs, das Parlament, erscheint dann mindestens als Augenwischerei, wenn nicht gar als Machtinstrument des Gegners. Die Verachtung des Parlaments ist dem autoritären Denken geradezu eingeschrieben. Seine Sache ist eben nicht der Kompromiss. Seine Sache ist die uneingeschränkte Selbstdurchsetzung. Die Nullsummenlogik ist die Logik des Bürgerkrieges.
Diese Kompromissbereitschaft hat jedoch eine wesentliche Voraussetzung: Der Einzelne muss die Positionen des Gegenübers als legitim anerkennen.
Drückt sich im Autoritarismus die mangelnde Bereitschaft zum Kompromiss aus, dann steht zu befürchten, dass er dort an Zuspruch gewinnt, wo ein intensiverer Kontakt zwischen Angehörigen verschiedener gesellschaftlicher Milieus nicht mehr stattfindet. Unter solchen Umständen werden die lebensweltlichen Interessen und Probleme des Gegenübers schlicht nicht wahrgenommen. Dadurch kann es – je nach Verteilung der politischen Macht – zu Ausschlüssen und Marginalisierungen kommen, die wiederum trotzige Gegenreaktionen hervorrufen. Die Fronten verhärten sich zunehmend, das Gegenüber wird mehr und mehr zum Zerrbild, seine Positionen verlieren an Legitimität. Spätestens hier haben autoritäre Denkmuster leichtes Spiel.
Entkoppelung der Lebenswelten
Tatsächlich deuten Studien darauf hin, dass der Zusammenhalt in Deutschland unter der Zunahme entkoppelter Lebenswelten leidet. Als besonders segregiert erweisen sich dabei die Netzwerke von Hoch- und Geringgebildeten, Ostdeutschen, Muslimen, Wohlhabenden und Bewohnern ländlicher Räume. Am stärksten ist die Tendenz zur Segregation jedoch im politischen Bereich: Die Hälfte der AfD-Wähler gibt an, dass sich ihr Bekanntenkreis überwiegend aus Gleichgesinnten zusammensetzt. Bei den Grünen sind es sogar 62 Prozent.1
Verstärkt wird diese Entwicklung dadurch, dass Räume des milieuübergreifenden Austausches zunehmend in die Krise geraten. Die Kirchen unterliegen gleichermaßen einem Mitglieder- und Glaubwürdigkeitsverlust und gehen ihrer integrativen Funktion verlustig. Auch die Zahl der Vereinsneugründungen ist rückläufig. Langfristig ist sogar damit zu rechnen, dass das Vereinswesen in Deutschland schrumpft.2 Besorgniserregend ist das schon deshalb, weil gerade in Vereinen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund gemeinsame Zwecke verfolgen. Sie bauen Vertrauen auf und lernen im direkten Gespräch die Sorgen und Nöte fremder Lebenswelten kennen.
Studien deuten darauf hin, dass der Zusammenhalt in Deutschland unter der Zunahme entkoppelter Lebenswelten leidet.Verstärkt wird diese Entwicklung dadurch, dass Räume des milieuübergreifenden Austausches zunehmend in die Krise geraten.
Will man die Gesellschaft gegen autoritäre Tendenzen wappnen, so liegt es nahe, bei der Abgrenzung der Lebenswelten anzusetzen. Eine konkrete Antwort auf diese Entwicklung könnte die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht für junge Erwachsene sein. Aufgrund der zunehmend komplexen Bedrohungslage, in der wir uns befinden, wurde sie bereits von mehreren Seiten in die Debatte eingebracht – etwa vom Bundespräsidenten oder den Unionsparteien. Auf zweierlei Weise hat sie die Stärkung der gesellschaftlichen Resilienz zum Ziel. Zum einen soll sie die physische Bewältigung konkreter Bedrohungs- und Notlagen ermöglichen, indem sie entsprechende Kompetenzen vermittelt. Zum anderen – und darauf kommt es in unserem Zusammenhang an – will eine Dienstpflicht den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, indem sie Menschen aus unterschiedlichen Milieus miteinander in Kontakt bringt.3 Viele Einsatzstellen, die im Rahmen eines Wahlpflichtmodells ausgewählt werden können, sind dabei denkbar: die Bundeswehr ebenso wie Blaulicht- oder zivilgesellschaftliche Organisationen.
Dienstpflicht als Chance
Ob ein solcher Dienst tatsächlich eine Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts bewirken könnte, lässt sich mit einem Blick auf die Erkenntnisse der Sozialpsychologie bewerten. Die empirisch gut belegte Kontakthypothese macht deutlich: Damit der Kontakt zwischen Angehörigen verschiedener Gruppen (= Intergruppenkontakt) zum Abbau von Vorurteilen beitragen kann, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein.4 Diesen Bedingungen entspricht das Konzept einer allgemeinen Dienstpflicht geradezu idealtypisch:
- Hohe Intensität. Intergruppenkontakte müssen so häufig, lang andauernd und eng sein, dass daraus echte Bekanntschaften entstehen können. Die Dienstpflicht ist auf ein Jahr angelegt und verlangt eine tägliche Mitarbeit in Organisationen, die in der Regel auf Teamwork angewiesen sind. Statt oberflächlichen Begegnungen sind daher intensive Arbeitsbeziehungen zu erwarten.
- Gleicher Status. Innerhalb der Kontaktsituation muss den Beteiligten der gleiche Status zukommen – ansonsten werden lediglich Stereotype reproduziert. Weil im Rahmen einer Dienstpflicht alle jungen Erwachsenen unabhängig von Herkunft, Bildung und politischer Einstellung zu vergleichbaren Aufgaben herangezogen werden, begegnen sie sich auf Augenhöhe.
- Gemeinsame Zielorientierung. Vorurteile verlieren dort an Kraft, wo Intergruppenkontakte auf die Erreichung eines gemeinsamen Ziels hin ausgerichtet sind. Eine Dienstpflicht führt zu solcher Kooperation – sei es beim Sandsäcke stapeln in der Hochwasserabwehr, bei der Durchführung von Blutspendeterminen oder in der Kinderbetreuung im Breitensport.
- Institutionelle Unterstützung. Die Sozialpsychologie macht sehr deutlich, dass Intergruppenkontakte vor allem dann zu den gewünschten Ergebnissen führen, wenn die institutionellen Rahmenbedingungen zum Austausch ermutigen. Eine allgemeine Dienstpflicht leistet genau das: Sie schafft ein soziales Klima, in dem Begegnungen zwischen unterschiedlichen Milieus erwünscht sind.
All dies deutet darauf hin, dass die Einführung eines Pflichtdienstes tatsächlich geeignet wäre, den gesellschaftlichen Spaltungs- und Segregationstendenzen entgegenzuwirken. Freilich: Der Pflichtaspekt so eines Gesellschaftsjahres scheint erst einmal verdächtig. Ginge es nicht auch auf freiwilliger Basis? Und wäre das nicht sogar wirksamer? Mit Blick auf unsere heutigen Freiwilligendienste lässt sich das bezweifeln. Sie erreichen nur eine ganz bestimmte, weitgehend homogene Klientel. Im Schnitt sind ihre Teilnehmer weiblich, gut gebildet und stammen aus wohlhabenden Familien.5 Legt man nochmal die Kontakthypothese zugrunde, dann sind wesentliche Effekte im Abbau von Vorurteilen daher nicht zu erwarten. Die Stärken der Freiwilligendienste liegen anderswo.
All dies deutet darauf hin, dass die Einführung eines Pflichtdienstes tatsächlich geeignet wäre, den gesellschaftlichen Spaltungs- und Segregationstendenzen entgegenzuwirken.
Ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr würde hingegen Orte schaffen, an denen – neben praktischen Fähigkeiten und Gemeinsinn – Toleranz eingeübt wird. Das hat nichts mit übersteigerter Empathie zu tun. Toleranz bedeutet lediglich, sich den Zumutungen einer pluralen Lebenswelt gewachsen zu zeigen.6 Im Rahmen einer Dienstpflicht erhalten fremde Milieus, Lebensentwürfe, Interessen und Überzeugungen plötzlich Stimme und Gesicht. Sie können daher nicht mehr so einfach zurückgewiesen werden. Zwar bleibt ihr gesellschaftliches Konfliktpotenzial weiterhin bestehen – aber die Chancen sind größer, dass es sich in den Bahnen politischer Kompromissfindung entlädt. Fernab davon, Harmonie zu erzeugen, würde eine Dienstpflicht also die Fundamente des demokratischen Streits festigen. Das wäre ihr Beitrag zu einem menschenwürdigen Dasein.
- Vgl. Teichler, Nils et al.: Entkoppelte Lebenswelten? Soziale Beziehungen und gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland. Erster Zusammenhaltsbericht des FGZ, Bremen 2023, S. 32.
- Vgl. Schubert, Peter et al.: Ziviz-Survey 2023. Zivilgesellschaftliche Organisationen im Wandel – Gestaltungspotenziale erkennen. Resilienz und Vielfalt stärken, Essen 2023, S. 10.
- Vgl. Dietz, Alexander / von Schubert, Hartwig: Brauchen wir eine allgemeine Dienstpflicht?, Leipzig 2023.
- Vgl. Spears, Russell / Tausch, Nicole: Vorurteile und Intergruppenbeziehungen, in: Jonas, Klaus et al. (Hrsg.): Sozialpsychologie, Berlin 2014, S. 507–564, S. 548ff.
- Vgl. Haß, Rabea / Nocko, Grzegorz: Ein Gesellschaftsdienst für alle – zur Machbarkeit in Deutschland und Europa, Frankfurt am Main 2023, S. 8f.
- Vgl. Dreier, Horst: Der freiheitliche Verfassungsstaat als riskante Ordnung, in: Rechtswissenschaft. Zeitschrift für rechtswissenschaftliche Forschung 1 (2010), S. 11–38, S. 37f.