
Praxis
Neue Lebenswelten: Zwischen Autarkie und magischen Technologien
Moderne Technologie ermöglicht es den Menschen, autarker zu leben als jemals zuvor. Es ist daher wenig verwunderlich, dass gerade technologisch affine Zukunftsvisionen weniger das Zusammengehen und Zusammenarbeiten von Individuen und Gruppen in neuen Gesellschaften in den Vordergrund stellen und eher eine dezentralisierte Lebenswelt skizzieren, in der das Individuum so leben kann, wie es möchte, und mehr Ellenbogenfreiheit hat. Natürlich stellt sich die Frage, wie autark diese dezentralen Communities tatsächlich sein werden: Hier entsteht durch zentrale Technologien die Möglichkeit, diese Communities auf subtile Art und Weise, „magisch“, zu steuern, ohne dass sie sich dessen bewusst werden.
Sphären & Schäume
In Gesellschaften, in denen von Robo-Bossen geleitete, automatisierte Fabriken und Agri-Tech-Landwirtschaften, die Abdeckung von Grundbedürfnissen übernehmen, werden die Menschen frei, „so zu leben, wie sie wollen“, so das Szenario des Robotikwissenschaftlers Hans Moravec für die 2050er-Jahre. Dieser hatte bei dieser Betrachtung Schweizer Kantone, aber vor allem die arabischen Golfstaaten als Vorbilder im Blick, die durch ihre Öleinnahmen bereits heute asiatische Arbeiter als Robotersubstitute nutzen und so einen sorgenlosen Lebensstil für die Einheimischen ermöglichen.1 Menschen würden sich also mit tendenziell Gleichgesinnten in kleineren, autarkeren Gemeinschaften zusammenschließen und diese den anonymen großen Gemeinschaften bevorzugen, zu denen es immer schwierig ist, eine „direkte und unmittelbare Emotionalität und Motivation“ zu empfinden.2 Im Mittelpunkt dieser Community steht die dezentrale Energieproduktion. „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften“ ermöglichen eine gewisse Autarkie und sind bereits mit heutigen Mitteln durchaus umsetzbar.3 Die Mitglieder dieser „Tribes“ werden trotz Automatisierung produktiv bleiben: Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz, Smart Machines und 3D-Druckern, welche unterschiedliche Produkte „ausdrucken“, produzieren sie für den eigenen Bedarf, aber auch für andere. Diese persönliche Produktion vermeidet zugleich lange Transportwege, Ausschuss und Überproduktion.4 Die Mitglieder der Community werden zudem kreativer: Anstatt nur Musik zu hören, mit Hilfe von KI selbst Stücke zu komponieren und zu editieren, anstatt Filme nur zu konsumieren, selbst als Avatar Rollen in diesen zu spielen. Betrachtungen zu einer autarken Gemeinschaft fanden zuletzt bei Hardt und Negri und ihren Skizzen zu MASCHINISCHEN COMMUNITIES eine neue demokratiepolitische Bewertung als Gegenentwurf zu hierarchischen Gesellschaftsmodellen und Hegemonien.5 Diese Kommunen besitzen die notwendigen Produktionsmittel/Maschinen und sie werden sich mit anderen Gemeinschaften vernetzen, um notwendigen Austausch und Technologieentwicklung zu betreiben (Kleine-Welt-Modell). Für die Schweiz existieren etwa Vorstellungen, welche das Land in sieben Regionen einteilen und ihren jeweiligen Städten, Quartieren und Nachbarschaften neu konfigurierte lokale, industrielle und landwirtschaftliche Kapazitäten sowie Dienstleistungen zuteilen. Diese Skizze beinhaltet auch Architekturen, etwa für zentrale Räume in Zürich und Genf (Metro Foyers), welche Vertretungen anderer Zentren als auch „Inventorien“ und „Kooperatorien“ beinhalten, in welchen öffentliche Projektentwicklungen stattfinden sollen (Abb. 1).6

Abb. 1. Metro-Foyer Zürich. Quelle: neustartschweiz.ch
Moderne Technologie ermöglicht es den Menschen, autarker zu leben als jemals zuvor.
In der Architektur waren mögliche neue Lebensverhältnisse bereits seit den Automatisierungswellen der 1950er und 1960er Jahren thematisiert worden, oftmals jedoch verknüpft mit einer ganz anderen Facette: Es war vor allem das Thema der Abkapselung bzw. Isolierung auffällig. F. Buckminster Fuller entwickelte etwa Kuppeln als Designelemente, unter denen die bedrängte Natur und Menschen leben bzw. überleben werden.7 Ihren Endpunkt fanden diese Designs in der in den 1970er Jahren populären Idee von gigantischen orbitalen Raumstationen, welche Hunderttausenden Menschen eine neue Heimat bieten sollten – dieses Projekt wurde trotz erfolgreicher Vorarbeiten abgeblasen, da die NASA sich für das kostengünstigere Raumshuttle-Projekt entschied.8 Peter Sloterdijk abstrahierte zuletzt derartige Konstrukte, um zu sozialen Konzepten wie schützenden „Sphären“ bzw. „Blasen“ zu gelangen, welche er auch als isolierende Reaktion auf die Globalisierung verstand.9 Und er fügte das eher heitere Element des „Schaums“ hinzu, um eine Verbindung dieser Sphären zu beschreiben: Diese können sich überlagern und sind durchlässig – vergleichbar mit den Blasen in einem Schaum.
In jüngster Zeit werden derartige Projekte vor allem unter dem Label der digitalen Smart-City konzipiert. Schließlich findet eine Vielzahl der Applikationen der Sozialen Medien innerhalb der Community bzw. Nachbarschaft ihr bestes Wirkungsgebiet (z.B. Mobilitätsplattformen).10 Erste Proteste, welche diese Sphären als Einengung empfinden – vor allem Widerstände gegen die sog. 15-Minuten-Stadt, die Wege innerhalb des urbanen Raums reduzieren soll –, machen auf eine weitere Entwicklungsmöglichkeit aufmerksam: Die Community als autonome, aber vor allem elitäre Blase, die sich gegenüber Klimakatastrophen und Migrationsbewegungen bzw. generell Außenstehenden verbarrikadieren kann und in Projekten wie etwa „The Line“ in Saudi Arabien und den Seestädten Peter Thiels ihren Ausdruck findet.11 Die Dezentralisierung verliert hier zunehmend ihre befreiende Konnotation und entwickelt sich zur Idee einer Sphäre, welche zwar autark und vielleicht nachhaltig sein mag, sich aber zugleich vor der Außenwelt verschanzt. Die ultimative Sloterdijksche Blase.
Letztes Abendmahl & Magie
Andererseits konzentriert sich die Entwicklung der Technologien dieser Communities heute zumeist in den Händen weniger Unternehmen, die in den jeweiligen konkurrierenden hegemonialen politischen Machtblöcken angesiedelt sind. Schließlich sind diese Technologien derart kapitalintensiv und komplex, dass ihre Entwicklung – so eine Folgerung aus dem berühmten Marxschen Maschinenfragment – Ergebnis gesamtgesellschaftlicher Investitionen sein muss und hierzu umfassendes, gesellschaftliches Wissen (General Intellect) kapitalisiert wird, welches global nicht gleich verteilt ist.12 Digitale Landwirtschaftssysteme sind hier ein Beispiel für monopolistische Technologien, welche sich über dezentrale Communities wölben: Dem Bauern wird über eine App eine tagesaktuelle Satellitenauswertung mitgeteilt, welche anzeigt, welches Feld jetzt zu bewässern und zu düngen ist. Im Gegenzug für die Informationen, welche etwa in Indien über Microsoft bereitgestellt werden, müssen dann online Dünger von BASF gekauft werden. In China sind ähnliche Strukturen und Technologien im Einsatz: Hier wird die bäuerliche Kommune zentral von einem staatlichen Unternehmen (Syngenta) mit Daten, Ratschlägen und chemischen Produkten versorgt.13
Die Investitionen in diese Technologie können riesenhaft sein und verlangen dann nach überschaubaren und kontrollierbaren Strukturen. Ein historisches Vorbild hierfür liefert die sog. „Last Supper“-Strategie. Diese basiert auf einem Abendessen des amerikanischen Verteidigungsministers im Pentagon mit Rüstungsvertretern im Juli 1993, bei dem er seinen erstaunten Gästen verkündete, dass er von ihnen erwartet, dass sich ihre Unternehmen zusammenschließen und so die Schaffung besser steuerbarer, quasi-monopolistischer Strukturen in der Industrie den Weg ebnen würden: Die Zahl der Rüstungspartner wurde schließlich von 51 auf fünf reduziert.14
Dabei werden quasi „magische“ Technologien eingesetzt, welche völlig neue Formen der Bewusstseinsbeeinflussung und -manipulation ermöglichen (Psyop-Kapitalismus).
Trotz der Möglichkeiten der Dezentralisierung wird der Nationalstaat wohl keinesfalls überflüssig sein. Er müsse sich jedoch – so die Befürworter der Dezentralisierung – transformieren und zum „Befähiger“ und „Partner“ der Community werden, auch wenn – oder gerade, weil – er bereits unter Druck steht.15 Die Zentralisierung technologischer Entwicklung wird dann zu einer Verschmelzung/Annäherung von staatlichen Strukturen und Technologieunternehmen führen können. Die resultierende TECHNOKRATIE kann zwar weiterhin demokratische Grundstrukturen aufweisen, hat allerdings bestimmte zusätzliche Charakteristika: In der Technokratie werden Positionen zunehmend „nominiert“ und Experten haben eine gewichtige Rolle; schließlich gilt es Probleme unparteiisch durch wissenschaftliche und technische Lösungen anzugehen.16 In diesem auf Lösung und Leistung fokussierten System spielt deshalb die Meritokratie eine zunehmend wichtige Rolle, was zwangsläufig zur Unterteilung der Bevölkerung in „Smarte“ bzw. „Leistungsfähige“ und diejenigen, die es trotz Zugang zu Bildung „eben nicht geschafft haben“ („Deplorables“), führen wird. Es werde – so ein Kritiker – den „unteren Schichten“ dann zwar vielleicht Gerechtigkeit angeboten, es fehlt jedoch an Wertschätzung und sozialer Anerkennung, was zu Spaltungen in der Gesellschaft führen wird.17 Um diese Spannungen und generell Widerstände zu minimieren und handlungsfähig zu bleiben, ist erwartbar, dass Staaten Technologie auch zur Unkenntlichmachung von etwaigen Widersprüchen für den Einzelnen, also zur „unsichtbaren“ Beeinflussung eines vorgeblich autarken, kreativen und selbstbestimmten Individuums verwenden werden. Dabei werden quasi „magische“ Technologien eingesetzt, welche völlig neue Formen der Bewusstseinsbeeinflussung und -manipulation ermöglichen (Psyop-Kapitalismus). Wenn etwa KI eine Partnerin und Ratgeberin des Menschen in allen Lebensbelangen werden soll, wird sich die Technik auf das Individuum einstellen müssen, um personalisierte Vorschläge zu machen.18 Dieser „Lebenspartner“ gehört allerdings nicht dem Individuum, sondern den Technologiekonzernen. So ist es erwartbar, dass sich deren Interessen auch in den Ratschlägen widerspiegeln können: „Eines Tages wird dein Avatar etwa zu dir sagen, ‚Du siehst schlecht aus, proprobiere doch einmal diesen Monster Energy Drink …‘“.19
Ein offenes Rennen?
Das Verhältnis zwischen zentralen und dezentralen Ebenen wird abhängig von zwei Ereignissen sein: Einerseits des Wettrennens zwischen dem digital aufgewerteten Individuum und der technologischen Kontrolle/Manipulation: Vielleicht, aber nur vielleicht, ist Technologie diesmal so mächtig, dass die digitale Befähigung des Individuums zur selbstbestimmten Assoziation und Counter-Culture nicht mehr unterdrückt werden kann. Technologie wäre dann eine Art automatisierter Revolutionsagent: „Was passiert, wenn jeder von uns das Äquivalent des klügsten Menschen für jedes Problem in der Tasche hat?“20 Andererseits zwischen dem Kampf um das Eigentum an Technologie. Das Bestreben der Hegemonien, Technologie zu monopolisieren, würde einer wirklichen Dezentralisierung entgegenstehen. Und würde die Klimakrise nicht eine Bündelung und Zentralisierung von Ressourcen und Macht verlangen? André Gorz war sich bei den ersten Betrachtungen zur Umweltpolitik in den 1970ern klar, dass es hier nur zwei Möglichkeiten gäbe: Entweder assoziiert sich das Individuum selbst oder ein übermächtiger Staat muss die notwendigen Anpassungen an die Klimakrise diktieren.21Vielleicht, aber nur vielleicht, ist Technologie diesmal so mächtig, dass die digitale Befähigung des Individuums zur selbstbestimmten Assoziation und Counter-Culture nicht mehr unterdrückt werden kann.

Praxis
Wege zu einer sorgenden Gesellschaft: Modelle für ein zukunftsfähiges Miteinander
1. Die Suche nach dem dritten Weg
Unsere Gesellschaft steckt in einem Paradox: Nie waren die technischen Möglichkeiten für ein gutes Leben für alle größer, nie war das Bewusstsein für globale Herausforderungen ausgeprägter – und gleichzeitig scheinen die bewährten Lösungsmodelle an ihre Grenzen zu stoßen. Der Markt verspricht Wohlstand, produziert aber Ungleichheit und ökologische Zerstörung. Der Staat soll es richten, wird aber zunehmend als träge und bürgerfern erlebt. Die traditionellen Kirchen predigen Nächstenliebe, verlieren aber durch Machtmissbrauch und Hierarchiedenken ihre Glaubwürdigkeit als moralische Instanzen.
Zwischen neoliberaler Vereinzelung und institutioneller Erstarrung wächst eine Sehnsucht nach echtem Miteinander – authentisch, solidarisch, zukunftsfähig. Menschen suchen nach Gemeinschaftsformen, die weder in die Atomisierung des „jeder für sich“ noch in die Bevormundung durch Expertokratien führen. Sie wollen Verantwortung übernehmen, ohne überfordert zu werden. Sie wollen helfen, ohne paternalistisch zu werden. Sie wollen Spiritualität leben, ohne sich religiösen Machtstrukturen zu unterwerfen.
Diese Suche ist nicht romantisch, sondern realistisch. Denn die großen Krisen unserer Zeit – Klimawandel, Demografiewandel, soziale Spaltung – lassen sich weder durch Marktmechanismen noch durch staatliche Verordnungen allein lösen. Sie brauchen eine sorgende Gesellschaft: Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen, ohne dabei einzelne Gruppen zu überlasten oder auszuschließen.
2. Modelle mit Zukunftspotenzial: Caring Communities und Sorgenetzwerke
Die gute Nachricht: Solche Modelle entstehen bereits. Von Caring Communities über Solidarische Landwirtschaft bis zu Bürgerräten experimentiert eine wachsende Bewegung mit neuen Formen des Zusammenlebens. Die Herausforderung: Aus diesen Experimenten ein gesellschaftliches Modell zu entwickeln, das mehr ist als die Summe seiner Teile.
Zwischen neoliberaler Vereinzelung und institutioneller Erstarrung wächst eine Sehnsucht nach echtem Miteinander – authentisch, solidarisch, zukunftsfähig.
Das Netzwerk Caring Communities Schweiz definiert eine Caring Community als „eine Gemeinschaft in einem Quartier, einer Gemeinde oder einer Region, in der Menschen füreinander sorgen und sich gegenseitig unterstützen. Jeder nimmt und gibt etwas, gemeinsam übernimmt man Verantwortung für soziale Aufgaben.“
Caring Communities entstehen dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen – im Stadtteil, im Dorf, in der Nachbarschaft. Anders als die traditionelle Kirchencaritas funktionieren sie nicht nach dem Prinzip „die Guten helfen den Bedürftigen“, sondern nach dem Grundsatz „wir sind alle Teil der Sorge“. Jede und jeder kann gleichzeitig geben und empfangen, je nach Lebenssituation und Fähigkeiten.
3. Risiken und blinde Flecken
Doch bei aller Begeisterung für neue Gemeinschaftsformen wie den Caring Communities dürfen die Schattenseiten nicht übersehen werden. Auch die besten Absichten können zu problematischen Ergebnissen führen, wenn strukturelle Dynamiken nicht mitgedacht werden.
Exklusion trotz Inklusionsversprechen
Caring Communities versprechen Offenheit für alle – aber wer kann sich dieses Engagement tatsächlich leisten? Wer Zeit für Nachbarschaftshilfe hat, wer Energie für Bürgerräte aufbringt, folgt oft einem ähnlichen Profil: gebildet, finanziell abgesichert, zeitlich flexibel. Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen, Alleinerziehende oder Pflegende haben oft schlicht nicht die Ressourcen für zusätzliches Engagement. So entstehen ungewollt neue Formen der Privilegierung. Die „sorgende Mittelschicht“ schafft sich lebenswerte Quartiere, während andere außen vor bleiben.
So entstehen ungewollt neue Formen der Privilegierung. Die „sorgende Mittelschicht“ schafft sich lebenswerte Quartiere, während andere außen vor bleiben.
Neue Formen von Moralismus und sozialer Kontrolle
Wo Gemeinschaft entsteht, entstehen auch Normen – und damit Druck zur Anpassung. In Caring Communities kann ein subtiler Zwang zur Dankbarkeit entstehen: Wer Hilfe empfängt, soll sich „richtig“ verhalten. Diese neue Sittlichkeit versteckt sich hinter dem Anspruch der Gemeinschaftlichkeit und ist dadurch schwerer zu durchschauen.
Alte Muster in neuen Bewegungen
Viele alternative Bewegungen reproduzieren unbewusst Muster, die sie eigentlich überwinden wollen. Da entstehen in Care-Communities informelle Hierarchien zwischen „Gebenden“ und „Nehmenden“, die an paternalistische Armenbetreuung erinnern. Das Problem liegt nicht in den guten Absichten, sondern in unreflektierten Machtstrukturen. Wer definiert, was „gute Sorge“ ist? Ohne bewusste demokratische Kontrolle können auch emanzipatorische Bewegungen zu neuen Formen der Bevormundung werden.
Überforderung und Vereinnahmung
Schließlich droht die Gefahr der systematischen Überforderung. Wenn der Staat sich aus der Daseinsvorsorge zurückzieht und gleichzeitig von Bürgern erwartet, diese Lücken durch Engagement zu füllen, wird aus Solidarität Ausbeutung. Caring Communities werden dann zur billigen Alternative zu professioneller Pflege. Diese Vereinnahmung ist besonders problematisch, weil sie die moralische Autorität der Engagierten nutzt.
Reproduktion religiöser Dominanz
Eine besondere Herausforderung liegt im Umgang mit religiösen Traditionen. Diese verfügen über jahrtausendealte Erfahrungen mit Gemeinschaftsbildung, Sorgearbeit und Sinnstiftung. Diese Ressourcen zu ignorieren wäre töricht. Sie unkritisch zu übernehmen aber ebenso.
Die Deutungshoheit liegt bei denen, die sich engagieren – nicht bei denen, die predigen.
Der Ausweg liegt in der bewussten Säkularisierung religiöser Praktiken. Klöster haben jahrhundertelang gezeigt, wie nachhaltige Gemeinschaften funktionieren – ohne dass man an Gott glauben muss, um von ihren Organisationsprinzipien zu lernen. Kirchliche Diakonie hat Methoden der Sorgearbeit entwickelt – ohne dass man christlich sein muss, um sie zu nutzen.
Wichtig ist dabei die Umkehrung der Machtverhältnisse: Nicht religiöse Institutionen laden gnädig zur Mitarbeit ein, sondern säkulare Bewegungen nutzen selektiv religiöse Ressourcen. Die Deutungshoheit liegt bei denen, die sich engagieren – nicht bei denen, die predigen.
4. Was Menschen wirklich verbindet: Jenseits der Unterschiede
Caring Communities funktionieren nicht trotz, sondern wegen ihrer Vielfalt. Warum? Weil grundlegende menschliche Bedürfnisse universell sind: Respekt, Sicherheit, Zugehörigkeit, das Gefühl, gebraucht zu werden.
Diese Bedürfnisse äußern sich unterschiedlich: Die Klimaaktivistin und der Rentner haben verschiedene Dringlichkeiten, aber beide wollen wirksam sein. Menschen mit Migrationshintergrund bringen andere Gemeinschaftsverständnisse mit – sie kennen sowohl die Stärken enger sozialer Bindungen als auch deren Grenzen. Ihre berechtigte Skepsis gegenüber Inklusionsversprechen ist wichtig, denn sie wissen, wie es sich anfühlt, nicht dazuzugehören.
Unterschiedliche Klassenlagen prägen verschiedene Vorstellungen von gutem Leben: Wer um Existenz kämpft, hat andere Prioritäten als wer nach Selbstverwirklichung sucht. Wer körperlich arbeitet, versteht Solidarität anders als wer im Büro sitzt. Diese Unterschiede sind nicht zu überwinden, sondern anzuerkennen.
Eine Caring Community funktioniert, weil alle mal Hilfe brauchen – egal ob jung oder alt, religiös oder säkular, einheimisch oder zugewandert.
Spiritualität spielt dabei eine besondere Rolle: Post-religiöse Spiritualität sucht Sinn jenseits etablierter Konfessionen und will spirituelle Ressourcen nutzen, ohne Machtstrukturen zu übernehmen. Menschen mit traditionellen religiösen Bindungen bringen jahrhundertealte Erfahrungen mit Gemeinschaftsformen mit. Beide können praktische Weisheit weitergeben – die einen durch neue Rituale, die anderen durch bewährte Strukturen.
Die Stärke von Caring Communities liegt darin, diese verschiedenen Motivationen zu respektieren und trotzdem gemeinsame Ziele zu verfolgen. Ein Nachbarschaftsgarten funktioniert, weil alle gutes Essen wollen – egal ob aus Sparsamkeit, Bio-Überzeugung oder kultureller Tradition. Eine Caring Community funktioniert, weil alle mal Hilfe brauchen – egal ob jung oder alt, religiös oder säkular, einheimisch oder zugewandert.
5. Strategien für den Übergang: Kritischer Pragmatismus
Wie aber können Caring Communities authentisch bleiben und trotzdem politisch wirken? Die Lösung liegt in dem, was sich „kritischer Pragmatismus“ nennen lässt: der strategischen Verbindung von authentischem Engagement und politischer Kritik durch kluge Arbeitsteilung.
Das Prinzip der intelligenten Arbeitsteilung
Die Communities selbst helfen, weil sie helfen wollen. Sie dokumentieren Bedarfe, bauen Vertrauen auf, lösen konkrete Probleme. Ihre Stärke liegt in der Unmittelbarkeit und Glaubwürdigkeit. Gleichzeitig entstehen Netzwerke, die diese praktische Arbeit in strukturelle Kritik übersetzen: „Dass unsere Communities gebraucht werden, zeigt Systemversagen.“
Diese Arbeitsteilung hat mehrere Vorteile: Sie schützt die Communities vor Überforderung. Sie ermöglicht es Menschen, sich zu engagieren, ohne sich politisch verstehen zu müssen. Sie nutzt trotzdem die politische Sprengkraft ihrer Arbeit. So wird aus privater Hilfe politischer Skandal, ohne die Helfenden zu instrumentalisieren.
Strategische Allianzen statt Einzelkämpfertum
Einzelne Communities bleiben Nischen, wenn sie isoliert agieren. Eine strategische Care-Allianz könnte verschiedene Kräfte bündeln: Caring Communities, Transition Towns, Genossenschaften, Bürgerräte. Jede Bewegung bleibt bei ihrer Spezialität, aber gemeinsam entwickeln sie eine umfassende Kritik des gegenwärtigen Systems.
Wie aber können Caring Communities authentisch bleiben und trotzdem politisch wirken?
Historische Beispiele zeigen: Die erfolgreichsten sozialen Bewegungen kombinierten praktische Hilfe und strukturelle Kritik. Die Arbeiterbewegung gründete Genossenschaften UND kämpfte für politische Rechte. Die Frauenbewegung schuf Frauenhäuser UND forderte rechtliche Gleichstellung.
Machtfragen und demokratische Kontrolle
Doch strategische Netzwerke schaffen auch neue Machtstrukturen. Wer spricht „im Namen der Communities“? Diese Fragen müssen von Anfang an mitgedacht werden: durch transparente Entscheidungsprozesse, Rechenschaftspflicht gegenüber den Communities, demokratische Kontrolle. Sonst werden aus heutigen Alternativen die Hierarchien von morgen.
Konfliktfähigkeit als Voraussetzung
Echter gesellschaftlicher Wandel entsteht nicht durch Harmonie, sondern durch produktive Konflikte. Neue Gemeinschaftsformen müssen lernen, Konflikte auszuhalten und zu nutzen. Die Kunst liegt darin, unterschiedliche Bedürfnisse so zu verhandeln, dass am Ende etwas Neues entsteht – statt dass sich die Stärksten durchsetzen.
6. Die Vision einer post-konfessionellen sorgenden Gesellschaft
Eine andere Gesellschaft ist möglich – diese Gewissheit wächst in kleinen Experimenten und großen Visionen gleichermaßen. Die sorgende Gesellschaft, die sich abzeichnet, ist post-konfessionell: Menschen müssen weder an denselben Gott glauben noch dieselbe politische Theorie teilen, um gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Was sie verbindet, ist die Praxis – die gemeinsame Arbeit an lebenswerten Verhältnissen. Diese Gesellschaft baut auf drei Säulen: Authentisches Engagement schafft Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Strategische Vernetzung übersetzt lokale Erfahrungen in politische Macht. Demokratische Kontrolle verhindert, dass aus Alternativen neue Herrschaftsstrukturen werden.
Es braucht strategische Allianzen zwischen verschiedenen Bewegungen. Es braucht Netzwerke, die aus lokaler Hilfe politische Kritik machen. Es braucht die Bereitschaft zum Konflikt mit denen, die von den gegenwärtigen Verhältnissen profitieren.
Doch Transformation ist kein Selbstläufer. Deshalb braucht es mehr als gute Beispiele. Es braucht strategische Allianzen zwischen verschiedenen Bewegungen. Es braucht Netzwerke, die aus lokaler Hilfe politische Kritik machen. Es braucht die Bereitschaft zum Konflikt mit denen, die von den gegenwärtigen Verhältnissen profitieren.
Die sorgende Gesellschaft entsteht durch kluge Arbeitsteilung: Menschen schaffen lokale Alternativen – aus welcher Motivation auch immer. Gleichzeitig entstehen Netzwerke, die diese Arbeit in politischen Druck übersetzen. Die Nachbarin hilft aus Nächstenliebe. Das Netzwerk macht daraus strukturelle Kritik. Niemand muss alles können. Aber alle können beitragen: die einen durch authentisches Engagement, die anderen durch strategische Vernetzung. Die Kunst liegt darin, verschiedene Beiträge so zu verbinden, dass sie sich gegenseitig verstärken. Jeder kann seinen Teil beitragen – mit dem, was er am besten kann.

Praxis
Auf dem Weg in eine sorgende Gesellschaft – Caring Communities (CC) als Zukunftsmodell
Gesellschaftliche Herausforderungen machen gemeinsames Sorgen unabdingbar
Unsere Gesellschaft steht vor einem absehbaren sozialen Wandel. Globale Zerrissenheit, Klimakrise, soziale Ungleichheit, Migration sowie die Erosion des gesellschaftlichen Zusammenhalts stellen uns vor Herausforderungen, die eine fundierte Auseinandersetzung mit alternativen Gesellschaftsformen notwendig machen. Das bestehende Gesellschaftsmodell, das auf Individualismus, Wettbewerbsdenken und Effizienzsteigerung ausgerichtet ist, stösst an seine Grenzen. Die sich verschärfenden strukturellen und globalen Krisen lassen sich durch technische oder wirtschaftliche Fortschritte kaum lösen. Vielmehr ist eine Transformation des gesellschaftlichen Zusammenlebens notwendig. Damit dieser Transformationsprozess gelingen kann, braucht es ein kohärentes Modell, welches auf einer umfassenden Sorge für alle aufbaut und nicht einzelne Gruppen benachteiligt oder ausschliesst.
Caring Communities bieten einen solchen visionären Ansatz, der das Potential hat, unter Einbezug aller Gesellschaftsgruppen gegenwärtige und zukünftige Problemlagen zu bewältigen oder zumindest zu entschärfen. Anhand der Entwicklung des schweizerischen Netzwerks Caring Communities wird exemplarisch aufgezeigt, welche Grundwerte und welcher Nährboden eine gesellschaftliche Bewegung voranbringen, die sich am Gemeinwohl orientiert.
Das schweizerische Caring Communities Netzwerk
Die Entstehungsphase des CC-Netzwerks ist in Simon Hofstetters Buch «Gemeinsam Sorge tragen» bereits beschrieben22. Hier soll lediglich in groben Zügen die Fortsetzung und insbesondere die jüngste Entwicklung aufgezeigt werden. Folgende Prinzipien, die sich am Caring Communities Ansatz orientieren, waren in der Organisationsentwicklung wegleitend:
Damit dieser Transformationsprozess gelingen kann, braucht es ein kohärentes Modell, welches auf einer umfassenden Sorge für alle aufbaut und nicht einzelne Gruppen benachteiligt oder ausschliesst.
- verlässliche und verbindliche Organisation des Netzwerks
- partizipative und agile Weiterentwicklung
- Einbezug aller Sprachregionen der Schweiz
- durchlässige Strukturen
- klare Mitwirkungsmöglichkeiten für Organisationen und Privatpersonen
- transparente Aufgabenteilung und Entscheidungsprozesse
Der Aufbau eines solidarischen Netzwerks mit agilen Strukturen ist die eine Seite, die andere Seite ist eine nicht abgeschlossene inhaltliche Diskussion, was genau unter Caring Communities verstanden wird. Peter Zängl hat mit dem 7E Model23 die Begriffsklärung wesentlich vorangebracht, doch Caring Communities sind weiterhin sehr heterogen konnotiert und es besteht eine definitorische Unschärfe.
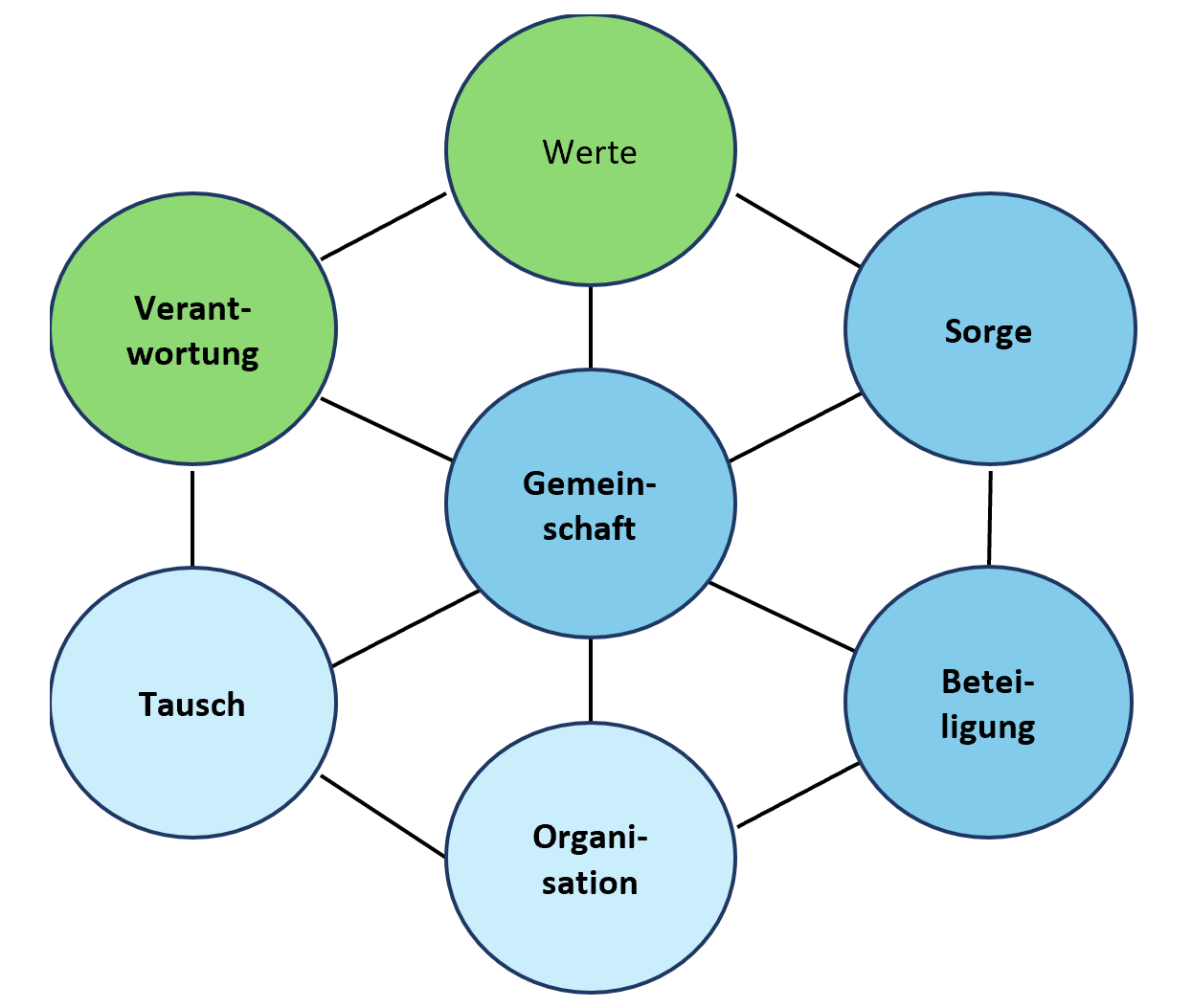
Abbildung 1: das 7E-Model, Zängl, 2023
Dieser unbefriedigende Zustand hat Cornelia Hürzeler inspiriert, den Carefant24 zu kreieren. Das kraftvolle Fabelwesen bringt die unterschiedlichen Vorstellungen und Ansprüche, die mit Caring Communities assoziiert werden, anschaulich auf den Punkt. Das Ringen um Klarheit ist damit jedoch nicht abgeschlossen, vielmehr zeigt der Carfant, die Notwendigkeit einer permanenten kritischen Reflexion auf.
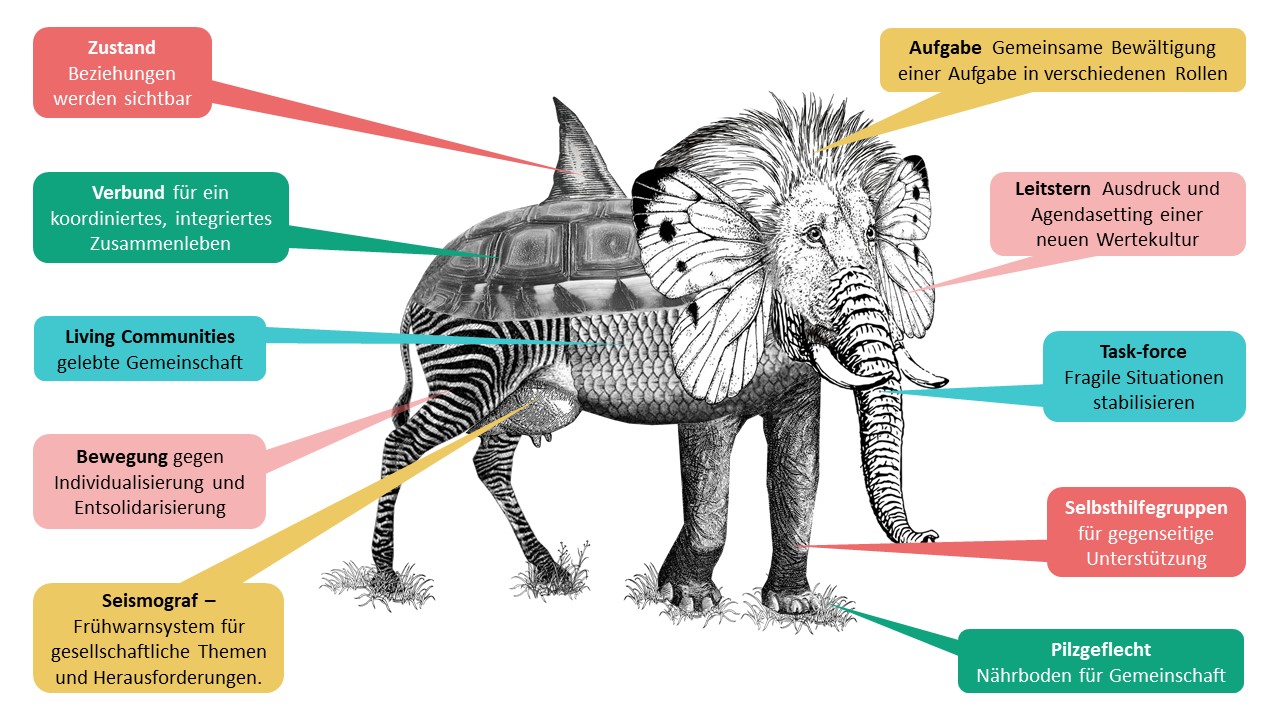
Abbildung 2: Carefant, Hürzeler, 2023
Die sieben CC-Thesen
In der Folge hat sich eine Arbeitsgruppe des schweizerischen CC-Netzwerks das Ziel gesetzt, mit maximal einem Dutzend Thesen, die auf einer A4 Seite Platz finden, Caring Communities konkreter zu umschreiben. In der ersten Sitzung entfachte sich allerdings ein unlösbar scheinender Streit, was die essenziellen Kernelemente einer Caring Community sind. Es sah ganz so aus, als sei eine Einigung über die zentralen Inhalte von Caring Communities unmöglich. Obwohl um jedes Wort gerungen wurde, konnte sich die Arbeitsgruppe schlussendlich auf sieben CC-Thesen einigen25:
Diese Ausrichtung macht Caring Communities zu einem Modell, das sich sowohl an den heutigen Problemlagen als auch an einer klaren Vision orientiert – und dabei Solidarität, Partizipation und Gerechtigkeit ins Zentrum rückt.
- Caring Communities streben ein gutes Leben von der Geburt bis zum Lebensende für alle an. Sie setzen sich solidarisch ein für gerechte Lebensverhältnisse für alle Menschen, unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Fähigkeiten, materiellen Ressourcen oder Religion.
- Caring Communities tragen im Rahmen der Zivilgesellschaft zusammen mit dem Sozialstaat und weiteren Institutionen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft zu einer sorgenden Gesellschaft bei.
- Caring Communities basieren auf der Idee gegenseitiger Unterstützung und Sorge in einer Gemeinschaft, die auf Inklusion und Partizipation aller baut.
- Caring Communities verbinden und formen informelle, formelle und professionelle Sorgearbeit in vielfältigen Kontexten und machen diese sichtbar.
- Caring Communities bieten Räume zum Experimentieren, um neue Wege und Formen der Sorge zu entwickeln und zu erproben.
- Caring Communities fördern den Austausch und das Zusammenwirken, um die unterschiedlichen Erfahrungen, Fähigkeiten und Ressourcen aller Menschen einzubeziehen und daraus Nutzen zu generieren.
- Caring Communities fordern Rahmenbedingungen und Ressourcen für eine Kultur der Sorge sowie deren strukturelle Verankerung. Dies erfordert die Auseinandersetzung mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und deren Bereitschaft zu Anpassungen.
CC-Thesen in der Theorie und der Praxis
Im Frühjahr 2024 wurden die Thesen auf der Homepage des Netzwerks publiziert. Sie wurden konsequenterweise auch als «Leitsätze in einfacher Sprache» veröffentlicht und die Arbeitsgruppe war sich einig, dass die CC-Thesen einen normativen und zugleich theoriebildenden Anspruch beinhalten sollen, der über eine blosse Praxisbeschreibungen hinausgeht. Aufgrund dieser Überlegungen werden die CC-Thesen einerseits einer dialektischen Analyse unterzogen, anderseits aus der Sicht der Praxis in unterschiedlichen Kontexten hinterfragt. Das Ergebnis dieser kritischen Auseinandersetzung liegt erst in Bruchstücken vor. Im Frühjahr 2026 wird es mit dem Arbeitstitel: «Caring Communities – eine konstruktive Streitschrift» publiziert werden. Einige Gedanken aus der Praxisanalyse seien jedoch hier bereits vorweggenommen.
Diese Ausrichtung macht Caring Communities zu einem Modell, das sich sowohl an den heutigen Problemlagen als auch an einer klaren Vision orientiert – und dabei Solidarität, Partizipation und Gerechtigkeit ins Zentrum rückt.
Der Weg zu einem neuen gemeinschaftlich getragenen Gesellschaftsmodell
Der CC-Ansatz beschreibt den Weg zu kollektivem Handeln und gemeinschaftlicher Verantwortung nicht als linearen Prozess, sondern als lernende, partizipative Bewegung, die lokal verankert und gleichzeitig global anschlussfähig sein muss. Im Sinne einer möglichst grossen Kontrastierung wurden für die Praxisanalyse sechs unterschiedliche Kontexte ausgewählt: (1) Tenna, eine kleine Berggemeinde im Safiental, (2) Bellinzona aus der italienischsprachigen Schweiz, (3) Genf, eine Weltstadt aus der französischsprachigen Schweiz, (4) Wilchingen, aus der ländlichen Ostschweiz, (5) Belp, aus der Agglomeration Bern, und schliesslich (6) Zürich-Seebach, ein städtisches Quartier mit hohem Migrationsanteil. Neun Schlüsselpersonen, mit unterschiedlichen Funktionen und Berufen, wurden befragt, wie sie vorgelegt die Umsetzung der CC-Thesen beurteilen und wie relevant sie für die Praxis sind. Obwohl die Analyse der Interviews noch nicht abgeschlossen ist, zeichnen sich bereits einige zentrale Element ab, die in allen Kontexten relevant sind:
Der CC-Ansatz beschreibt den Weg zu kollektivem Handeln und gemeinschaftlicher Verantwortung als lernende, partizipative Bewegung, die lokal verankert und gleichzeitig global anschlussfähig sein muss.
- Wertschätzung der kulturellen und demografischen Vielfalt. In kleineren und ländlichen Gemeinden haben traditionelle gemeinschaftsbildende Rituale und der Generationendialog einen besonders hohen Stellenwert, während es in stätischen Quartieren vor allem um das Miteinander von Menschen aus verschiedenen Kulturen geht. Menschen mit Migrationsgeschichte bringen oftmals andere Vorstellungen und Erfahrungen mit, was Fürsorge und Gemeinschaft bedeutet. In vielen Herkunftskulturen hat Sorge eine zentrale Stellung als Familienverantwortung und Nachbarschaftshilfe. Diese Wertschätzung wird insbesondere in Zürich-Seebach als «Care Kultur»26 gelebt und aktiv gestaltet. In dieser Grundhaltung kommt ein gemeinsames Gesellschaftsmodell zu Ausdruck, welches kulturelle Differenz nicht zu überwinden versucht, sondern sie als Ressource einbezieht.
- Gemeinschaftliche Aushandlungsprozesse. In Tenna, einem abgelegenen Bergdorf wurde eine alte Sennerei zu einem offenen Hospiz27 umgebaut, in welchem Bewohner: innen aus der Umgebung ihren letzten Lebensabschnitt verbringen und ihren Lebensalltag möglichst autonom gestalten können. Interessanterweise werden in diesem Bergdorf, die Caring Communities hauptsächlich von Traditionen genährt, welche jedoch mit dem gesellschaftlichen Wandel stets neu ausbalanciert werden müssen. Beispielsweise werden Verstorbene von jemandem aus den vier nächstgelegenen Nachbarhäusern auf den Friedhof getragen, unabhängig wie gut das Nachbarschaftsverhältnis war. Oder die Orts-Brunnen werden regelmässig von den Dorfbewohnern: innen gereinigt. Seit diese Tätigkeit jedoch in der Nachbarsgemeinde von Gemeindeangestellten erledigt wird, erscheint das Gemeinschaftserlebnis plötzlich in einem anderen Licht. Warum erledigen wir diese Aufgabe? Wir könnten in dieser Zeit auch anderes tun. Damit wird eine zentrale Frage des CC-Diskurses aufgeworfen: welche Aufgaben erledigt der Staat und welche will und kann die Dorfgemeinschaft in Eigenverantwortung übernehmen?
- Verbundenheit mit den Menschen vor Ort durch Identifikation mit der Umgebung. In Genf, mit sehr unterschiedlichen Quartieren und einer Vielzahl von Sozialzentren, in denen soziokulturelle Animateure: innen arbeiten, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gewährleisten, wird ein Park, der von der Stadt nur minimal gereinigt wird zum Begegnungsort, indem, Kinder, Jugendliche und Quartier Bewohner: innen aus unterschiedlichen Kulturen diesen intensiv nutzen, sich mit dem Ort identifizieren und Verantwortung für die Parkpflege übernehmen. Durch die Aneignung des Parks als Ort der Begegnung hat sich ein aktives Gemeinschaftsleben entwickelt und es finden mittlerweile sogar Trauer‑ und Hochzeitsfeiern in dem Park28 statt.
Stellen wir uns eine Gesellschaft im Jahr 2040 vor, die sich entlang der Prinzipien der Caring Communities entwickelt hat, und fragen uns, welche charakteristischen Merkmale sie aufweist:
- In jedem Quartier gibt es Sorgestrukturen, in denen sich Nachbarschaft, Sozialdienste, Pflege, Bildung und Kultur vernetzen.
- Pflegende Angehörige sind durch Zeitbudgets, Weiterbildung und professionelle Begleitung entlastet.
- Kinder und Jugendliche wachsen in Schulen auf, die Sorgearbeit als Teil des Curriculums begreifen – sei es durch Projektarbeit, soziale Praktika oder den Einbezug von Generationen.
- Die Pflegearbeit ist geschlechtergerecht verteilt und gesellschaftlich anerkannt – nicht nur in Worten, sondern durch Bezahlung, Zeitbudgets und gesellschaftliche Anerkennung.
- Die ökologische Sorge ist zum integralen Bestandteil geworden – Caring Communities verstehen sich auch als lokale Klimaakteure: innen, die Ressourcen schonen, regionale Kreisläufe fördern und Verantwortung für unseren Planeten übernehmen.
Dieses Zukunftsbild enthält keine unrealistischen Forderungen. Es lässt sich durch Ko-Kreation aller gesellschaftlichen Akteure: innen realisieren, verstetigen und politisch rahmen. Zur Verstetigung sind jedoch einige strukturelle Massnahmen notwendig:
Ohne Caring Communities verkümmert und spaltet sich unsere Gesellschaft an ihren komplexen Problemen – mit ihnen wird sie resilienter, gerechter und menschlicher.
- Ressourcenzugang: Kommunen erhalten Fördermittel, Infrastruktur und gesetzliche Grundlagen, um lokale Caring Communities zu ermöglichen
- Sichtbarmachung und Wertschätzung von Care-Arbeit: Professionelle Pflege, soziale Arbeit und ehrenamtliche Sorge werden aufgewertet– finanziell und kulturell
- Bildung und Qualifikation: Der Care-Begriff wird in der Grundausbildung, Erwachsenenbildung und politischen Bildung verankert
- Politische Kohärenz: Sorgearbeit wird aufgewertet und nicht durch administrative Hürden gelähmt, oder durch konkurrierende politische Instanzen und kommunale Ämter blockiert oder instrumentalisiert.
Caring Communities bieten keine Patentlösung, vielmehr lassen sie sich schrittweis realisieren, indem sie soziale Gerechtigkeit, partizipative Prozesse und konkrete Praxis miteinander verbinden. Dadurch wird Care nicht nur ein ethisches Konzept, sondern zu einem neuen Gesellschaftmodell. Die sieben CC-Thesen bilden einen konkreten Orientierungsrahmen, um Weg zu beschreiben, wie ein gemeinsam verantwortetes Miteinander in unserer Gesellschaft gestaltet und gelebt werden kann.
Die umfangreiche Praxisbefragung über die Bedeutung der Caring Communities in den sechs Gemeinden lässt sich in einen Satz zusammenfassen: «Ohne Caring Communities verkümmert und spaltet sich unsere Gesellschaft an ihren komplexen Problemen – mit ihnen wird sie resilienter, gerechter und menschlicher».

Praxis
Weiberwirtschaft? Ein gutes Leben für ALLE – und was das mit einem Frauenverband zu tun hat
Was ist eigentlich ein gutes Leben?
Bei der kfd, einem großen Frauenverband, sind wir uns einig, dass Menschenwürde, Solidarität, gute Beziehungen und Gemeinschaft, ökologische Nachhaltigkeit, gleiche Rechte und Teilhabe ALLER unbedingt dazu gehören.
Allerdings sehen wir uns aktuell einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber, die nicht gerade für ein gutes Leben stehen: Klimawandel, die Bedrohungen von rechts, fehlender Zusammenhalt in der Gesellschaft, zunehmender Pflegenotstand oder Wohnungsnot: Vieles scheint nahezu unüberwindbar – sowohl aus globaler Perspektive als auch auf nationaler Ebene. Neben dem Gegensatz von arm und reich erschrecken auch diskriminierende Strukturen, die Frauen, queere Menschen ebenso benachteiligen wie Menschen mit Migrationsgeschichte oder Behinderungen. Als Frauenverband setzen wir uns täglich mit solchen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten auseinander, denen Frauen immer noch und immer wieder ausgesetzt sind. Dies ist nicht nur ethisch fragwürdig, sondern bringt auch einen immensen Schaden für unser Zusammenleben und ein gesellschaftliches Zusammenwirken mit sich.
Als Frauenverband setzen wir uns täglich mit solchen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten auseinander, denen Frauen immer noch und immer wieder ausgesetzt sind. Dies ist nicht nur ethisch fragwürdig, sondern bringt auch einen immensen Schaden für unser Zusammenleben und ein gesellschaftliches Zusammenwirken mit sich.
Warum leistet sich eine Gesellschaft solche Risiken? Denn insbesondere die soziale Ungleichheit bietet viel Sprengstoff für unsere Gesellschaft. Warum fällt es ihr so schwer, sich dem Thema zu stellen und tatsächlich Veränderungen herbeizuführen?
In den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts war ich für einen längeren Zeitraum in Brasilien. Im Rahmen meines Studiums habe ich mich dann intensiv mit Einkommensverteilungen auseinandergesetzt und hier ein besonderes Augenmerk auf Brasilien gelegt. Anders als damals in Deutschland war die Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen in Brasilien seinerzeit sehr stark ausgeprägt. Begleitet wurde sie durch diskriminierende, rassistische und frauenfeindliche Strukturen, sehr ungleiche Chancen auf Bildung und Teilhabe, korrupte Strukturen in der Politik und ein zunehmend neoliberal geprägtes Wirtschaftssystem. Neben kolonialen Vermächtnissen und ausbeuterischer globaler Wirtschaftsweise war die Politik seinerzeit in Brasilien jedoch nicht willens oder in der Lage, dieser Ungleichheit etwas entgegenzusetzen.29
Viele der Phänomene, die seinerzeit in Brasilien zu beobachten waren, wie eben die Einkommens- und Vermögensverteilung, aber auch soziale Ungleichheit oder ein unbefriedigendes Bildungssystem mit ungleichen Chancen, sehen wir heute in unserer Gesellschaft. Und die Entwicklung dahin ist seit langem absehbar. Trotzdem haben wir die Risiken, die eine solche Entwicklung für die gesamte Gesellschaft mit sich bringen, in Kauf genommen. Nun sind alle von den extremen Ausprägungen betroffen und diese machen Angst. Trotzdem scheint ein Umsteuern schwerzufallen.
Entscheidend dafür ist sicherlich das Wirtschaftssystem und die Art und Weise, wie sehr die Wirtschaft im Vordergrund steht.
Während der Wende gab es wenig Diskussion darüber, welches Wirtschaftssystem das richtige ist. Es schien gesetzt zu sein, dass es nur das kapitalistische sein kann. Dementsprechend richtete sich die Politik auch eben daran aus. Der Neoliberalismus war nicht zu stoppen und volkswirtschaftliche Prinzipien, wie die Existenz meritorischer Güter30 wurde nicht mehr beachtet. Es wurde viel privatisiert und auf die Kraft des Marktes gesetzt. Die Folgen dieser Privatisierungen spüren wir heute sehr stark, z. B. am Pflegenotstand oder am Klimawandel. Die Kosten werden externalisiert und Frauen sind von den Auswirkungen erwiesenermaßen deutlich stärker betroffen als Männer.Während der Wende gab es wenig Diskussion darüber, welches Wirtschaftssystem das richtige ist. Es schien gesetzt zu sein, dass es nur das kapitalistische sein kann.
Unterstützt wird dies bis heute durch eine Ausrichtung der Wirtschaftslehre an der neoklassischen Theorie. Diese ist grundsätzlich als theoretischer Hintergrund hilfreich, aber aufgrund ihrer Prämissen und Bedingungen nicht geeignet, so in die Realität umgesetzt zu werden. Leider nutzen trotzdem immer noch einige Politiker genau dieses Narrativ des Marktes im Sinne der neoklassischen Theorie für ihr Handeln. Dies führt dann zu weiteren Reduzierungen von Sozialleistungen oder dem Abbau eines solidarischen Sozialsystems. Die Dominanz einer ökonomischen Sicht auf die Welt ist unübersehbar und selbst Finanzcrashs führen nicht dazu, dass das System hinterfragt wird.
Muss das so sein oder gibt es auch Alternativen dazu?
Klare Antwort: Ja, die gibt es!
Hier möchte ich die Gemeinwohl-Ökonomie herausheben, da sie ein umfassendes alternatives und enkeltaugliches Wirtschaftssystem darstellt. Interessanterweise ist eine Ausrichtung des Wirtschaftens am Gemeinwohl in vielen Verfassungen – sowohl denen der Bundesländer als auch im Grundgesetz – bereits festgeschrieben. Es gibt darüber hinaus weitere sehr gute und wichtige Ansätze, mit denen es zahlreiche Gemeinsamkeiten und Überschneidungen gibt.31 Aber unabhängig davon, wo der jeweilige Schwerpunkt liegt: Die Haltung ist entscheidend – die Wirtschaft muss menschlicher, sozialer und verteilungsgerechter, nachhaltiger, demokratischer und ethischer werden!32Hier möchte ich die Gemeinwohl-Ökonomie herausheben, da sie ein umfassendes alternatives und enkeltaugliches Wirtschaftssystem darstellt.
Zweck der Gemeinwohl-Ökonomie, auch GWÖ genannt, ist ein gutes Leben für ALLE. Sie basiert auf Kooperation und auf fairem Umgang mit Mitarbeiter*innen, Kund*innen, Lieferant*innen und allen weiteren Berührungsgruppen von der Mikro- bis zur Makroebene. Eine besondere Bedeutung kommt dabei auch den Unternehmen zu als wichtigen Akteuren im Wirtschaftssystem. Die GWÖ zeichnet sich durch eine Komplexität aus, die dem Verständnis des gesamten Systems angemessen ist.
Voraussetzung für einen Veränderungsprozess hin zu einer solchen Wirtschaftsweise ist auf jeden Fall ein Haltungsprozess: Es geht nicht darum, dass ich persönlich den größten Nutzen oder Profit von einer Transaktion habe. Es geht darum, wie ich so einkaufen, verkaufen oder Dienstleistungen erbringen kann, dass auch alle anderen Beteiligten sich fair behandelt fühlen und auskömmlich beteiligt sind. Geld ist nicht Selbstzweck – wie wir es heute oftmals erleben –, sondern nur ein Mittel zum Zweck.Es geht nicht darum, dass ich persönlich den größten Nutzen oder Profit von einer Transaktion habe. Es geht darum, wie ich so einkaufen, verkaufen oder Dienstleistungen erbringen kann, dass auch alle anderen Beteiligten sich fair behandelt fühlen und auskömmlich beteiligt sind. Geld ist nicht Selbstzweck – wie wir es heute oftmals erleben –, sondern nur ein Mittel zum Zweck.
Die zentralen Werte der GWÖ und allen Handelns im Sinne des Gemeinwohls sind:
- Menschenwürde
- Solidarität und Gerechtigkeit
- Ökologische Nachhaltigkeit
- Transparenz und Mitbestimmung
Diese Werte sind nicht nur Schlagwörter, sondern sie bestimmen das alltägliche Handeln und werden auch überprüft.
Einige Beispiele für Ansatzpunkte sind etwa:
- Gehaltsgefüge in einem Unternehmen: Wie groß ist die Spannweite zwischen höchstem und niedrigstem Einkommen? Je kleiner der Faktor, desto gerechter (derzeit erleben wir jedoch sehr große Unterschiede)
- Mitbestimmung von Mitarbeiter*innen
- Sinnstiftende Arbeitsplätze
- Mitbestimmung von Kund*innen und Lieferant*innen, z. B. bei der Produktentwicklung
- faire, ökologisch nachhaltige und durchgängig bekannte Lieferketten
- ökologisch und sozial nachhaltige Geldanlagen
Die GWÖ-Community ist eine internationale Bewegung mit dem Ziel, die GWÖ auch in der Politik zu verankern. Auf EU-Ebene gab es ebenso wie im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung bereits Bestrebungen und Ansätze dazu. Leider ist im aktuellen Koalitionsvertrag zu GWÖ-Zielen nur sehr wenig zu finden. Dennoch gibt es ermutigende Erfolge. Inzwischen haben sich zahlreiche Unternehmen, Organisationen und selbst Kommunen bilanzieren lassen und arbeiten nach den Prinzipien der GWÖ. Beispiele dafür sind Vaude oder Werkhaus, aber auch lokale Unternehmen oder die Wirtschaftsförderung Münster.33 Außerdem gelingt es zunehmend gerade auf kommunaler Ebene, dass die GWÖ als Instrument mit in den Blick genommen wird.Inzwischen haben sich zahlreiche Unternehmen, Organisationen und selbst Kommunen bilanzieren lassen und arbeiten nach den Prinzipien der GWÖ.
Aktuelle Messinstrumente beschränken sich zwar oftmals auf eine quantitative, rein an Euro-Beträgen ausgerichtete Richtgröße, sagen aber nichts über die Qualität des Wirtschaftens oder des Unternehmenserfolgs aus. Wirtschaftswachstum kann auch mit umweltzerstörenden Industrien oder mit der Herstellung von (Atom-)Waffen erzielt werden. Ob diese den Wohlstand oder ein gutes Leben für ALLE bedeuten, darf aber bezweifelt werden. Genauso ist es auf Unternehmensebene oder bei der Betrachtung einzelner Investitionen. Alle Unternehmen müssen Finanzbilanzen erstellen, aber auch diese sagt nichts über einen potenziellen Beitrag zum Gemeinwohl aus.
Instrument zur Orientierung, aber auch zur Überprüfung ist die Gemeinwohlmatrix, in der die zentralen Werte zu den Berührungsgruppen in Beziehung gesetzt werden.
Daraus ergeben sich alternative Messinstrumente, die eben genau diese Ausrichtung am Gemeinwohl abbilden:
- Makroebene: Gemeinwohl-Produkt vs. BIP (Bruttoinlandsprodukt)
- Mesoebene: Gemeinwohl-Bilanz vs. Finanzbilanz
- Mikroebene: Beitrag einer Investition zum Gemeinwohl vs. RoI (Return on Investment)
Die kfd im Bistum Münster hat eine solche Gemeinwohlbilanz mit positivem Ergebnis erstellt. Aber warum erstellt ein Frauenverband überhaupt eine solche Bilanz?
Auch wenn die kfd als Verband kein profitorientiertes Unternehmen ist, ist sie doch Akteurin im ökonomischen System:
- Sie kauft ein und hat somit Einfluss auf die Lieferketten.
- Sie ist Arbeitgeberin und somit verantwortlich für die Bezahlung und Mitbestimmung der Mitarbeiter*innen.
- Sie erbringt Leistungen und pflegt somit einen Umgang mit Kund*innen.
- Sie hat Mitglieder und entscheidet, wie demokratische Teilhabe und Transparenz im Verband gelebt wird.
- Sie will authentischer Lobby-Verband für Frauen* sein, hat Einfluss auf sein Handeln und die gesellschaftliche Wirkung.
Als Frauenverband setzt sich die kfd für Gleichstellung und Solidarität in Gesellschaft und Kirche ein, konkret etwa für gleiche Bezahlung und gleiche Chancen. Dementsprechend ist eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ein gerechtes Entlohnungssystem mit einer sehr geringen Spannweite zwischen den Einkommen selbstverständlich. Die kfd setzt sich ein für demokratische Teilhabe von Frauen. Das demokratische Prinzip mit größtmöglicher Transparenz ist deshalb ein Muss. Solidarität und Schöpfungsverantwortung haben natürlich zur Folge, dass die eigenen Lieferketten analysiert und entsprechend ausgerichtet werden. Dies ist mit Blick auf den gesellschaftlichen Impact und den „Social Return on Investment“ unabdingbar für den Zusammenhalt und für eine gerechte und solidarische Gesellschaft.
Traditionelle Vereinsstrukturen werden auch in einem Frauenverband in Zukunft nicht mehr in der Form funktionieren, wie sie das in der Vergangenheit getan haben. Die Lebenswelten von Frauen haben sich grundlegend verändert und es bestehen ganz andere Bedürfnisse und Notwendigkeiten als noch vor einigen Jahren. Dies bringt gesellschaftliche Umbrüche mit sich. Daher stellt sich die kfd im Bistum Münster gerade einem intensiven Zukunfts- und Veränderungsprozess. Die kfd entwickelt neue Ansätze und Betätigungsfelder, um die Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Damit wird die kfd auch ihr Dienstleistungsspektrum erweitern und tritt damit am Markt auf. Dies geschieht immer vor dem Hintergrund der Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung von Frauen*.Die Lebenswelten von Frauen haben sich grundlegend verändert und es bestehen ganz andere Bedürfnisse und Notwendigkeiten als noch vor einigen Jahren.
Sei es die katholische Soziallehre, sei es das Evangelium, sei es ein intrinsisches Gerechtigkeitsbedürfnis und der Wunsch nach Solidarität und Gleichberechtigung: Es gibt sehr viele Ansatzpunkte für einen Frauenverband, im Sinne der Gemeinwohl-Ökonomie zu agieren und für Gleichstellung zu kämpfen. Wenn es darüber hinaus gelingt, die GWÖ damit weiter zu etablieren – vielleicht auch in Bereichen, in denen sie bisher noch keine Rolle spielte – kann dies ein bedeutender Beitrag sein zu mehr Gerechtigkeit, mehr Solidarität und mehr ökologischer Nachhaltigkeit. Und das zum Wohl aller Frauen* und für ein gutes Leben für ALLE. Und das ist doch was, oder?

Praxis
Mit der Freiheit umgehen. Von der Aufgabe der Kirche für eine begründete Hoffnung
Spätestens seit Pegida ist der Osten der Problembär der Nation. In der Öffentlichkeit als rechts gebrandmarkt, bestätigen regelmäßig Übergriffe und AfD-Wahlerfolge, wie schlimm es um den Osten steht. Tatsächlich ist es eine Region, die seit einigen Jahren um den gesellschaftlichen Zusammenhalt ringt. Es ist ein Landstrich, der wie ein Vulkangebiet ist – mit seinen Vulkanschloten, die ausbrechen, und jener Magma-Schicht, die heiß und brennend zu Tage bricht, wo die bedeckende Oberfläche für Risse empfindlicher ist. Wo aber auch manche ein Interesse daran haben, dass der Druck unter der Oberfläche steigt.
In Ost wie West dürfte ein Phänomen gleichermaßen raumgreifend sein und als Ursache benannt werden: Unser Leben in der Moderne bedeutet auch Enttraditionalisierung. Normative, fest vorgegebene Formen, wie das Leben zu führen ist, gehen verloren. Es erfolgt eine Freisetzung, die von vielen als Selbstbestimmung erlebt wird. „Ich darf mich entscheiden“ wird zum zentralen Faktor. Dies gilt eben auch für das Sittengebäude. Mag dies auch für Umstehende und Institutionen als schmerzhaft empfunden werden, bedeutet ein solcher Bruch mit Milieugewohnheiten eine Enttraditionalisierung zugunsten eines Gewinns an Freiheit und Autonomie. Aber – und der Punkt gehört eben auch mit dazu – alles der Verantwortung des Einzelnen zu überlassen, ist einerseits ein wunderbarer Zugewinn an Freiheitsgestaltung und Lebensoptionen.
Aber andererseits steigt gleichzeitig der Entscheidungsdruck, wie ich leben will und wofür ich mich entscheide. Die gewonnene Freiheit auf Dauer gestellt wird sich rasch für den Einzelnen als eine enorme Anforderung herausstellen. Es gibt keine Lebensentscheidung elementarer Art, die nicht immer überfrachtet ist von der Frage „Wie entscheide ich mich?“ Damit heißt es aber auch: Ich habe es – unvertretbar – zu verantworten. Wer ein Leben in Freiheit führen will, entkommt der Freiheit nicht. Weil alle Entscheidungen, die ich treffe, meine Wahl und mein Willensentschluss sind. Und selbst „Das sollen andere entscheiden“ ist meine Entscheidung, die Verantwortung abzugeben.Spätestens seit Pegida ist der Osten der Problembär der Nation.
Gesamtgesellschaftlich bedeutet Individualisierung das anstrengende Aushalten mit Blick auf die vielfältigen Lebensmodelle, die einem sehr fremd sind und die man nicht teilt – aber die man in einem normativen Pluralismus ertragen muss, weil es niemanden mehr gibt, der zentral vorzugeben hat, wie wir gemeinsam leben.
Der Kipppunkt, der zur Krise führt, ist sozusagen eine Überdehnung der Pluralität unseres Zusammenlebens. Dies ist kein Vorwurf, sondern eine Beschreibung der Situation. Durch diese Überdehnung wird aber die Frage des Zusammenhalts zu einer offenen Frage. Denn keiner Institution wird es mehr zugestanden, eine verbindliche Antwort auf die Frage zu geben, worauf unsere kollektive Identität beruht und was uns verbindet. Der Wertehimmel ist nicht mehr der Gemeinsame. Die Kirchen verlieren in diesem Prozess ihre weltanschauliche Deutungshoheit. Und sie verlieren ihre Gestaltungsmacht zur sozialen Integration. Immerhin haben wir es gleichzeitig in der Moderne mit einem Zerfall metaphysischer, kultureller und religiöser Weltbilder zu tun. Wir haben nicht mehr die normativ eine vorgegebene Kultur. Folglich sind aber auch die Ordnungsvorstellungen, die Werte und die orientierungsgebenden Leitideen, die wir haben, um ein bewusstes Leben mit Bewandnis zu führen, nicht mehr eindeutig, sondern ebenso pluralisiert.
Diese Situation ist genau diejenige, die man als Überforderung der individuellen Freiheit bezeichnen muss. Die Krise unserer Demokratie ist im Wesentlichen eine Krise der Freiheit. Das Individuum ist mit der subjektiven Wahrnehmung und Inanspruchnahme der Freiheit überfordert. Auch der Staat ist nicht der autoritäre Bevormundungsstaat, der uns vorschreibt, wie wir zu leben haben. Sondern er ist das Regulativ unserer Freiheit. Das ist seine einzige Aufgabe. Das bedeutet aber auch, dass der Staat nicht garantieren kann, welche Traditionen für uns wichtig sind oder wie wir zu leben haben. Die Selbstbeschränkung des Staates, die er sich an dem vulnerablen, prekären Punkt auferlegt, ist eine Selbstbeschränkung zugunsten der Freiheit des Einzelnen. Die Selbstbeschränkung des Staates als Ordnungssystem zugunsten der Freiheit beschränkt auch seine Möglichkeiten, für Halt und emotionale Sicherheit zu sorgen. Rechtssanktionen und Zwangsbefugnisse sind Instrumente des Staates für die Erhaltung der Freiheit. Die stärkste Waffe des Rechtsstaates ist die Rechtssetzung und -durchsetzung.Die Krise unserer Demokratie ist im Wesentlichen eine Krise der Freiheit. Das Individuum ist mit der subjektiven Wahrnehmung und Inanspruchnahme der Freiheit überfordert. Auch der Staat ist nicht der autoritäre Bevormundungsstaat, der uns vorschreibt, wie wir zu leben haben. Sondern er ist das Regulativ unserer Freiheit. Das ist seine einzige Aufgabe.
Gilt dies als Zeitbefund für die gesamte Bundesrepublik, braucht es einen spezifischen Blick auf die von der DDR geprägten Menschen. In Sachsen wird seit mehreren Jahren der Sachsenmonitor erstellt, der letztlich ein Trendmonitor für gesellschaftliche Stimmungen im Freistaat ist.34 Im zuletzt veröffentlichten Sachsenmonitor aus dem Jahr 2023 zeigt sich eine ausgeprägte Ambivalenz mit Blick auf das Demokratieverständnis und die politischen Einstellungen: Die Demokratie als Regierungsform wird überwiegend bejaht, gleichzeitig ist das Vertrauen in deren praktische Ausgestaltung und die politischen Institutionen deutlich gesunken. 83 Prozent der Sachsen halten die Demokratie für eine gute Regierungsform. Die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie liegt jedoch nur bei 41 Prozent für Deutschland. Das Vertrauen in die Landesregierung ist auf 44 Prozent gesunken, ebenso in den Landtag (44 Prozent); dem Bundestag vertrauen nur noch 23 Prozent der Sachsen. Parteien genießen nur noch bei 10 Prozent großes Vertrauen; 46 Prozent der Befragten können keiner der existierenden Parteien Sympathie entgegenbringen. 63 Prozent finden, dass der Mehrheitswille der Bevölkerung auch gegen Gerichte und das Grundgesetz durchgesetzt werden sollte. Im Vergleich zur vorangegangenen Erhebung im Jahr 2021 zeigen alle Werte eine erhebliche Verschlechterung. Auffällig sind jedoch die Daten zur Identität als Ostdeutsche: 86 Prozent der Befragten sind stolz auf das, was seit 1990 in Sachsen erreicht wurde. Dabei ist der Stolz unabhängig vom persönlichen Maß an Zufriedenheit, Alter oder Bildungsabschluss sehr breit getragen. Die historische Bewertung als Unrechtsstaat hat zugenommen: 60 Prozent aller Befragten stimmen zu, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung wünscht sich, dass deutschlandweit stärker über die Umbrüche und Erfahrungen nach der Wiedervereinigung gesprochen wird. Die Zahlen lassen den Schluss zu, dass die Menschen im Osten der Republik nicht die DDR zurückwollen, aber sich zu wenig in den Strukturen und Mechanismen der Bundesrepublik angenommen fühlen.
Der Bruch (von 1989) hat eine Dynamik entwickelt, der die Identitätsfrage neu aufwirft. Dies hilft, die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern vorschnell zu stigmatisieren, wie es in den vergangenen Jahren oft artikuliert wurde.35 Im Konglomerat der Ursachen für die Resonanz auf Thesen populistischer Parteien sind dabei folgende Beobachtungen besonders in den Blick zu nehmen sowie Antwort-Möglichkeiten christlicher Theologie:
- Ein System- und Wertewandel ist für die Ostdeutschen keine erfahrungsleere Warnung, sondern ein in der eigenen Biografie zutiefst verankerter Prozess. Schon einmal erlebten die Menschen die Veränderung der eigenen Heimat in einem Maß, das über die eigenen Anpassungswünsche hinausging und sich der eigenen Kontrolle ab einem gewissen Punkt entzog. Mit der Flüchtlingskrise und den daraus erwachsenden Wahrnehmungen erhalten solche Verlustängste eine Renaissance. Das Gefühl der Machtlosigkeit angesichts der ‚von oben‘ verordneten Veränderungen äußert sich in Form – übrigens nicht erst 2015 während der Migrationskrise, sondern bereits vorher 2003/4 während der Veränderungen der Hartz-reformen. Aber auch die Krisen der vergangenen Jahre, vor allem der gesellschaftliche Umgang mit Corona und die Positionierung im Ukraine-Krieg sind dafür Beispiele.
Die Theologie hat in ihrer begründeten Hoffnung auf das schon angebrochene Reich Gottes die Möglichkeit, mit ihrem Handeln eine verbindliche Hoffnung zu vermitteln, die einen staatlich vorgegebenen wie auch individuellen Horizont übersteigt. Dabei kann es nicht nur um eine Stärkung der Glaubenden gehen, sondern um eine stete Bereitschaft, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach dieser Hoffnung fragt. Andererseits ist es eine zentrale Aufgabe der pastoralen Mitarbeiter, in allen innerkirchlichen – notwendigen – Strukturprozessen die Verunsicherung durch sich verändernde Verantwortlichkeiten zu vermeiden, um einen weiteren Heimatverlust zu erzeugen.
Politische Entscheidungsprozesse konnten nicht Step by Step erlernt und verstanden werden. Fertig ausgebildete Strukturen wurden nach 1989 übernommen. Mit dem Systemwandel stand die Bevölkerung der ehemaligen DDR damit vor der Herausforderung, im alltäglichen Handeln die Notwendigkeit, Regeln und Verhaltensweisen der völlig anderen, sehr von sich überzeugten und rechtlich hoch komplizierten bundesdeutschen Ordnung zu verstehen und für ihr Leben zu transferieren. Hinzu kam die Fremdheit des politischen Prozesses des deliberativen, langwierigen Interessenausgleichs.Um aber in der aktuellen Situation die Akzeptanz für die demokratischen Entscheidungsprozesse zu fördern, kann es zum Dienst der Kirche werden, partizipative Prozesse mit den verschiedenen Gruppen der Gesellschaft einzuüben.
Weil die Kirche die freiheitliche Demokratie als die beste aller Staatsformen anerkannt hat, kommt ihr auch die Aufgabe zu, sich in ihr zu engagieren und für sie zu werben. Es kann nicht darum gehen, einzelne Parteien zu (dis-)qualifizieren, sondern sie aus der Perspektive des christlichen Menschenbilds für ein Engagement zugunsten der Menschenwürde, der daraus resultierenden Menschenrechte und des nachhaltigen und solidarischen Gemeinwohls zu motivieren. Um aber in der aktuellen Situation die Akzeptanz für die demokratischen Entscheidungsprozesse zu fördern, kann es zum Dienst der Kirche werden, partizipative Prozesse mit den verschiedenen Gruppen der Gesellschaft einzuüben und dafür notwendige Bildungsangebote zu unterstützen sowie eigene Entscheidungsstrukturen auf die partizipative – synodale – Verwirklichung hin zu überprüfen.
Hans Joachim Meyer erläutert, dass viele Ostdeutsche nach ersten Enttäuschungen aufgegeben haben, sich in das (vor-)strukturierte Spiel ‚Demokratie’ einzubringen und damit Energie und Augenmaß, Ausdauer und Konfliktbereitschaft, kommunikative Kompetenz und Argumentationsfähigkeit zu investieren.36 Aber gerade im realen Sozialismus blieb die Fähigkeit zur öffentlichen Kommunikation unterentwickelt, was nach der Wiedervereinigung spürbar auffiel. Bis heute halten sich Ostdeutsche im politischen Engagement auffällig stark zurück und scheuen sich vor der Übernahme öffentlicher Aufgaben. Zugleich wird zunehmend kritisiert, dass herausragende gesellschaftliche Positionen für Menschen aus den Neuen Bundesländern immer noch schwerer zu erreichen sind, weil Westdeutsche weiterhin auf Führungspositionen in Ostdeutschland folgen. Dies schließt jedoch die Bürger von wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Gestaltungsmacht weiterhin aus.Es geht daher also nicht nur darum, das Evangelium auf mitteldeutsch zu buchstabieren, … sondern die Menschen guten Willens zu ermutigen, sich in das (vor-)strukturierte Spiel ‚Demokratie’ hineinzubegeben und in der öffentlichen Kommunikation eigene Positionen deutlich zu vertreten.
Der christliche Glaube lebt aus der Tat, aber eben auch in besonderer Weise aus dem Wort. Ist es einerseits Aufgabe der Kirche, ihre Verkündigung immer wieder auf die sprachliche Anschlussfähigkeit gegenüber der Welt zu überprüfen, kommt es den Christen ebenso zu, prophetisch das Wort zu erheben. Dass dies nicht von allein geschieht, berichten zahlreiche biblische Berichte. Es geht daher also nicht nur darum, das Evangelium auf mitteldeutsch zu buchstabieren, wie es vor einigen Jahren der inzwischen emeritierte Bischof von Erfurt Joachim Wanke forderte, sondern die Menschen guten Willens zu ermutigen, sich in das (vor-)strukturierte Spiel ‚Demokratie’ hineinzubegeben und in der öffentlichen Kommunikation eigene Positionen deutlich zu vertreten.- Mit der Wiedervereinigung wurden etablierte westdeutsche Narrative übernommen, die sich in den zurückliegenden Jahrzehnten dort herausgebildet haben, aber von den Ostdeutschen nur schwer nachvollzogen werden können. Hierzu gehört aus christlicher Perspektive die starke Prägung der Würde des Menschen als Reflexionsebene gegen Nationalismus und Rassismus. Aber auch die Erfahrungen der ‚68er’ fehlen in einem Land, das im gleichen Jahr mit dem Prager Frühling eine Einengung der gesellschaftlichen Freiheit erlebte. Die Weitergabe von solchen biografischen Erfahrungen geschieht weniger durch Gesetze als durch eigenes Reden und Handeln. Mit dem Austausch der DDR-Eliten in Legislative, Judikative und Exekutive als auch in Wirtschaft und Medien durch westdeutsche Experten gelang zwar der Wissenstransfer und ein rascher wirtschaftlicher sowie administrativer Transformationsprozess, jedoch unterband dies zugleich auch die weitere Tradierung ostdeutscher Erfahrungen. Kaum eine Folge der Transformation nach der Wiedervereinigung dürfte so ambivalent sein und die sich entwickelnde Ostalgie sowie einen subjektiven Minderwertigkeitskomplex befördert haben, der viele Ostdeutsche nach ihrer Identität in einem vereinten Deutschland suchen lässt.
Kirchliche Räume waren nicht erst während der Friedlichen Revolution Orte freien Denkens, sondern bereits in den Jahrzehnten zuvor. Es gibt daher eigene Narrative von der Sehnsucht nach Freiheit, die es sich zu erzählen lohnt, ohne in eine Ostalgie oder Abgrenzung gegenüber anderen Bürgerinnen und Bürgern zu verfallen. Sie dürfen aber nicht andere Erfahrungen verdrängen, sondern sich gegenseitig bereichern. 35 Jahre nach der Wiedervereinigung gehört es – glücklicherweise – zur gesellschaftlichen Realität, dass Menschen mit Erfahrungen aus allen Landesteilen der Republik in Ostdeutschland leben. Deswegen muss die Kirche ihre Stimme erheben, wo die gesellschaftliche Suche nach Identität zur patriotischen Abgrenzung von ‚uns Ostdeutschen’ gegen ‚den Rest der Welt’ geschieht.
Mit dem Systemwandel einher ging eine Differenzierung in Gewinner und Verlierer der Friedlichen Revolution. Dies bezieht sich einerseits auf die wirtschaftliche Dimension, weil in den Anpassungsprozessen der ostdeutschen Wirtschaft in den 1990er Jahren ganze Familien durch Arbeitslosigkeit und den Verlust von eigentlich erwarteten Ansprüchen wie etwa bei Sozialleistungen ihren wirtschaftlichen Halt verloren. Damit einher ging ein sozialer Rückzug. Die sich daraus perpetuierende Spannung materieller Unterschiede förderte eine Haltung der Missgunst und des Neids, bei dem Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und Personen mit subsidiärem Schutz aufgrund der ihnen zuerkannten Leistungen als weitere Konkurrenten gelten. Das Problem war nicht die Hilfsbereitschaft gegenüber den Notleidenden, sondern die dadurch entstehende Verletzung des Gerechtigkeitsgefühls verbunden mit einem diffusen Gefühl des Zukurzkommens.Gerade für jene Familien aber, deren wirtschaftlicher Verliererstatus sich verfestigt und über Generationen inzwischen verfestigt hat, kommt der Pastoral eine dreifache Aufgabe zu.
Zur wirtschaftlichen Perspektivlosigkeit kam aber auch eine ideelle Differenzierung. Wer wenige Monate zuvor noch auf der gesellschaftlichen ‚Sonnenseite’ stand, erlebte nach der Friedlichen Revolution eine neue gesellschaftliche Skepsis gegenüber der eigenen Lebensleistung. Jene aber, die während der DDR für ihre Überzeugungen Nachteile in Kauf nahmen und denen es gelang, sich in dem neuen System zurecht zu finden, konnten sich zu den Gewinnern der Friedlichen Revolution zählen.
Die Christen in den Bistümern haben vielfach von den Chancen, die sich auch wirtschaftlich aus der Friedlichen Revolution ergaben, profitiert. Teilweise profitierten die durch die Gemeinden ausgebildeten Netze, um sich gerade in den Transformationsprozessen gegenseitig zu tragen. Mit der Möglichkeit, dass sich soziale Einrichtungen der Caritas frei entwickeln konnten, nahm die Kirche in den letzten Jahrzehnten auch ihre diakonische Aufgabe auf neue Weise wahr. Gerade für jene Familien aber, deren wirtschaftlicher Verliererstatus sich verfestigt und über Generationen inzwischen verfestigt hat, kommt der Pastoral eine dreifache Aufgabe zu: Zum einen, die Sensibilität für sie wach zu halten und die nötige Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten, zum zweiten darauf hinzuwirken, dass sich Ungerechtigkeit nicht verfestigt und Strukturveränderungen als Anwalt dieser Betroffenen zu werden, sowie drittens jenen, die zutiefst von einem materialistischen Weltbild geprägt sind und deren prekäres Wirtschaftsverhältnis dafür umso einschränkender wirkt, ein Gespür für die eigene, tragende Hoffnung zu geben. Dabei stehen die Gemeinden in Ostdeutschland vor der enormen Herausforderung, über Jahrzehnte gepflegte Ablehnungen und Verurteilungen gegenüber Menschen, die im System der DDR zu den Gewinnern gehörten, abzulegen und den Dialog mit ihnen zu suchen. Es geht hierbei nicht um die Verharmlosung – vielfach am eigenen Leib vieler Christen – erlebter Schuld, sondern um den barmherzigen Umgang im Wissen um die letzte Unverfügbarkeit gerechten Handelns.
Religiöse und kulturelle Vielfalt sind in Ostdeutschland auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung noch fremd. In den Neuen Bundesländern besitzt beispielsweise die Diskussion um einen Sprachkurs im Vorschulalter keine Relevanz, weil dies in den meisten Städten nicht zur Erfahrung ostdeutscher Familien gehört. Nicht selbst erlebt, kennen sie die Probleme und Herausforderungen nur aus den Medien und politischen Diskursen. Da dort aber die Situationsbeschreibung eine Zuspitzung erfährt, werden auch die Probleme vielfach übersteigert wahrgenommen, während für die Chancen einer kulturell pluralen Gesellschaft die Wahrnehmungskraft fehlt. So fremd vielen Menschen der Islam oder andere religiöse Praktiken sind, so fremd sind ihnen oftmals auch die eigenen religiösen Wurzeln. In einem Landstrich, in dem nur noch maximal ein Viertel der Bevölkerung getauft ist und bereits über mehrere Generationen jeglicher Kontakt zum Christentum verloren gegangen ist, erscheint eine bislang kulturell nicht beheimatete Religion als Fremdkörper, der – insofern er sich auch innerhalb der Gesellschaft durch Zeichen und Rituale äußert – als gesellschaftlicher Rückschritt empfunden wird. Hatte doch die DDR-Regierung über vierzig Jahre das Ende des Aberglaubens und der Religion propagiert, indem sie dem Glauben die Vernünftigkeit abgesprochen hatte. In Ostdeutschland geht es daher nicht um die Frage der ‚wahren Religion’ oder einer Sehnsucht nach der künftigen kulturprägenden Existenz des Christentums. Stattdessen bietet die Wiederkehr des Religiösen an sich im öffentlichen Raum innerhalb einer nachreligiösen Gesellschaft das Konfliktpotential.Angesichts der Konzilsdokumente Lumen Gentium und Nostra Aetatae kommt der Pastoral gerade in Mitteldeutschland die Aufgabe zu, das Wissen um die eigene Religion, aber auch um die anderen Religionen zu stärken.
Das (Nicht-) Wissen um andere Religionen und die damit einhergehende Angst unterscheidet sich in den katholischen Gemeinden kaum vom Rest der Gesellschaft. Angesichts der Konzilsdokumente Lumen Gentium und Nostra Aetatae kommt der Pastoral gerade in Mitteldeutschland die Aufgabe zu, das Wissen um die eigene Religion, aber auch um die anderen Religionen zu stärken, damit die Christen verkürzte Sichtweisen in einer weitgehend postmodern-unreligiösen Gesellschaft entlarven, die in den anderen Religionen göttliche Wahrheit aufleuchten lassen und im Dialog mit anderen Positionen ihre Sichtweise argumentativ belegen können.
Christinnen und Christen können mit ihrem Vertrauen auf Transzendenz einen entscheidenden Beitrag inmitten einer polarisierten Gesellschaft leisten. Es geht um die Verwirklichung eines auf dem christlichen Glauben fußenden Menschenbilds. Und um die Annahme der Lebenswirklichkeit vor Ort, die aus der Erfahrung von Generationen gespeist ist. Wer sie übergeht, wird die Polarisierungen im Land nicht abbauen können. Letztlich sollten dafür Christen mit Orten der Intellektualität und Spiritualität Möglichkeiten schaffen, wo sich Menschen begegnen, ihr Bild vom Menschen ins Hier und Jetzt übersetzen sowie ihre Vorstellungen von Verantwortungsübernahme inmitten der Freiheit einüben können. Denn weder Staat noch Kirche können dem Einzelnen abnehmen, was die liberale Gesellschaft im 21. Jahrhundert täglich fordert: Entscheidungen zum Guten.Christinnen und Christen können mit ihrem Vertrauen auf Transzendenz einen entscheidenden Beitrag inmitten einer polarisierten Gesellschaft leisten.

Praxis
Die katholische Kirche in der Welt der Politik. Die fruchtbare Spannung von Synodalität und Demokratie
Die katholische Kirche ist politisch präsent und relevant: weil sie keine politische Größe ist, sondern eine religiöse. Das Paradox ist die Pointe. Wegen ihrer Liebe zu Gott ist sie unabhängig von Menschenmächten – oder sollte es sein; weil Gottes- und Nächstenliebe zusammengehören, setzt sie sich nicht nur dafür ein, den Glauben weiterzugeben und die internen Beziehungen zu pflegen, sondern auch dafür, die Welt zu deuten und zu verändern, in der Politik gemacht wird – oder sollte es tun. Die Kirche ist in der Welt, um für das Evangelium Gottes vom Reich Gottes einzutreten – das unendlich größer und weiter ist als die Kirche selbst. Deshalb ist es ihr Auftrag, der auf Jesus zurückgeht, in der Öffentlichkeit für die Verbindung von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, von Freiheit und Verantwortung, von Transzendenz und Immanenz einzutreten. Ihre Verbindung mit Gott verschafft ihr politische Unabhängigkeit, ihre politische Verantwortung schützt sie vor Spiritualisierung, Isolierung und Hybris – oder sollte es.
In der katholischen Kirche bricht unter dem Leitwort Synodalität eine Verfassungsdiskussion auf, die politisch sensibel ist, weil sie das Verhältnis der Kirche zur Demokratie berührt.
Die politische Verantwortung des Evangeliums verbindet die katholische Kirche mit allen anderen Kirchen. Aber aufgrund ihrer Größe und ihrer Geschichte fällt ihr eine besondere Verantwortung zu: Sie ist in eminenter Weise international. Sie wächst. Sie muss sich gleichzeitig mit sehr verschiedenen Herrschaftsformen und Politikstilen auseinandersetzen. Sie ist teils Mehrheit, teils Minderheit. In vielen Ländern wird sie unterdrückt, in anderen ist sie dominant. Sie ist lange Zeit dem Missverständnis erlegen, selbst die Zügel des politischen Handelns in die Hand nehmen zu sollen, ohne die jesuanische Fundamentalunterscheidung zu berücksichtigen, dass dem Kaiser zu geben sei, was des Kaisers ist, weil Gott zu geben ist, was Gottes ist (nicht: der Kirche zu geben, was der Kirche ist). Sie steht in der Versuchung, mit Autokratien zu sympathisieren, weil die (angeblich) traditionelle Werte vermitteln. Sie steht auch in der Versuchung, sich auf Prinzipien zurückzuziehen, wenn es um Konkretisierungen angesichts von Zielkonflikten in Abwägungsprozessen geht. Unter ihrem Dach haben sich im 20. Jahrhundert politische Bewegungen wie die Theologie der Befreiung entwickelt, die kirchenamtlich domestiziert werden sollte und politikwissenschaftlich die Kritik auf sich gezogen hat, von ökonomischen Theorien abhängig zu sein, die unterkomplex seien. Gegenwärtig gewinnt der Neo-Integralismus an Einfluss, der eine Autonomie der Politik bezweifelt und über Ethik eine politische Macht der Kirche aufbauen will. Gleichzeitig bricht in der katholischen Kirche unter dem Leitwort Synodalität eine Verfassungsdiskussion auf, die politisch sensibel ist, weil sie das Verhältnis der Kirche zur Demokratie berührt.
Der große Aufbruch des Anfangs
Durch den Ruf Jesu in die Nachfolge und durch die österliche Sendung zu allen Völkern entsteht die Gemeinschaft der Glaubenden. Ihre frühesten Selbstbezeichnungen und starken Begriffe sind politisch – und demokratieaffin. Jesus verkündet das Königreich Gottes – und bringt dadurch die alttestamentliche Grundeinsicht neu zur Geltung, dass Gott allein der wahre König Israels wie der ganzen Welt ist und dass kein König dieser Welt Gott ist. Aus dem Bild des göttlichen Königreiches ist zwar immer wieder im Laufe der Geschichte abgeleitet worden, dass ein irdischer König, von Gott geheiligt, die Weltherrschaft übernehmen müsse – am besten in Gestalt des Papstes, des kirchlichen Oberhauptes, dem sich auch jeder christliche Kaiser und König beugen müsse. Aber diese Ableitung unterläuft die entscheidende Differenzierung zwischen Religion und Politik, die Jesus dadurch in die Welt gebracht hat, dass er das Reich Gottes verkündet und verwirklicht, aber keinen Gottesstaat gegründet, sondern das Volk Gottes gesammelt hat.
Diese Inklusion ist die Folge der Theozentrik: Der eine Gott ist der Gott für alle – und seine Kirche ist berufen, eine Kirche für alle zu sein.
Die frühesten Selbstbezeichnungen der Glaubensgemeinschaft spiegeln beides wider: die politisch brisante Präsenz in der Öffentlichkeit und die religiös begründete Transzendenz jeder Politik. Ein Grundwort, das auf die Jerusalemer Urgemeinde zurückgeht und von Paulus zu einem Schlüsselbegriff gemacht worden ist, heißt ekklesía, übersetzt mit „Kirche“ oder „Gemeinde“. Es hat eine doppelte Wurzel. Zum einen greift es die Theologie des Volkes Gottes auf, die in Israel beheimatet ist, und verweist dadurch auf die Liturgie, die Martyrie und die Diakonie als genuine Ausdrucksformen des Glaubens, die von jeder Herrschaft dieser Welt um Gottes und der Menschen willen anerkannt werden müssen und ihrerseits politisch markant sind: Der Gottesdienst wird öffentlich gefeiert, das Glaubenszeugnis wird öffentlich abgelegt, und der Dienst der Nächstenliebe wird nicht nur in den eigenen Reihen geübt, sondern auch in der Welt. Zur ekklesía gehören Juden und Griechen, Sklaven und Freie, Männer und Frauen, Gebildete und Ungebildete. Diese Inklusion ist die Folge der Theozentrik: Der eine Gott ist der Gott für alle – und seine Kirche ist berufen, eine Kirche für alle zu sein.
Eine prägnante Ausformung der paulinischen Volk-Gottes-Ekklesiologie ist das Bild der Kirche als „Leib Christi“. Es ist der politischen Theologie der Antike entlehnt, die den Staat als einen Organismus vorstellt, um die herrschenden Verhältnisse zu stabilisieren. Paulus stellt das Bild vom Kopf auf die Füße: Der Leib Christi stärkt die „Schwachen“ und ruft die „Starken“ zur Solidarität; er bringt Vielfalt durch Einheit und Solidarität durch Anerkennung zur Geltung. Der emanzipatorische Ansatz ist stark. Nicht die Diktatur ist das säkulare Pendant, wie Carl Schmitt meinte, sondern die Demokratie, allerdings nicht die antike, die elitär und patriarchal war, sondern erst die moderne, deren religiöse Wurzeln, vor allem in den Orden selten gesehen werden.
Der lange Schatten des 19. Jahrhunderts
Im 19. Jahrhundert hat sich die katholische Kirche als Bollwerk gegen die Aufklärung, gegen die Menschenrechte, gegen die Demokratie aufgebaut. Das Projekt war weder alternativlos noch konsequent, aber wirkmächtig. Es war einer katholischen Defensive geschuldet, die meinte, am Kirchenstaat festhalten zu müssen, um nicht in politische Abhängigkeit zu geraten, und gegen den „Modernismus“ der Aufklärung die katholische Identität profilieren zu müssen, um nicht der Beliebigkeit anheimzufallen. Das ideologische Mittel war die Beschwörung eines überzeitlichen „Naturrechts“, das gegen staatliche Übergriffe die Heiligkeit der Person und der Familie verteidigen sollte, das Privateigentum und die Würde der Arbeit. Das kirchenpolitische Mittel war die Entwicklung klerikaler Führung nach dem Modell der Monarchie: mit dem Papst als Oberhaupt, der zugleich oberster Gesetzgeber und Richter ist, unfehlbar in seinem Lehramt. Die Hierarchie wurde streng von oben nach unten gedacht: Die Herrschaft Jesu Christi über die Kirche stelle sich in der Herrschaft des Papstes dar, die des Papstes in derjenigen der Bischöfe und der „Pfarrherren“.
Es braucht ein Geschichtsbewusstsein, das Traditionskritik mit Respekt vor früheren Generationen verbindet und Erneuerungswillen mit dem Nutzen der Ressourcen aus Schrift und Tradition. Das Verhältnis zur Demokratie ist die Nagelprobe.
Das Projekt war zwar nie unumstritten, aber es war über lange Zeit sehr erfolgreich. Zum einen ging es mit einer dialektischen Modernisierung einher. Durch kirchliche Verwaltungen, kirchliches Recht und kirchliche Wissenschaft sollte die Wahrheit des katholischen Glaubens zum Ausdruck kommen; die päpstliche Soziallehre schärfte die Aufmerksamkeit für soziale Ungerechtigkeit, kirchliche Hilfswerke, Vereinigungen und Genossenschaften schufen diesseits von Revolutionen Abhilfe bei sozialen, ökonomischen, politischen Problemen. Zum anderen boten sich intelligenten jungen Männern Aufstiegschancen und Verantwortungspositionen, die ihnen gesellschaftlich versagt blieben, wenn sie nicht aus begüterten Kreisen stammten; die Frauenorden reüssierten und belebten sowohl Erziehungs- als auch Sozialeinrichtungen, bei denen der Staat oft versagte, die Kirche aber – auch im Eigeninteresse – Initiativen ergreifen konnte, das kirchliche Amt wurde geistlich erneuert, bis hin zum Zölibat; die Sonntagspflicht wurde eingeschärft, verbunden mit der Beichtpflicht. Die Zustimmung im Kirchenvolk zum Ausbau der Hierarchie war vielerorts hoch.
Weil der Erfolg lange Zeit groß war, fällt es vielen, die in der Kirche engagiert sind, schwer, sich von den Bildern, den Versprechungen, den Sicherungen des 19. Jahrhunderts zu lösen, während andere so schnell wie möglich den Ballast der Geschichte abwerfen wollen. Es führt kein Weg in die Vormoderne zurück; es wird keinen Weg in die Zukunft geben, der die Neuformation der katholischen Kirche nach der Aufklärung zementiert oder negiert. Es braucht ein Geschichtsbewusstsein, das Traditionskritik mit Respekt vor früheren Generationen verbindet und Erneuerungswillen mit dem Nutzen der Ressourcen aus Schrift und Tradition. Das Verhältnis zur Demokratie ist die Nagelprobe.
Die halbe Reform des 20. Jahrhunderts
Nach den Schrecken zweier Weltkriege, nach der Katastrophe des Holocaust, nach den Brüchen der Kolonialisierung hat sich die katholische Kirche im 20. Jahrhundert neu aufgestellt. Sie wird in neuen Dimensionen zur Weltkirche. Sie orientiert sich einerseits gegen den selbstgemachten Papalismus an älteren Traditionen, freieren Glaubensräumen und tieferen Frömmigkeitsschichten, so vor allem an der Bibel-, der Jugend-, der Arbeiter-, der Frauen- und der Liturgischen Bewegung. Andererseits sucht sie mit Hinweisen von Papst Johannes XXIII. nach den „Zeichen der Zeit“, die ihr die Fingerzeige Gottes außerhalb der eigenen Grenzen zeigen: in der Wissenschaft, der Kultur, der Gesellschaft, die sich auf ihre soziale und politische Verantwortung besinnt.
Die größte Frucht beider Bewegungen ist das Zweite Vatikanische Konzil. Es holt die liturgische Erneuerung ein (Sacrosanctum Concilium), überwindet das instruktionstheoretische Glaubensverständnis zugunsten eines geschichtstheologischen Offenbarungsansatzes, der Traditionskritik und Lehrentwicklungen umfasst (Dei Verbum), und orientiert die Pastoral neu in der Welt von heute (Gaudium et spes). Nicht zuletzt macht das Konzil auch erstmals in der Geschichte die Kirche selbst zum Thema (Lumen gentium) – Zeichen einer tiefen Krise, Kirche „heute“ zu sein, Zeichen aber auch des entschiedenen Selbstbewusstseins, in der Gegenwart die katholische Kirche nicht aufzugeben, sondern zu erneuern.
Es bleibt bei der Hierarchie, aber die Aufgabe des Papstes, der Bischöfe und der Priester wird darin gesehen, dem Glauben, dem Recht und der Freiheit aller zu dienen.
Der entscheidende Paradigmenwechsel vom Ersten zum Zweiten Vatikanischen Konzil besteht darin, dass die Kirche vom Volk Gottes aus gedacht wird: von der Gemeinschaft der Getauften her, die ihren Glauben leben. Es bleibt bei der Hierarchie, weil es bei der Sendung durch Christus und der apostolischen Nachfolge bleibt; aber die Aufgabe des Papstes, der Bischöfe und der Priester wird darin gesehen, dem Glauben, dem Recht und der Freiheit aller zu dienen.
Allerdings hat die kirchenoffizielle Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils die Vorzeichen vertauscht. Das kirchliche Gesetzbuch von 1983, in dem Papst Johannes Paul II. die Krönung des Konzils sah, betonte einseitig die Rechte der Kleriker, während die „Laien“ auf lediglich beratende Hilfsdienste zurückgesetzt wurden. Die Erklärung desselben Papstes 1994, die Kirche habe keine Vollmacht, Frauen zu Priestern zu weihen (Ordinatio sacerdotalis), ließ den Vatikan als Kämpfer gegen die Gleichberechtigung erscheinen. Durch die rechtliche Aufwertung des Klerus und die pastorale Abwertung der Frauen (die durch die höchsten Lobestöne ob ihrer Würde noch verstärkt wurde) geriet die Kirchen-Theologie in Schieflage. Während Johannes Paul II. mit theologischen Gründen und historischer Wirkung die Geltung der Menschenrechte im politischen Raum einklagte, konnte die katholische Kirche immer weniger erklären, warum sie intern andere Maßstäbe anlegt. In traditionellen Gesellschaften wurde der Konflikt lange zugedeckt – diese Ära endet.
Der neue Ansatz im 21. Jahrhundert
Während Papst Benedikt XVI. die Linie von Johannes Paul II. fortsetzte und sich bemühte, den ästhetischen und intellektuellen Glanz einer geistlich neu verstandenen Tradition zu verbreiten, ohne die kirchlichen Strukturen zu verändern, hat Papst Franziskus die enorme Unruhe aufgegriffen, die in der katholischen Kirche wegen der ungelösten Verfassungsfragen aufkam, und mit dem Stichwort „Synodalität“ in neue Bahnen zu lenken begonnen. Papst Leo XIV. hat sich zu diesem Kurswechsel bekannt – zu welchem Ziel er führt, entscheidet sich im Gehen.
Die Unruhe entsteht durch drei Entwicklungen, die einander überlagern.
Erstens braucht die katholische Kirche, die in der globalisierten Welt wächst und mit Lateinamerika, Asien und Afrika neue Zentren, jeweils an den Peripherien der Gesellschaft, ausbildet, eine neue Verbindung von Einheit und Vielfalt. Die katholische Kirche war noch nie so zentralistisch wie heute, weil die Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten des Durchgriffs erlaubt; sie war aber auch noch nie so plural wie heute, weil sie noch nie so groß wie heute war, noch nie so vielsprachig, noch nie so stark inkulturiert wie heute. Es fehlt in der katholischen Kirche nicht an Stimmen, die das Anti-Modernismus-Paradigma aufgreifen und die Einheit am Kampf gegen den „Gender-Wahn“ festmachen wollen, Verurteilung praktizierter Homosexualität einbeschlossen; teils sind die Konflikte kulturell, teils ideologisch bestimmt. Es braucht aber eine gemeinsame Besinnung auf das, was die katholische Kirche eint: die Liturgie und die Sakramente, Rom und das Papsttum, das zweite Vatikanische Konzil und das Bischofsamt gehören dazu, sind aber nur notwendige, nicht auch hinreichende Bestimmungen. Es fehlt an Orten, an Foren, auch an Gremien, in denen der Glaubenssinn des Gottesvolkes zur Sprache kommt – und zwar nicht unverbindlich, sondern verbindlich.
Es fehlt an Orten, an Foren, auch an Gremien, in denen der Glaubenssinn des Gottesvolkes zur Sprache kommt – und zwar nicht unverbindlich, sondern verbindlich.
Zweitens erlebt die katholische Kirche weltweit eine Bildungsexplosion, die nicht zuletzt von Frauen vorangetrieben wird. Religiöses Wissen ist nicht mehr das Privileg von Klerikern. Es gibt viele, die mitreden können und wollen, ohne dass sie geweiht sind: Ordensangehörige, lay ministers, Ehrenamtliche, Freiwillige. Für sie braucht es neue Formen und Orte, Strukturen und Institutionen verantworteter Mitarbeit. Gegenwärtig lähmen Rollenkonflikte zwischen Klerikern und anderen Engagierten die gemeinsame Arbeit. Solange die Zugangsvoraussetzungen zum kirchlichen Amt nicht verändert werden, braucht es neue Ordnungen verantwortlicher Arbeit in der Kirche und für sie. Die Erwartungen der Gläubigen an kompetente Führung sind gestiegen, weil Christsein aus Tradition immer weniger und Christsein aus Entscheidung immer mehr Bedeutung hat. Diese Verschiebung ist aus biblischer Sicht nur zu begrüßen. Sie verlangt mehr Synodalität in den Beziehungen: mehr Qualifikation und Partizipation, mehr Transparenz und Kontrolle.
Drittens muss die katholische Kirche in der globalen Welt von heute ihren Auftrag neu bestimmen, das Evangelium zu verbreiten. „Mission“ hat einen schalen Beigeschmack, wenn das Wort auf Deutsch, aber einen recht guten Klang, wenn es auf Englisch ausgesprochen wird. Die neutestamentliche Mitgift ist eine doppelte: Mission ist Befreiung, weil sie von eigenen Plausibilitäten in die weiten Räume führt, die Gottes Liebe öffnet, und weil sie Menschen die Möglichkeit bietet, Glaube und Vernunft, Verantwortung für die Welt und Hoffnung auf den Himmel, Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft und Entdeckung des eigenen Ich zu verbinden. Diese Mission hat in einer Welt der Politik, die Religion meist mit Fundamentalismus verbindet, große Bedeutung. Die Geschichte der Kirche ist ambivalent: Sie kennt Kriegstreiberei und Friedensaktionen. Die heutige Aufgabe ist klar: zwischen Ost und West, Nord und Süd zu vermitteln. Die politische Aufgabe geht aber weit über die Politik hinaus: Entscheidend ist die Entwicklung einer religiösen Zeichen- und Formensprache, die Kirche und Welt vermittelt, Tradition und Innovation, Wahrheit und Freiheit. Damit dies gelingt, braucht es nicht nur eine Erneuerung alter und die Einrichtung neuer Kommunikationsprozesse des Glaubens; es braucht nicht nur eine neue Mentalität des Miteinanders. Es braucht ebenso eine Reform des kirchlichen Rechts, das die Beteiligung der „Laien“ an Beratungs- und Entscheidungsprozessen sichert.
Es braucht ebenso eine Reform des kirchlichen Rechts, das die Beteiligung der „Laien“ an Beratungs- und Entscheidungsprozessen sichert.
Papst Franziskus hat die synodale Erneuerung der katholischen Kirche angestoßen, damit in einem weltweiten Prozess geklärt werden kann, was die kirchliche Gemeinschaft ausmacht, welche Beteiligungsformen sie braucht und wie sie ihre Sendung in der Welt von heute und morgen erfüllen kann. Er hat schon in seiner Eröffnungspredigt der Generalversammlung 2023 Synodalität scharf vom Parlamentarismus abgegrenzt – und damit nicht nur die Augen für die weltweite Krise der Demokratie geöffnet, sondern auch den kategorialen Unterschied zwischen einer politischen und einer kirchlichen Versammlung markiert. Er ist aber auch auf Kritik gestoßen, weil die Kirche sich nicht als Verächterin, sondern als Verfechterin der Demokratie äußern sollte, wenn sie den Impulsen von Johannes XXIII., des Zweiten Vatikanischen Konzils und Johannes Paul II. folgt. Deshalb wird im Schlussdokument, das Papst Franziskus sich zu eigen gemacht hat, eigens die Demokratie als Staatsform gewürdigt. Demokratie ist verantwortete Freiheit. Eine katholische Synode ist aber etwas anderes als ein politisches Parlament: Sie steht nicht der Regierung gegenüber, sondern bildet eine Versammlung aus Papst, Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und Gewählten wie Berufenen aus dem Kirchenvolk. Sie erlässt keine Gesetze, sondern ordnet das Leben der Kirche. Sie führt nicht zu reinen Mehrheitsentscheidungen, sondern zu möglichst breiten Konsensen, die der Einheit des Glaubens in der Vielfalt der Lebenswege Ausdruck verleihen. Ihre Methode ist nicht die Debatte der Parteien, sondern der Austausch im Glauben, sei es in Form der geistlichen Gespräche ignatianischer Prägung, sei es in offeneren Dialogformaten.
Die Demokratie ihrerseits ist keineswegs die reine Herrschaft der Mehrheit, als die sie Aristoteles portraitiert und kritisiert hat. In ihrer heutigen Form kennt sie Grundrechte, die nicht zur Disposition stehen. Sie kennt Minderheitenschutz. Sie muss dem „Prinzip Verantwortung“ (Hans Jonas) folgen. Sie muss das „Recht auf Rechte“ verwirklichen (Hannah Arendt).
Entwickelte Synodalität ist aber der Weg, sich dem Ziel zu nähern. Die Demokratie ist die stärkste politische Verbündete.
Kirche gab und gibt es in den verschiedensten politischen Konstellationen, auch in Diktaturen. Die Geschichte der Neuzeit und der Gegenwart stand lange Zeit im Zeichen einer Unterscheidung von Politik und Religion, die sich als späte Wirkungsgeschichte der Reich-Gottes-Botschaft Jesu erklären lässt. Die gegenwärtigen Rückfälle, die in verschiedenen Teilen der Welt zu beobachten sind, verdanken sich dem politischen Willen, Religion als Identitätsfaktor zu funktionalisieren, und dem religiösen Willen, Macht über die Seelen durch Macht über die Gesellschaft und die Kultur zu gewinnen. Beides widerspricht der Ethik des Evangeliums. Im deutschen Bundestag hat Papst Benedikt XVI. 2011 erklärt, das Christentum stehe gegen eine religiöse Begründung und für eine ethische Orientierung der Politik. In der Konsequenz liegt, dass auch für die Kirche der Zugang zur Politik nicht durch Religion, sondern durch Ethik geöffnet wird: und zwar eine, die sowohl die Systemlogik der Politik formatiert als auch die Politik mit den vorpolitischen Faktoren verbindet, die Freiheit generieren: das Ethos und das Recht.
Die römische Weltsynode 2021–2024 hat der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass die katholische Kirche durch entwickelte Synodalität ein Friedensfaktor in der Welt der Politik sein kann. Von dieser Vision ist sie derzeit weit entfernt. Entwickelte Synodalität ist aber der Weg, sich dem Ziel zu nähern. Die Demokratie ist die stärkste politische Verbündete.

Praxis
„Die Verständigungsrepublik“ im Kleinen. Ein zukunftsfähiges Gesellschaftsmodell in polarisierenden Zeiten
Hinzu kommt eine konfliktscheue Alltagskultur. Viele Menschen weichen heiklen Themen aus, um Spannungen zu vermeiden. Ein gutes Drittel hat Beziehungskontakte schon abgebrochen. Und doch ist das Bedürfnis, gerade über strittige Fragen zu sprechen, unverkennbar. 64 Prozent führen solche Gespräche im geschützten Nahraum. Als geeignete öffentliche Verständigungsräume gelten vor allem (Bürger-)Versammlungen vor Ort. Sie werden von einer Mehrheit als tragfähige Umgebung für respektvolle, sachliche Auseinandersetzungen gesehen. Was dabei als entscheidend gilt, ist erstaunlich eindeutig: neutrale Moderation, klare Regeln, ein gemeinsam nutzbares Faktenfenster und ein Rahmen, der Würde und Sicherheit garantiert. Diese Konstellation ist kein Nischenwunsch, sondern Mehrheitsmeinung.
Ihr Versprechen ist nicht ausschließlich Einigkeit, sondern die verlässliche Erfahrung von Fairness.
Die Schattenseite ist ein Klima der Sorge. Eine übergroße Mehrheit fürchtet wachsenden Hass und eine Verrohung des Umgangs. Die Menschen erleben gesellschaftliche Konflikte nicht primär als inhaltliche Differenzen, sondern als Beziehungsrisiko und als Möglichkeit, beschämt, abgewertet oder abgehängt zu werden. Zugleich sind viele privat zufrieden und im Kleinen handlungsfähig. Genau diese Spannung nährt das Gefühl, dass die „große Welt“ nicht mehr verlässlich gestaltbar ist. Wer das ernst nimmt, muss Kräfte für Verständigung mobilisieren, ohne die Härte realer Zielkonflikte zu verharmlosen.
Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden für ein bewusst schlichtes, zugleich robustes Gesellschaftsmodell plädiert: eine deliberativ-solidarische Demokratie oder auch Verständigungsrepublik im Kleinen. Ihr Versprechen ist nicht ausschließlich Einigkeit, sondern die verlässliche Erfahrung von Fairness. Drei Pfeiler tragen diese Architektur. Erstens Wehrhaftigkeit, also die klare, rechtsstaatlich kontrollierte Abwehr menschenfeindlicher, gewaltförmiger und entwürdigender Praxis. Zweitens Deliberation, was strukturierte, regelgebundene Verständigung als selbstverständliche Infrastruktur meint, die nicht als Event-Zutat daherkommt. Inkludiert sind hierbei Verfahren, die aus Dissens Entscheidungen machen, ohne Minderheiten zu demütigen. Drittens Solidarität, also eine konkrete Rücksicht auf Verletzliche, die Beteiligung nicht vom Mut zur Selbstentblößung abhängig macht, sondern von zugesicherten Schutz- und Unterstützungsbedingungen.
Warum könnte dieses Modell zukunftsfähig sein, ohne auf Kosten einzelner Gruppen zu funktionieren?
Weil es nicht mit leeren Versprechungen, sondern mit verlässlichen Verfahren operiert. In einer Lage, in der 75 Prozent neutrale Moderation und 69 Prozent klare Kommunikationsregeln einfordern, kann die politische Antwort nicht nur der moralische Appell sein, sondern die Zusage, dass jede relevante Aushandlung nachvollziehbaren, überprüfbaren, inklusiven Regeln folgt und dies erkennbare Folgen hat. Die Verständigungsrepublik verspricht nicht, dass am Ende alle gewinnen, sondern dass niemand seine Würde verliert. Das schützt nicht bloß „Minderheiten“ im klassischen Sinn, sondern konkret jene, die im jeweiligen Konfliktfeld besonders verletzlich sind. Betroffene von Rassismus, andere diskriminierte Minderheiten, pflegende Angehörige, Personen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, Jugendliche ohne Lobby und ja, gelegentlich auch die „Leisen“, die in hitzigen Formaten sonst untergehen.
Kommunen, Hochschulen, Vereine, Kultur- und Religionsgemeinschaften u. a. werden zu Verständigungsorten der Bürgergesellschaft.
Zweitens rechnet sie ehrlich mit Pluralität. Polarisierung verschwindet nicht, verschwindet nicht durch gutes Zureden. Sie lässt sich nur bearbeiten. Dass eine Mehrheit (Bürger-)Versammlungen für geeignet hält, verweist auf ein lernfähiges Alltagswissen. Nähe, Konkretion, Überschaubarkeit und Ergebnisnähe sind Bedingungen produktiver Konfliktbearbeitung. Verfahren, die in der Nachbarschaft ansetzen und die Betroffenen nicht nur konsultieren, sondern Verantwortungen teilen lassen, befriedigen nicht jeden Anspruch. Aber sie machen bestimmte Dilemmata zum Gegenstand bewusster Entscheidungen. Das ist, anders als symbolische „Beteiligung“, anstrengend. Es ist zugleich die einzige Art politischer Arbeit, die Vertrauen reproduziert.
Drittens verknüpft die Verständigungsrepublik Deliberation mit sozialen Sicherheiten. Beteiligung kostet Zeit, Aufmerksamkeit, gelegentlich Geld und immer Nerven. Wer materiell verunsichert ist, meidet Debatten eher und misstraut Verfahren leichter. Deshalb gehören Aufwandsentschädigungen, Kinderbetreuung, barrierearme Formate und niedrigschwellige, mehrsprachige Zugänge zur Grundausstattung, ebenso Ombudsstellen und klare Sanktionspfade gegen Diffamierung. Damit wird Deliberation sozial überhaupt erst möglich.
Bausteine für eine gelingende „Verständigungsdemokratie“ im Kleinen
In der Praxis könnte das unspektakulär aussehen. Kommunen, Hochschulen, Vereine, Kultur- und Religionsgemeinschaften u. a. werden zu Verständigungsorten der Bürgergesellschaft. Sie laden ein, stellen Räume, qualifizieren Gastgeberinnen und Gastgeber, öffnen „Faktenfenster“, in denen geprüfte, laienverständliche Dossiers bereitstehen, und sichern Verfahren über Verhaltenskodizes ab.
Auf einer ersten, gelosten Spur arbeiten repräsentativ zusammengesetzte Bürgerräte an Optionen. Parallel öffnet eine zweite Spur niederschwellige Publikumsforen. Beide Spuren sind verbunden. Die Öffentlichkeit kann Input geben, die geloste Gruppe verhandelt, begründet, gewichtet und priorisiert. Abschließend erzwingt eine verbindliche Rückkopplung politische Folgebearbeitung. Zustimmen, begründet abweichen, aber nie „zur Kenntnis nehmen und ablegen“. So entstehen belastbare Brücken zwischen Expertise, gelebter Erfahrung und Entscheidung. Dass sich Menschen genau diese Elemente wünschen – Moderation, Regeln, Fakten, Schutz –, ist in der midi-Studie zu Verständigungsorten nicht zu übersehen.
Kirchen können in dieser Landschaft eine präzise, allerdings begrenzte Rolle übernehmen. Sie treten nicht als Weltanschauungsanbieterinnen auf, sondern als Gastgeberinnen.
Wie kommen wir dorthin, und zwar mit Menschen, die politisch Unterschiedliches wollen?
Drei Zugänge scheinen einladend. Freiheitlich-konservative Stimmen betonen Ordnung, Verlässlichkeit und Sicherheit. Sie gewinnen, wenn Beteiligung vor Überrumpelung schützt, Entscheidungen an nachvollziehbaren Prozeduren hängen und Respekt mehr ist als Etikette. Sozial-ökologische Stimmen ringen um Gerechtigkeit, Schutz der Lebensgrundlagen und Gleichwürdigkeit. Sie gewinnen, wenn Verfahren Verteilungsfragen nicht depolitisieren, sondern transparent verhandeln und in mandatierte Entscheidungen überführen, etwa in Bürgerhaushalte, Klima-Räte und Sozialausschüsse, die mit demokratischer Rückbindung experimentieren. Liberale und pluralitätsfreundliche Stimmen wollen offene Räume, Innovation und Unternehmungsgeist. Sie gewinnen, wenn die zweite Spur Beteiligung leicht macht, digital gestützt, gut moderiert ist mit niedriger Schwelle, jedoch klare Haltelinien gegen Hass und Manipulation setzt. Der kleinste gemeinsame Nenner ist überraschend stabil: Gewaltfreiheit, Unantastbarkeit der Würde, Vorrang fairer Verfahren, geteilte Faktenbasis und Ergebniswirksamkeit.
Rolle der Kirchen
Kirchen können in dieser Landschaft eine präzise, allerdings begrenzte Rolle übernehmen. Sie treten nicht als Weltanschauungsanbieterinnen auf, sondern als Gastgeberinnen. Sie verfügen über Raum, Rituale, Ehrenamtserfahrung und Seelsorgekompetenz. Dass religiöse Gemeinden als primäre Verständigungsorte aktuell nur von einer Minderheit als geeignet angesehen werden, ist eher Auftrag als Hindernis. Wer sich sichtbar professionell an Moderation, Regelklarheit und Schutz hält, kann Vertrauen herstellen, gerade weil die Studie zeigt, wie hoch die Nachfrage nach neutraler Moderation und geschützten Rahmen ist. Kirchen können zudem das stützen, was Menschen in Krisen tatsächlich Kraft gibt: Beziehungen, Freizeit- und Sinnpraktiken. Für ein Drittel spielt auch Religiosität eine Rolle. Das ist keine „Vergeistigung der Politik“, sondern eine Ressourcenpflege.
Hoffnungszeichen … dass die Sehnsucht nach Verständigung kein Elitenprojekt ist. Sie findet sich in den Küchen, auf Vereinsbänken, in WhatsApp-Gruppen …
Politischer Rahmen
Selbstverständlich stellt sich die Frage nach der politischen Übersetzung. Ohne Rahmensetzung bleibt vieles Kosmetik. Nötig wären Mindeststandards für öffentliche Beteiligung (Transparenz, Inklusion, Qualitätssicherung), eine Finanzierung, die Armut nicht zur Teilnahmebarriere macht, Kompetenzzentren für Kommunen, ein verpflichtender Einsatz deliberativer Verfahren bei besonders konfliktträchtigen Großvorhaben und eine digitale Öffentlichkeit, die dem Gemeinwohl dient. Nichts davon ist spektakulär. Aber genau diese unscheinbare Technik der Demokratie schafft das, was dem Betrieb am stärksten fehlt: Verlässlichkeit.
Gegen diese Vorschläge stehen vertraute Einwände.
- „Das dauert alles zu lange.“ Ja, Verfahren kosten Zeit. Aber gescheiterte Implementierungen, Boykotte und Gerichtsverfahren kosten mehr.
- „Die Lauten dominieren am Ende doch.“ Darum Losverfahren, Redezeit-Balance, trainierte Hosts, Sanktionsmechanismen.
- „Fakten sind umstritten.“ Eben deshalb kuratierte Dossiers mit Quellenpluralität und Peer-Review statt Link-Schlachten.
- „Schönwetter-Demokratie!“ Im Gegenteil: Wer 89 Prozent Sorge vor Hass und 86 Prozent Sorge um den gesellschaftlichen Umgang ernst nimmt, baut nicht auf Harmonie, sondern auf Strukturen, die Konflikte aushaltbar und produktiv machen.
Ausblick „Hoffnungszeichen“
Zwei Hoffnungszeichen tragen das Konzept. Erstens, dass die Sehnsucht nach Verständigung kein Elitenprojekt ist. Sie findet sich in den Küchen, auf Vereinsbänken, in WhatsApp-Gruppen u. v. a. Dass 64 Prozent im geschützten Raum über strittige Themen sprechen, zeigt eine Erfahrungsschule, an die öffentliche Verfahren anschließen können. Zweitens: Menschen wissen ziemlich genau, was sie dafür brauchen, nämlich Moderation, Regeln, Fakten und Schutz. Sie nennen zudem als geeigneten Ort die (Bürger-)Versammlung im Nahraum. Die Verständigungsrepublik knüpft daran an. Sie organisiert Streit anständig, schützt die Würde der Beteiligten und verpflichtet Entscheidungen auf begründete Verfahren. Wenn Bürgerinnen und Bürger diese Erfahrung wiederholt machen, dass sie gehört werden, dass Fakten nicht als Waffe, sondern als gemeinsame Ressource dienen, dass Ergebnisse Folgen haben, wächst Vertrauen: ineinander, in Institutionen und in die Zukunft.
Wir leben nicht im Endspiel der Demokratie, sondern am Anfang einer Lernphase mit hoher Erschöpfung, aber der Ressource Sehnsucht.
Das ist keine Utopie, sondern eine Praxis. Sie beginnt mit kleinen, nahen Formaten, in denen die Stadt über die Wärmewende im Quartier berät, Eltern und Lehrkräfte Lernzeiten fair austarieren, Pendlerinnen und Einzelhändler Lieferverkehre neu strukturieren, Migrantenvereine und Nachbarschaften über Teilhabewege verhandeln. Sie braucht politische Rückendeckung, aber noch mehr braucht sie Gastgeberinnen, die den Tisch decken, beispielsweise Kommunen, Kultureinrichtungen, Vereine, Medienhäuser, Religionsgemeinschaften u. a. m. Und sie rechnet mit Brüchen, Fehlern, Rückschlägen. Genau deshalb ist ihr Fundament nicht moralische Überlegenheit, sondern überprüfbare Fairness. Die Studie legt nahe: Wir leben nicht im Endspiel der Demokratie, sondern am Anfang einer Lernphase mit hoher Erschöpfung, aber der Ressource Sehnsucht. Wenn wir dieser Sehnsucht Formen geben, entsteht Schritt für Schritt die Kultur, die wir vermissen. Die Verständigungsrepublik wäre der nüchterne Name dafür.

Praxis
Demokratie reparieren!
Wie Beteiligungsinnovationen auf Repräsentationsprobleme reagieren und warum Polarisierung nicht immer schlecht ist
Zweifelsohne verlangen die Herausforderungen der Zeit – von der Erosion klassischer gesellschaftlicher Institutionen über (empfundene) gesellschaftliche Polarisierung bis hin zu globalen Krisen wie dem drohenden Zusammenbruch von Ökosystemen, der Verknappung von Ressourcen und humanitären Krisen als Folgen grausamer Zusammenspiele aus Klimawandel und Gewalt – neue Antworten, wie gutes und gerechtes Zusammenleben nachhaltig gestaltet werden kann. Allein: Modelle gesellschaftlichen Zusammenlebens, verstanden als konzeptionelle Systematisierung komplexer Interdependenzen, Modelle, die überzeugend und umfassend, nachhaltig und gerecht die weitgehende Behebung von Dysfunktionalitäten unserer bisherigen gesellschaftlichen, demokratischen Praxis in Deutschland (um nur den näheren Kontext der Autorin zu adressieren) – zum Beispiel wachsende soziale Ungleichheit, Exklusion marginalisierter Gruppen, regionale Disparitäten und Segregation – ausweisen, sind rar gesät, um es vorsichtig auszudrücken. Wenn die großen Entwürfe – allein aufgrund der Komplexität der Problemzusammenhänge – fehlen, werden Verfahrensfragen interessanter. Wie kommen wir in eine gesellschaftliche Situation, von der wir denken, dass sie mit ihrem epistemischen wie praktischen Instrumentarium den Anforderungen der Zeit entspricht?
Disruptiv weiter?
Klassischerweise existieren zwei Modelle: Disruption und Inkrementalismus, Revolution und Reform. Vielfach wird disruptives Denken als passende Antwort auf rasante technologische und gesellschaftliche Herausforderungen betrachtet, mit ihm werden intuitiv Aufbruch und Innovation verbunden. Politisch birgt Disruption Gefahren: Disruptive Politik befördert – auch in liberalen Demokratien – einen Zug zu autoritären Methoden, wenn etwa in politischen Verfahren Widerstände schnell überwunden werden sollen und wenn komplexe Legitimationsverfahren zu aufwendig erscheinen, um möglichst rasch Neues zu setzen.
Gleichwohl gibt es Plädoyers für ‚helle‘ Disruptionen, wie etwa kürzlich von Bernd Ulrich formuliert: Die Herausforderungen der Polykrise erforderten klare Schnitte und Zumutungen sowie eine synergetische Adressierung der Probleme – das alles im Sinne einer nachhaltigen, am Gemeinwohl orientierten Gestaltung liberaldemokratischer Zukünfte. Unabhängig davon zeigt sich gegenwärtig allerdings in vielen politischen Kontexten, wie disruptives Denken und Handeln und Autoritarismus ungute Allianzen eingehen, welche der liberalen Demokratie Schaden zufügen. Ein anschauliches Beispiel dafür ist der disruptive politische Habitus des 47. Präsidenten der Vereinigen Staaten.Wie kommen wir in eine gesellschaftliche Situation, von der wir denken, dass sie mit ihrem epistemischen wie praktischen Instrumentarium den Anforderungen der Zeit entspricht?
Disruption und Autoritarismus
Autoritär agierenden Akteur:innen gilt der Status Quo nämlich nicht als bewahrenswert, es geht ihnen um die Überwindung der alten Ordnung, die autoritäre Perspektive drängt ins Aktivistische. Autoritäres Denken, das hat Thomas Biebricher ausführlich in seiner Studie Mitte/Rechts (2023) dargestellt, findet sich dabei nicht nur unter Akteur:innen der extremen Rechten, sondern auch unter Akteur:innen eines sich radikalisierenden Konservatismus mit autoritärer Ausrichtung (vgl. Strobl 2022). Auch die autoritäre Alternative zum gemäßigten Konservatismus sucht den Bruch mit Bestehendem, sie hat etwas Umstürzlerisches und ist insofern prozedural weit entfernt vom erfahrungsbasierten Inkrementalismus als Kernkonzept eines gemäßigten Konservatismus. Im autoritären Modell geht es nicht um Verhandlungen, Verständigungen oder gar Konsens, sondern um die kompromisslose Durchsetzung unteilbarer Forderungen, um Machtdurchsetzung und Machtsicherung, um unbedingte Gefolgschaft und Exklusivität – dies alles unter Verwendung dichotomer Diskurslogiken bzw. einer Dichotomisierung von Weltbildern (z. B. Volk vs. Elite, wir vs. die, Homogenität vs. Heterogenität, Wahrheit vs. Unwahrheit) (vgl. Frankenberg/Heitmeyer 2022). Dabei können die Krisen bzw. krisenhaft zugespitzte Ereignisse und Entwicklungen in den letzten Dekaden als „Treiber und Pfade des Autoritären in Betracht kommen“ (ebd., 44f.): Das Autoritäre gewinnt Attraktivität, weil von ihm „Sicherheit und Wiedergewinnung der Kontrolle erwartet wird“ (ebd., 45), faktisch folgen ihm aber Einschränkung individueller Freiheiten, Schwächung von Zivilgesellschaft und sozialem Vertrauen, Repression und Diskriminierung, soziale Ungleichheiten und politische Apathie, um nur einige Schlagworte zu nennen.
Demokratie inkrementell weiterentwickeln
Tatsächlich sind in Deutschland viele Menschen mit dem Funktionieren der Demokratie unzufrieden, wenngleich die Demokratie als Staatsform sehr hohe Zustimmungswerte erhält (vgl. Hebenstreit et al. 2025). Die Unzufriedenheit hat „sowohl rationale wie irrationale Ursachen“ (Schwan et al. 2025, 7), viele Bürger:innen thematisieren ein Repräsentationsproblem und kritisieren „eine fehlende Rückkopplung der politischen Akteure an die Interessen der Bevölkerung“ (Hebenstreit et al. 2025, 181). Faktische Problemzonen, aus denen rechte Akteur:innen agitatorisch und in destruktiv-polarisierender Absicht Kapital schlagen, sind im Interesse eines besseren Funktionierens der Demokratie zu bearbeiten, Demokratie also weiterzuentwickeln.
Die Überwindung von Repräsentationsdefiziten ist ein Akt sozialer Gerechtigkeit wie der Ermöglichung bürgerschaftlicher Selbstwirksamkeitserfahrungen. Das bedeutet vom Verfahren her, dass die Idee der Weiterentwicklung der repräsentativen Demokratie ein inkrementelles Verfahren nahelegt: Inkrementelle Innovation achtet gesellschaftliche und politische Errungenschaften und sichert in gewisser Weise die demokratische Grundordnung bzw. die Kontinuität zu den erprobten Eckpfeilern des Zusammenlebens – wie Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und die Achtung der Menschenrechte – in Zeiten des (notwendigen) Wandels. Auch ist wahrscheinlich, dass Akzeptanz und Integration von Veränderungen eher möglich sind, wenn diese allmählich und in nachvollziehbaren Schritten vonstattengeht. Inkrementalismus ist potenziell chaosavers, was in Zeiten globaler Unübersichtlichkeit verfahrenstechnisch für ihn spricht.Inkrementalismus ist potenziell chaosavers, was in Zeiten globaler Unübersichtlichkeit verfahrenstechnisch für ihn spricht.
Beteiligungsinnovationen
Wenn es um die Weiterentwicklung der repräsentativen Demokratie geht, verbreiten sich im Bereich der individuellen Bürger:innenbeteiligung zunehmend demokratische Innovationen im Sinne von Beteiligungsinnovationen. Als zukunftsfähig werden unter anderem Verfahren erachtet, die dialogorientierte, zufallsbasierte Formate wie Bürger:innenräte mit direktdemokratischen Instrumenten kombinieren, da die Kombination die jeweiligen Schwächen ausgleichen und Beteiligung sowohl inklusiver als auch wirkmächtiger gestalten kann (vgl. Geißel/Hoffmann 2024). Schwan, Gerards Iglesias und Grimm weisen dabei auf das Problem hin, dass der Wunsch nach ‚direkter‘ Demokratie „ohne Vermittlung durch Abgeordnete“ (Schwan et al. 2025, 7) mit der Tatsache konfligiert, dass das imaginierte politische Kollektivsubjekt faktisch divers ist; es besteht aus verschiedenen Interessengruppen, die auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen wollen, „mit […] durchaus unterschiedlichen Machtpotenzialen“ (ebd.). In Ergänzung zu Formaten der individuellen Bürger:innenbeteiligung schlagen Schwan, Gerards Iglesias und Grimm daher Multi-Stakeholder-Beteiligung als Innovation vor, die individuelle Interessen „gemeinwohlorientiert miteinander vermittelt“ (ebd.).
Es geht also um die Organisation konfliktuöser, dann aber deliberativer, moderierter Prozesse, in denen organisierte Interessen (vertreten durch z. B. Verbände, Gewerkschaften, NGOs, Unternehmen, Verwaltung, Parteien, auch den Kirchen) ihre Perspektiven einbringen und tragfähige, gemeinwohlorientierte Kompromisse mit Blick auf bestimmte politische Themen (in der Regel kommunal-, landes- oder bundespolitisch beauftragt) miteinander erarbeiten. Solche Formate können, so Schwan, Gerards Iglesias und Grimm, antidemokratischen Tendenzen begegnen, weil sie die Output-Legitimität politischer Prozesse stärken, da sie marginalisierte Gruppen stärken können, und weil der Gemeinwohlfokus im Unterschied zur Praxis einer Konkurrenz von Partikularinteressen soziale Kohäsion befördern kann. Multi-Stakeholder-Formate bieten mit Blick auf die Weiterentwicklung von Demokratie eine Kombination von Repräsentation und direkter Teilhabe, weil sie die parlamentarische Entscheidungsfindung nicht aussetzen wollen, sondern diese – auf kommunaler Ebene wie auf Länder- und Bundesebene – ‚unterfüttern‘.Als zukunftsfähig werden unter anderem Verfahren erachtet, die dialogorientierte, zufallsbasierte Formate wie Bürger:innenräte mit direktdemokratischen Instrumenten kombinieren.
Kirchen als Stakeholder
Auch die Kirchen können von Multi-Stakeholder-Formaten profitieren und im Konzert mit anderen zivilgesellschaftlichen Playern ihre Interessen mit Blick auf die Gestaltung des Gemeinsamen einbringen. Denkbar ist die Einbindung von Kirchen bzw. Gemeinden vor Ort als relevante Akteurinnen in Multi-Stakeholder-Beteiligungsverfahren, wenn es um Diskussionen und Entwicklung gemeinsamer Strategien zu ethisch, sozial oder anderen gesellschaftlich relevanten Themen geht, in der Stadtentwicklung, Sozialpolitik, bei Fragen im Umgang mit geflüchteten Menschen, zu Asyl oder auch bei Fragen von Armutsbekämpfung, mit Blick auf Bildungsinitiativen etc. Im Rahmen solcher partizipativer Formate ist es möglich, Zugänge zum Dialog mit Wirtschaft, Politik, Verwaltung und anderen zivilgesellschaftlichen Akteur:innen zu erhalten, wodurch kirchliche Stimmen in demokratischen Prozessen Gewicht erhalten können. Dadurch können Kirchen ‚ihre‘ Themen und Werte, zum Beispiel zu Menschenwürde, sozialer Teilhabe oder Nachhaltigkeit, gezielt einbringen und zur Gemeinwohlorientierung demokratischer Entscheidungsfindung beitragen.
Es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass es solche Aushandlungsformate sind, über die Kirchen, die vielen Menschen fremd (geworden) sind, Glaubwürdigkeit gewinnen und Kompetenzzuschreibungen generieren können.
Das kann mit Blick auf Kirchen und Gemeinden gesellschaftliche Akzeptanz fördern und gibt ihnen die Möglichkeit, angesichts schwindender gesellschaftlicher Relevanz Allianzen zu knüpfen und gesellschaftliche Bedeutung über die Mitwirkung an Lösungen komplexer gesellschaftlicher Problem- und Konfliktlagen zu plausibilisieren. Von einer langen Tradition staatlicher Privilegierung herkommend, die auch um einen besonderen Auftrag der Kirchen zur Mitgestaltung des Gemeinwesens wusste, mag es für ‚das‘ kirchliche Selbstverständnis eine Herausforderung sein, sich nunmehr als ein zivilgesellschaftlicher Player unter vielen wiederzufinden. Dieser Umstand bildet schlicht die gesamtgesellschaftliche Dynamik ab, dass klassische religiöse Institutionen in Situationen weltanschaulicher Pluralität notwendigerweise selbstverständliche Bedeutungszuweisungen verlieren. Organisierte Beteiligungsprozesse wie das Multi-Stakeholder-Format entsprechen dabei dem Habermas’schen Deliberationsmodell, das idealerweise eine Konsensfindung der Verschiedenen auf Basis der Einbringung von Interessen und Argumenten vorsieht – nicht eine Durchsetzung von Interessen und Positionen aufgrund von Privilegien und Macht. Und es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass es solche Aushandlungsformate sind, über die Kirchen, die vielen Menschen fremd (geworden) sind, Glaubwürdigkeit gewinnen und Kompetenzzuschreibungen generieren können.
Polarisierung – wenn schon, dann richtig!
Es erscheint mir wesentlich, Dysfunktionalitäten repräsentativer Demokratie zu benennen, zu debattieren und alles daran zu setzen, sie zu beheben – und sie nicht rechten Akteur:innen zu ‚überlassen‘, die sie zugunsten ihrer antiliberalen und antipluralen Agenda instrumentalisieren. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, Funktionsweisen gegenwärtiger Gesellschaft zu verstehen, um politisch klug handeln zu können. Einen interessanten Vorschlag hat kürzlich Nils Kumkar gemacht, nämlich ‚richtig‘ zu polarisieren und damit nicht zuletzt die Logiken rechtspopulistischer bzw. rechtsextremer Polarisierung zu irritieren. Kumkar weist noch einmal auf den Umstand hin, dass gesellschaftliche Polarisierung kaum als empirisch vorfindliche Verteilung von Haltungen und Einstellungen zu fassen ist, sondern dass Polarisierung „ein strukturell in der Funktionslogik der politischen Öffentlichkeit angelegtes Ordnungsmuster der Selbstverständigung“ (Kumkar 2025, 222) ist, das mehr oder weniger unvermeidlich ist. Über kommunikative Polarisierung wird zudem Inklusion gewährleistet und – zumindest temporär und affektiv – eine Entfremdung von Politik minimiert. Kumkar weist darauf hin, dass rechte Akteur:innen freilich die Strukturdynamiken für sich zu nutzen wissen, indem sich die extreme Rechte „erfolgreich als eskalierend-negativer Pol der Polarisierung in Stellung gebracht“ (Kumkar 2025, 224) hat – freilich mithilfe der Behauptung, selbst Träger eines einheitlichen Volkswillens zu sein. Man verspricht über die ideologische Einheitsfiktion eine Bearbeitung der (in vielen Fällen erst kommunikativ hergestellten) Polarisierung und eskaliert faktisch damit zugleich eben jene.
Das alternative Verfahren zur Zerstörung demokratischer Errungenschaften heißt also: die liberale, plurale Demokratie fröhlich zu reparieren.
Im Sinne einer liberaldemokratischen Gestaltung von Gesellschaft wäre geraten, auch das Geschäft der Polarisierung nicht antiliberalen, autoritären Kräften zu überlassen, dabei für die eigene politische Strategie Polarisierung zu tabuisieren, sondern diese selbst bewusst zu gestalten, also ‚richtig‘ zu polarisieren: Entscheidend ist, wie und mit welchem Ziel Konflikte aufgemacht werden, denn an sich sind demokratische Gesellschaften darauf angewiesen, Raum für kontroverse, aber faire und sachlich begründete Konflikte zu haben. Für die Entwicklung der Demokratie folgt daraus, demokratische Innovationsprozesse – ob als individuelle Beteiligungs- oder Multi-Stakeholder-Formate – nicht vorschnell auf Konsensfindungen abzurichten, sondern sie auch als Räume für legitimierte Auseinandersetzungen zu begreifen, in denen Konflikte produktiv, integrativ und gemeinwohlorientiert moderiert werden. Solche Zugänge stärken nicht nur demokratische Legitimation und Resilienz, sondern entziehen autoritären und rechtspopulistischen Agenden den Nährboden, indem notwendige Konflikte offen geführt und gesellschaftliche Vielfalt anerkannt werden. Gerade indem kommunikative Polarisierung als verantwortlich gestaltbares Moment politischer Öffentlichkeit bewusst genutzt und demokratisch moderiert wird, können aus Dissens kreative Lösungen und neue Allianzen zum Wohle des Gemeinwesens erwachsen.
Das alternative Verfahren zur Zerstörung demokratischer Errungenschaften heißt also: die liberale, plurale Demokratie fröhlich zu reparieren, auf die kommunikativen Funktionslogiken politischer Öffentlichkeit sachgemäß zu reagieren und im Sinne sozialer Gerechtigkeit möglichst viele Interessen gemeinwohlorientiert in die Aushandlungsprozesse gemeinsamer Gestaltung von Welt einzubinden.

Praxis
Was rettet die Demokratie? Impulse gegen den autoritären Umbau der Gesellschaft
1. Was ist
Die gegenwärtige Gesellschaft befindet sich in einer Krise. Darin wirken verschiedene Faktoren zusammen. Digitalisierung und Globalisierung sind starke Treiber radikaler gesellschaftlicher Veränderungen, die sich gegenseitig bedingen und verstärken. Neue technische Möglichkeiten der Kommunikation lassen die Welt zusammenschrumpfen. Zugleich geraten die Demokratien immer mehr unter Druck.
1.1 Die Krise des Kapitalismus
Damit verbunden ist eine Krise des Kapitalismus.38 Das Versprechen des Kapitalismus besagt im Kern, dass wirtschaftliches Wachstum mehr Wohlstand für alle bedeutet und die freien Kräfte des Marktes das regeln. Dass Gewinne ungleich verteilt sind, wird nicht als ernsthaftes Problem gesehen, solange genug Wachstum für alle eine Verbesserung bewirkt – auch für die Ärmeren. Dieses Versprechen kann aber gegenwärtig nicht mehr eingelöst werden. Faktisch wird es nur noch für wenige Vermögende immer besser, für die große Mehrheit dagegen schlechter.
Dafür lassen sich verschiedene Ursachen benennen. So hat sich die Ungleichverteilung von Vermögen in den letzten Jahren noch einmal deutlich verstärkt. Während der Corona-Pandemie (2020–2021) hat sich das Vermögen der zehn reichsten Milliardäre verdoppelt(!), während 160 Millionen Menschen zusätzlich in Armut geraten sind.39 Diese Ungleichheit hat inzwischen Dimensionen angenommen, die weit jenseits der Vorstellungsfähigkeit liegen.40
Eine andere Ursache für die Krise des Kapitalismus besteht darin, dass die Grenzen des planetaren Wachstums an verschiedenen Stellen erreicht bzw. überschritten sind.
Durch den Effekt, dass viel Vermögen wiederum weiteres Vermögen generiert, sind die Verhältnisse komplett aus dem Lot und haben einen selbstverstärkenden Effekt. Wenn einzelne Menschen quasi ganze Staaten kaufen könnten, sind Methoden der Gewaltenteilung und Machtkontrolle weitgehend ausgehebelt.
Eine andere Ursache für die Krise des Kapitalismus besteht darin, dass die Grenzen des planetaren Wachstums an verschiedenen Stellen erreicht bzw. überschritten sind. Die Klimakrise ist eine Folge davon. Sie erzwingt einen grundlegenden Umbau der Gesellschaft und des Wirtschaftens, wenn das Leben für die Mehrheit der Menschen erträglich bleiben soll. Deren Eckpfeiler sind:
a) Nachhaltige, langfristig ressourcenschonende statt kurzfristig profitorientierter ressourcenverbrauchender Investitionen (dies steht allerdings in direktem Konflikt zum generellen Wachstumsparadigma).
b) Umstellung weg von fossilen hin zu erneuerbaren Energien.
Dies beinhaltet allerdings als Nebeneffekt nicht weniger als einen Umbau der globalen Machtstrukturen.
Seit der industriellen Nutzung des Erdöls gilt: Öl = Macht. Wer den Zugang zum Öl kontrolliert, hat das Sagen in der Welt. Dafür wurden nicht wenige Kriege geführt.
Erneuerbare Energien sind demgegenüber dezentral. Sie können mit vergleichsweise geringem Aufwand genutzt werden. (Ein Solarpanel oder ein Windrad sind technisch viel einfacher als eine Ölraffinerie oder ein Atomkraftwerk.) Ihre Energiequellen lassen sich schwer kontrollieren oder monopolisieren. Der Wind weht, wo er will, und die Sonne scheint an vielen Stellen. Die erneuerbaren Energien sind darum nicht nur „Freiheitsenergien“, die den Ressourcenfluch brechen, sondern auch „Friedensenergien“ (so ein Begriff von Michael Blume)41.
Der weltweite Umbau auf erneuerbare Energien lässt das gegenwärtige Machtmodell schlicht implodieren.
Der weltweite Umbau auf erneuerbare Energien lässt das gegenwärtige Machtmodell schlicht implodieren. Alle Vermögenswerte, die auf fossiler Energie basieren, werden absehbar komplett wertlos, wenn kein fossiles CO2 mehr ausgestoßen werden darf. Das hat eine revolutionäre Dimension.
1.2 Die autoritäre Wendung
Die Krise des Kapitalismus führt dazu, dass das zentrale Versprechen der Aufklärung für viele Menschen nicht mehr plausibel ist. Wenn die liberale Gesellschaft, die auf Menschenwürde, Vernunft und individuelle Freiheit setzt, nur noch Wohlstand für wenige garantieren kann und gegenüber allen anderen ihre Werte missachtet, wird sie insgesamt unglaubwürdig. Wo die praktischen Folgen der Theorie nicht entsprechen, greift dies auch die Geltung und Plausibilität der theoretischen Setzungen dahinter an. Vernunft und Menschenrechte erscheinen dann nicht mehr als lebensorientierende Prinzipien, sondern als inhaltsleere Worthülsen.
Die Annahme ist naheliegend, dass diejenigen, die bisher vom fossilen Geschäftsmodell profitiert haben, diese Zusammenhänge auch erkennen. Sie werden aber nicht tatenlos zusehen, sondern versuchen gegenzusteuern. Dies ist auf verschiedenen Ebenen zu beobachten.
a) Desinformation: Zahlreich sind die vielfältigen Kampagnen zur subversiven Streuung von Desinformation, besonders zur Klimakrise und zur Energiewende. Wenn der Wandel schon nicht komplett aufzuhalten ist, soll er damit möglichst gebremst werden
b) Autoritärer Umbau der Gesellschaft: Erheblich ist auch die finanzielle und logistische Unterstützung von nationalistischen Kräften weltweit durch sehr vermögende Einzelpersonen.
c) Populismus lebt von bewusst herbeigeführter gesellschaftlicher Spaltung und Polarisierung, indem ein Feind markiert und ein „Wir gegen die anderen“-Gefühl erzeugt wird. Dies dient auch der Ablenkung vom Problem der Ungerechtigkeit, indem die Wut darüber auf andere (Ausländer, Bürgergeldempfänger…) umgeleitet wird.
Geschichte wiederholt sich nicht identisch. Aber die Gefahr einer autoritären Wende ist sehr real.
Bereits einmal in der deutschen Geschichte war der Faschismus eine Antwort und Reaktion auf eine Krise des Kapitalismus (Weltwirtschaftskrise 1929). Der Faschismus braucht für die Machtergreifung keine Mehrheit. Ihm genügt ein fanatisches Drittel, ein eingeschüchtertes Drittel und ein desinteressiertes Drittel.42 Zur gleichen Zeit schafften es die USA mit massiven öffentlichen Investitionen im New Deal, die Überwindung der Krise mit einer Verbesserung der Lebensverhältnisse und der Bewahrung der Demokratie zu verbinden.
Geschichte wiederholt sich nicht identisch. Aber die Gefahr einer autoritären Wende ist sehr real. Demokratien sterben nicht in einem großen Knall, sondern durch schleichende Prozesse: durch Legitimitätsverlust, durch Diskursverhärtung, durch die Fragmentierung des Wissensraums und die zunehmende Rückkehr totalitärer Versuchungen.43
2. Was hilft
Was könnte helfen, diese problematischen Entwicklungen positiv zu beeinflussen?
2.1 Positive Visionen erzählen
Die derzeitige politische Polarisierung hat auch mit einem Erzählvakuum und einem Mangel an positiven Visionen für die Gesellschaft zu tun. Liberale Vorstellungen sind in der Defensive. Sie haben vielerorts ihre kulturelle Strahlkraft verloren. Der Liberalismus wirkt technokratisch, defensiv, manchmal elitär. In dieses Vakuum drängen autoritäre Bewegungen mit einfachen Erzählungen von Ordnung, Identität und Zugehörigkeit.
Wir brauchen demokratische Erzählungen, die das Gemeinsame nicht aus der Vergangenheit, sondern aus der erstrebten Zukunft ableiten.
Wenn wir der totalitären Neigung begegnen wollen, brauchen wir ein neues demokratisches Narrativ: eines, das nicht auf Homogenität basiert und die Nation als Schicksalsgemeinschaft beschwört, sondern Individualität mit Gemeinschaft und Freiheit verbindet. Es braucht dazu beides:
1) ein positives Bild einer Gesellschaft der Zukunft, und
2) anschauliche Erzählungen, die dieses Bild vermitteln.
Das erfordert eine politische Sprache, die mehr ist als Zahlen und Management. Wir brauchen demokratische Erzählungen, die das Gemeinsame nicht aus der Vergangenheit, sondern aus der erstrebten Zukunft ableiten.
2.2 Institutionelle Innovation stärkt demokratische Resilienz
Viele unserer Institutionen stammen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Sie sind nicht dafür entworfen, mit global vernetzten Desinformationsnetzwerken, KI-gesteuerten Meinungsblasen oder einer Plattform-Ökonomie umzugehen, in der Aufmerksamkeit die härteste Währung ist. Wir brauchen daher eine Ergänzung durch neue, resiliente Institutionen – digital und analog:
Gemeinwohlorientierte öffentliche digitale Räume
Die Informationsinfrastruktur muss als Teil der Daseinsvorsorge verstanden werden. Eine rechtliche Regulierung der bestehenden kommerziellen Plattformen ist zwingend nötig, genügt aber nicht. Wir brauchen öffentlich-rechtliche, gemeinwohlorientierte digitale Räume – als Alternative und Gegengewicht zu kommerziellen Plattformen. Der Kurznachrichtendienst Mastodon als Teil des auf Open Source basierenden Netzwerkzusammenschlusses Fediverse zeigt beispielhaft, wie eine solche Infrastruktur aussehen kann. Es braucht mehr staatliches Engagement in diesem Bereich.
Neue Beteiligungsformen
Die repräsentative parlamentarische Demokratie muss ergänzt werden – durch Formate, die unmittelbare Beteiligung ermöglichen. Geloste Bürgerräte, lokale Demokratielabore, partizipative Haushalte – solche Experimente stärken nicht nur das Vertrauen, sondern auch die Kompetenz der Gesellschaft zur Selbstgestaltung.
2.3 Gesellschaftliche Sanktionierung von Lüge & Desinformation
Im zwischenmenschlichen Bereich ist es Standard, die Lüge zu ächten, weil ansonsten keine verlässliche Kommunikation und kein beziehungsorientiertes Miteinander möglich ist. In der modernen Gesellschaft werden hingegen selbst offensichtliche Lügner kaum noch bestraft. Politikern schadet es im Ansehen nur selten, nachweislich gelogen zu haben. Dabei ist offensichtlich, dass das gezielte und strategische Lügen in Politik und Medien die Gesellschaft zerstört.
Im zwischenmenschlichen Bereich ist es Standard, die Lüge zu ächten, weil ansonsten keine verlässliche Kommunikation und kein beziehungsorientiertes Miteinander möglich ist.
Nun ist die Lüge in der Politik kein neues Phänomen. Dass sie in digitalen Öffentlichkeiten systemisch belohnt wird, ist aber eine neue Dimension. Wenn wir den Wert der Wahrheit in unserer Gesellschaft nicht aktiv schützen, verlieren wir das Fundament der Demokratie.
Kulturelle Resilienz: Wahrheit als Wert stärken
Die Grundlage jeder Strategie gegen Desinformation ist eine Gesellschaft, die Wahrheit wieder als sozialen Wert erkennt – nicht nur als private Tugend, sondern als kollektives Gut. Die Schamlosigkeit, mit der gegenwärtig öffentlich gelogen wird, muss sichtbar gemacht und gebrandmarkt werden. Lügen dürfen nicht als cleverer Trick durchgehen, sondern müssen als Vertrauensbruch markiert werden. Es braucht mehr gesellschaftliche Debatten über eine Kultur der Wahrhaftigkeit. Dabei zählt das ernsthafte Bemühen. Irrtümer sind immer möglich. Auch der Umgang mit eigenen Fehlern gehört mit in diesen Kontext.
Ebenso spielt Bildung eine Rolle: Wo kritisches Denken, Argumentationslogik, Quellenbewertung und digitale Medienkompetenz geschult werden, sinkt die Manipulierbarkeit.
Systemische Transparenz: Anreizstrukturen ändern
Lügen florieren, wenn die Kosten dafür gering, aber die Gewinne hoch sind. Es gilt also die Anreizsysteme in Politik, Medien und Wirtschaft so zu verändern, dass Wahrheit wieder lohnender wird als Desinformation.
Mittel dafür könnten sein:
- Transparenzpflichten für öffentliche Kommunikation: Politiker, Unternehmen und Medien könnten verpflichtet werden, auf Anfragen hin Belege für öffentliche Behauptungen offenzulegen – nicht zur Zensur, sondern zur Nachvollziehbarkeit. Dies könnte die Sorgfalt erhöhen und lügenhafte Polemik begrenzen.
- Konsequenzen bei erwiesener Desinformation: Wer als Politiker, Journalist oder Funktionsträger wiederholt nachweislich lügt, sollte systemische Konsequenzen spüren. In Wales wurde bereits ein entsprechender Gesetzesvorschlag eingebracht.44 Möglichkeiten wären eine temporäre Aberkennung öffentlicher Sprecherrollen in Gremien oder der Ausschluss von bestimmten Ämtern oder Funktionen. Ebenso nötig sind wirksamere Sanktionen für den Presserat bei Verstößen gegen den Pressekodex45.
- Vertrauens-Ratings statt Klickzahlen: Für Medienplattformen könnte es öffentliche, unabhängige Bewertungsmetriken geben, die auf faktischer Korrektheit, Korrekturbereitschaft und Transparenz beruhen – ähnlich einem Nachhaltigkeitssiegel. Wenn erzielbare (Werbe-)einnahmen von solchen Ratings abhängig sind, werden sie mehr Beachtung finden als rein moralische Appelle.
Wahrheitsfindung muss kollaborativ und dezentral durch viele unabhängige Stellen betrieben werden (wie dies guter Brauch in der Wissenschaft ist).
Bei all diesen Bemühungen wird es entscheidend darauf ankommen, allen Versuchungen zu widerstehen, die Definition von Wahrheit zu monopolisieren. Wahrheitsfindung muss kollaborativ und dezentral durch viele unabhängige Stellen betrieben werden (wie dies guter Brauch in der Wissenschaft ist). Dazu gehört die demokratische Kontrolle über die Kontrollinstanzen. Alle Maßnahmen zur Wahrheitsförderung müssen öffentlich, überprüfbar und demokratisch legitimiert sein.
Meinungen und Fakten sind zu unterscheiden. Jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Dazu gehört in jedem Fall Offenheit für Dissens. Auch unbequeme, kontroverse Meinungen müssen Raum haben – solange sie nicht gezielt täuschen oder hetzen.
Solche Maßnahmen können nicht alle Probleme lösen. Grenzfälle bleiben. Oft wird nicht glatt gelogen, sondern nur ein Teil der Wahrheit verschwiegen. Dennoch ist es sinnvoll, auf eine Kultur der Wahrhaftigkeit hinzuarbeiten und aktiv gegen die gröbsten Missbräuche vorzugehen. Demokratie lebt davon, dass Menschen informierte Entscheidungen treffen. Dafür brauchen sie zutreffende Informationen über die sie umgebende Wirklichkeit als Basis für das gemeinsame Ringen um den richtigen Weg.
2.4 Gemeinschaft durch Teilhabe
Dass die Gesellschaft anfällig für autoritäre Konzepte ist, speist sich aus realen Erfahrungen von Kontrollverlust, Entwertung und Entfremdung. Dies ist oft eine Reaktion auf eine als unübersichtlich empfundene Welt, in der alte Sicherheiten verschwinden – ökonomisch, kulturell, sozial. Dem begegnet man nicht mit moralischer Überlegenheit, sondern mit einem inklusiven Gesellschaftsprojekt, das reale Teilhabe ermöglicht – materiell und ideell.
Die Zukunft gehört denen, die bereit sind, die Unsicherheit des Wandels auszuhalten – und ihn aktiv zu gestalten. Demokratie ist kein Zustand, sondern ein Prozess, kein Besitz, sondern eine Praxis.
Wohlstand gerecht verteilen
Wesentlich für die Akzeptanz eines demokratischen Staatswesens ist die Erfahrung seiner Wirksamkeit in der Sicherung sozialer Lebensräume. Die permanente Privatisierung von Gewinnen und Sozialisierung von Risiken und Verlusten hat die öffentlichen Kassen geplündert. Es braucht eine gerechte Besteuerung von Vermögen und Erbschaften, um den undemokratischen Machtzuwachs durch gigantische Einzelvermögen zu reduzieren. Das könnte auch den Kommunen wieder nötige finanzielle Handlungsspielräume verschaffen. Maßnahmen wie das Klimageld sollten wesentlich zur Akzeptanz der Energiewende beitragen – ihre Verschleppung ist Teil fossiler Politik.
Vielfalt einüben
Hilfreich ist Bildung zur Ambiguitätstoleranz – die Fähigkeit, mit Widersprüchen, Mehrdeutigkeiten und Unsicherheit umzugehen. Demokratien scheitern nicht an zu wenig Wissen, sondern an zu wenig Komplexitätskompetenz. Dazu können auch Beteiligungsformen (s.o. 2.2.) beitragen, die dazu motivieren, Probleme nicht eindimensional, sondern in ihrer Vielschichtigkeit wahrzunehmen. Verschiedene Meinungen in Sachfragen sind nicht Verrat am Volkskörper, sondern selbstverständliche Normalität in einer freien Gesellschaft.
Wertschätzung zeigen
Demokratie ist kein binärer Zustand. Es kann wenig oder mehr davon geben. In der Athener Demokratie waren wenige wohlhabende Bürger an den Diskussionen beteiligt. Das ist besser als eine Diktatur. Die Entwicklung der modernen Demokratien ist davon geprägt, dass immer mehr ehemals ausgegrenzte und marginalisierte Bevölkerungsgruppen nach Beteiligung und Mitbestimmung streben. Das führt bei den bisher meinungsprägenden Gruppen verständlicherweise zu Verlustängsten. Sie verlieren an Einfluss – andere gewinnen. Wo diese Prozesse gut laufen, kann ein neues gemeinsames „Wir“ entstehen.
Fazit
Die Zukunft gehört nicht jenen, die das Gestern mit harter Hand konservieren wollen. Sie gehört denen, die bereit sind, die Unsicherheit des Wandels auszuhalten – und ihn aktiv zu gestalten. Demokratie ist kein Zustand, sondern ein Prozess, kein Besitz, sondern eine Praxis.
Wenn wir dem totalitären Rückschritt begegnen wollen, brauchen wir neue Geschichten für unsere positiven Visionen, neue Beteiligungsformen und eine neue Liebe zur Wahrhaftigkeit. Erzählen wir uns mehr positive Geschichten, die zeigen, dass Fortschritt nicht Gleichschritt heißt, sondern gerechte Vielfalt.

Praxis
Dritte Orte: Eine Agentur für Demokratie in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung
Was tun in einer Gesellschaft, die als zunehmend polarisiert wahrgenommen wird, in der Kommunikation immer schwieriger wird, weil der binäre Code fehlt und sich Systemlogiken derart selbstreferentiell gerieren, wie es derzeit der Fall ist? Die Demokratie wird infrage gestellt, manchmal nur, weil wir uns nicht mehr zuhören oder weil sich Menschen unerhört finden. Digitale Beschleunigung, soziale Netzwerke, eine immer mächtiger (manche befürchten sogar: allmächtiger werdende) künstliche Intelligenz führen zu Verunsicherung, Ängsten, Filterblasen und dem Gefühl, ausgeliefert zu sein. Der implizite und explizite Vorwurf richtet sich dann zumeist auf öffentliche und also staatliche Systeme, die vorgeblich Sicherheit und Gleichheit nicht mehr gewähren können. „Ein demokratisches System nimmt im Ganzen Schaden, wenn die Infrastruktur der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit der Bürger nicht mehr auf die relevanten und entscheidungsbedürftigen Themen lenken und die Ausbildung konkurrierender öffentlicher und das heißt: qualitativ gefilterter Meinungen nicht mehr gewährleisten kann.“46 Die Verinselung und ein digitales Biedermeier führen zum Rückzug in private Räume, die Kommerzialisierung unserer Umgebung und mangelnde Überschaubarkeit unserer Gegenwart führen zum Cocooning. Ein nicht zu unterschätzender Faktor sind im Ergebnis die von Steffen Mau et al. so benannten „Triggerpunkte“, also „jene neuralgischen Stellen, an denen Meinungsverschiedenheiten hochschießen, an denen Konsens, Hinnahmebereitschaft und Indifferenz in deutlich artikulierten Dissens, ja sogar Gegnerschaft umschlagen“47, verbunden mit emotionaler Reaktion oder gar Reaktanz.
Wie kann es gelingen, den demokratischen Prozess nicht nur zu erhalten, sondern zu stärken? Wie kann es gelingen, unterschiedliche Interessenslagen zusammenzubringen, sodass ein akzeptierter Kompromiss möglich ist? Wie kann das Einhalten von Vereinbarungen praktiziert werden in dem gleichzeitig unterschiedliche Perspektiven und Lebensentwürfe Berücksichtigung finden?
Ein Blick in die Wissenschaftsgeschichte führt uns zu dem „Begründer“ der deutschen Soziologie, Ferdinand Tönnies. Er unterscheidet in seiner bekanntesten Arbeit „Gemeinschaft und Gesellschaft“ zwei idealtypische Formen sozialer Interaktion. „Gemeinschaft“, das sind enge, persönliche und direkte soziale Beziehungen, geprägt durch gegenseitiges Vertrauen. Die „Gesellschaft“ hingegen ist durch formale und zweckgerichtete Beziehungen gekennzeichnet, die auf Verträgen und rechtlichen Verpflichtungen basiert. Für Tönnies illustrierten die Begriffe den Wandel von traditionellen zu modernen Gesellschaften und die damit verbundenen sozialen Dynamiken.48 Zu konstatieren ist, dass heute der gesellschaftliche Faktor – also die Einhaltung verbindlicher Normen und Regeln – infrage gestellt und die gemeinschaftliche Dimension mit ihren eigenen Dynamiken und dem Primat des Individuellen absolut gesetzt wird.
Die Diagnose ist bekannt und bleibt gleichwohl ernüchternd. Eine moderne Gesellschaft, so sie wahrhaft „bürgerlich“ ist, also ein Kollektiv von Bürgerinnen und Bürgern, steht hier vor einer immensen Herausforderung. Wie kann es gelingen, den demokratischen Prozess nicht nur zu erhalten, sondern zu stärken? Wie kann es gelingen, unterschiedliche Interessenslagen zusammenzubringen, sodass ein akzeptierter Kompromiss möglich ist? Wie kann das Einhalten von Vereinbarungen praktiziert werden in dem gleichzeitig unterschiedliche Perspektiven und Lebensentwürfe Berücksichtigung finden?
Die Begriffe Verinselung und die Filterbubble machen deutlich, dass es an gemeinsamen Räumen (analog wie virtuell) fehlt, in denen überhaupt Dialog möglich wird. Der Dialog trägt zur Legitimität des Systems bei. Norbert Elias hat den Begriff der „Figuration“ in die Soziologie gebracht. Er besagt, dass die soziale Interaktion von unterschiedlichen Personen zu einem Ergebnis führen kann, welches einzelne nicht erreichen konnten. Aus diesen Interdependenzen wird sozusagen Macht „gemacht“.49 Entwicklungen ergeben sich aus Wechselwirkungen von sozialen Figurationen.50 Jürgen Habermas spricht von Deliberation und meint einen öffentlichen, argumentativen Austausch, bei dem Bürgerinnen und Bürger gemeinsam über politische Angelegenheiten beraten und abwägen. Auch hier ist zentral, dass es nicht vordergründig um die Durchsetzung von Macht, eigenen Ansichten oder individuellen Interessen geht, sondern um die gemeinsame Suche nach dem besseren Argument und einer vernünftigen, für alle nachvollziehbaren und akzeptablen Lösung.51 Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es Räume für Figuration und Deliberation zur Stärkung und Legitimation der Demokratie benötigt.
Ein Begriff, der in diesem Kontext immer häufiger fällt, ist der der sogenannten „Dritte Orte“, die als analoge Räume für Dialog und Diskurs an Bedeutung gewinnen können. Schauen wir uns an, was diese Orte ausmacht, welche Rolle die Raumdimension spielt und ob sie geeignet sind, als reale Plattformen Menschen zu vernetzen.
Der Begriff des „Dritten Ortes“ geht auf den US-amerikanischen Soziologen Ray Oldenburg zurück. In seinem Werk „The Great Good Place* (1989) beschreibt er „Dritte Orte“52 als Treffpunkte, in denen sich Gemeinschaft (im Sinne des Kollektivs, nicht im Tönnies’schen Sinne gesprochen) konstituieren kann, jenseits des Arbeitsplatzes oder des familiären (räumlichen) Umfelds. Für Oldenburg waren solche „Dritten Orte“ Cafés, Buchhandlungen, Biergärten, Friseursalons oder sozial-kulturelle Zentren. Der Dritte Ort ist ein Raum, der Menschen die Möglichkeit bietet, sich außerhalb von Zuhause und Arbeit zu treffen, soziale Kontakte zu knüpfen, Gemeinschaftsgefühl zu erleben und am öffentlichen Leben teilzunehmen. An diesen Orten findet ein Ideenaustausch statt, sie bieten eine Gelegenheit zur sozialen Interaktion fernab der gewohnten privaten oder beruflichen Strukturen.Der Dritte Ort ist ein Raum, der Menschen die Möglichkeit bietet, sich außerhalb von Zuhause und Arbeit zu treffen, soziale Kontakte zu knüpfen, Gemeinschaftsgefühl zu erleben und am öffentlichen Leben teilzunehmen
Oldenburg beschreibt „Dritte Orte“ als neutralen Boden, auf dem Menschen ungezwungen zusammenkommen können. Er betont die zentrale Bedeutung dieser Orte sowohl für das individuelle Wohlbefinden als auch für die Lebendigkeit der gesamten Gemeinschaft. Sie wirken der Isolation und Fragmentierung entgegen, die in modernen Gesellschaften verbreitet sind, und fördern ein Gefühl der Zugehörigkeit und des gemeinsamen Interesses. Durch die Förderung informeller Begegnungen und den Aufbau von Netzwerken stärken „Dritte Orte“ das soziale Gefüge und tragen zur allgemeinen Lebensqualität bei.
Oldenburg benennt acht wesentliche Merkmale von „Dritten Orten“: Sie sind neutral aufgestellt und für jede Person zugänglich gestaltet, sie regen zu Gesprächen und zum Diskurs an, sind örtlich leicht erreichbar und verfügen über eine Ausstattung, die keinerlei Distinktion folgt. Typischerweise gibt es Gruppen, die sich regelmäßig treffen, ohne neu Ankommende zu exkludieren. „Dritte Orte“ sind so zu gestalten, dass man sich ‚zuhause fühlt, ohne zuhause zu sein‘ (Aat Vos), und sie werden oft als eine Art „zweites Zuhause“ wahrgenommen.
An diesem Punkt muss die Diskussion ansetzen und weiterentwickelt werden. „Dritte Orte“ sollen eigentlich zweckfrei sein. Doch die absolute Zweckfreiheit ist dann, wenn wir „Dritte Orte“ als Begegnungsräume der Demokratie und als Lernorte definieren, nicht durchzuhalten.53 Innerhalb der europäischen Kulturgeschichte sind „Dritte Orte“ eng mit der lokalen Identität und der Förderung demokratischer Werte (Versammlungsfreiheit) verknüpft.Innerhalb der europäischen Kulturgeschichte sind „Dritte Orte“ eng mit der lokalen Identität und der Förderung demokratischer Werte (Versammlungsfreiheit) verknüpft.
Letztlich haben wir es mit einer Definitionsfrage zu tun und selbst Oldenborg sprach von einer demokratischen Funktion, die er als Fortführung aus der amerikanischen Gesellschaftsgeschichte herleitetet. „Third places play a broader role than that involving the political processes of a community. They have been parent to other forms of community affiliation and association that eventually coexist with them. […] Free assembly does not begin, as so many writers on the subject seem to assume, with formally organized associations. It does not begin in the Labor Temple. […] It does not begin in fraternal orders, reading circles, parent-teacher associations, or town halls. Those bodies are drawn from a prior habit of association nurtured in third places. In eighteenth-century America, the habit of association was engendered in the ordinaries, or the inns and taverns of the towns and along the waysides between the towns. It was fostered in gristmills and gunshops; in printers‘ offices and blacksmith shops. The old country store provided the daily haunt for many a second-generation settler. To the stores and restaurants that hosted informal association were later added ice cream parlors, pool halls, and the big saloons. Schools and post offices were often the centers of public gathering. Emerging towns and cities were variously rich or poor in such informal village centers. Those that lacked them had little or no social life as a result.“54
„Dritte Orte“ sind in diesem Verständnis weit mehr als bloße Treffpunkte. Sie sind Orte lebendiger Demokratie. Die Theorie kann zur Grundlage werden, öffentlichen Raum für die Teilhabe, die Figuration, die Deliberation und vor allem, für den lebendigen Austausch ohne Konsumzwang, aber mit einem fundierten Bildungsangebot zur Verfügung zu stellen. Prädestiniert für diesen Weg sind insbesondere Bibliotheken und Volkshochschulen, und zwar aus dreierlei Gründen: Erstens sind sie fast flächendeckend und auch in ländlichen Gegenden vorhanden55, zweitens haben sie eine langjährige Erfahrung und Tradition im informellen Lernen und drittens sind sie mit konkreten Räumlichkeiten verknüpft, die für neue Aufgaben eventuell nur marginal neugestaltet werden müssen. Bringt man den Ansatz einer Weiterentwicklung der Idee „Dritter Orte“ mit den vorhandenen Institutionen der kulturellen Infrastruktur zusammen mit den Überlegungen, die Jürgen Habermas formuliert hat, so kann der Auftrag, Diskursräume zu entwickeln, dezidiert im Interesse der demokratischen Öffentlichkeit liegen, denn „ohne einen geeigneten Kontext finden die für eine demokratische Legitimation der Herrschaft wesentlichen Voraussetzungen deliberativer Politik keinen Halt [mehr, M.L.] in einer Bevölkerung, von der doch ‚alle Gewalt ausgehen‘ soll. Regierungshandeln, Grundsatzurteile der Obergerichte, parlamentarische Gesetzgebung, Parteienkonkurrenz und freie politische Wahlen müssen auf eine aktive Bürgergesellschaft treffen, weil die politische Öffentlichkeit in einer Zivilgesellschaft wurzelt, die – als der Resonanzboden für die reparaturbedürftigen Störungen wichtiger Funktionssysteme – die kommunikativen Verbindungen zwischen der Politik und deren gesellschaftlichen ‚Umwelten‘ herstellt. Die Zivilgesellschaft kann […] für die Politik nur dann die Rolle einer Art von Frühwarnsystem übernehmen, wenn sie die Akteure hervorbringt, die in der Öffentlichkeit für die relevanten Themen der Bürger Aufmerksamkeit organisieren.“56 In einer zunehmend fragmentierten Stadtgesellschaft bieten sie Möglichkeiten für intergenerationellen Austausch, Integration und das Aushandeln gesellschaftlicher Themen.57Dritte Orte sind in diesem Verständnis weit mehr als bloße Treffpunkte. Sie sind Orte lebendiger Demokratie.
Der faktische gesellschaftliche Mehrwert „Dritter Orte“ manifestiert sich in ihrer Funktion als Foren (oder, um es in Analogie zur digitalen Ökonomie zu setzen) Plattformen für Dialog und Diskurs. Sie bieten einen optimierten Rahmen, in dem vielfältige Meinungen und Personen zwanglos aufeinandertreffen und (strittige) Themen verhandelt werden können, ohne dass unmittelbare Einmütigkeit oder Konsens erforderlich werden. Insbesondere in unseren Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung und demokratischer Legitimationskrisen, in denen digitale Echokammern und Filterblasen den öffentlichen Diskurs prägen, sind solche analogen Begegnungsräume von unverzichtbarer Bedeutung. Hier können die „Triggerpunkte“ thematisiert und unter Umständen sachlich erörtert werden, eine gute Begleitung und Moderation vorausgesetzt, was wiederum ein originärer Ressourcenbeitrag „Dritter Orte“ wäre (in ihren Kapazitäten wie Bildungsangeboten, Workshops, Foren, Panels o.ä.). Sie bieten den räumlichen Rahmen, in dem das „Miteinander der Unterschiedlichen“ gestaltet werden kann, eine „Agency jenseits der Politik, die dennoch hoch politisch ist, [denn, Anm. M.L.] ohne diese Scharniere des gruppenübergreifenden Austausches, ohne das Wirken der Zivilgesellschaft ist Integration durch Konflikte kaum denkbar“.58 Spontane und ungeplante, auch kontroverse Gespräche könnten zumindest zu einem zivilisierten Umgang mit der Differenz – die im Übrigen jegliches demokratisches Gemeinwesen ausmacht – verhelfen, wenn nicht sogar zu sozialen Lernprozessen führen. Die Bubble kann, Struktur im Diskurs vorausgesetzt, unter Umständen argumentatorisch verlassen werden. „Womöglich legen diese [Strukturen und Aktivitäten in den dritten Orten] den Grundstein für weitere Begegnungen und schaffen im besten Fall Zugänge zu anderen gesellschaftlichen Teilsystemen.“59
„Dritte Orte“ sind mehr als bloße Treffpunkte, sie sind sogar mehr, als Oldenburg intendiert hat. Sie sind analoge soziale Labore innerhalb der demokratischen Gesellschaft, die geprägt ist durch die digitale Transformation, eine zunehmende Beschleunigung und Komplexität. Sie bieten eine neue Möglichkeit der (Um-)Weltwahrnehmung oder „Resonanz“, wie dies Hartmut Rosa benannt hat. „Nicht das Erobern und Kontrollieren von Welt, sondern ihr Vernehmbarmachen gilt es in den Fokus des Handelns zu rücken, und der Modus politischen Handelns sollte nicht von Motiven des Durchsetzens gegen andere und gegen die Welt, sondern von der Vision und Intention des kollektiven Gestaltens des Gemeinwissens bestimmt sein.“60 In einem von Konsumzwang befreiten und prinzipiell herrschaftsfreien, demokratisch legitimierten Raum ist ein kollektives Gestalten möglich. Diese Begegnungs- und Austauschorte leisten einen wesentlichen Beitrag zur Vorbeugung gesellschaftlicher Polarisierung und zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts. In einer Ära, in der der öffentliche Diskurs fast unmöglich erscheint, stellen „Dritte Orte“ einen unverzichtbaren Beitrag für eine lebendige, demokratische und resiliente Gesellschaft dar.
