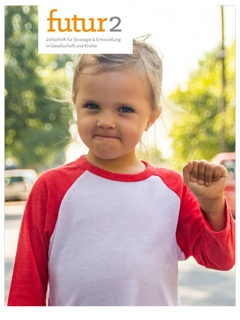Mehr als eine franziskanische Mode
Synodalität leben lernen
Wir leben in einer polarisierten und stets kampfbereiten Gesellschaft. Meinungsbildung über Gegnerschaft bis hin zur Feindschaft – das ist seit den spaltenden Diskussionen in der Coronazeit gesellschaftlicher Normalzustand geworden. Wir sind auf dem Weg in eine andere Gesellschaftskonstellation, und immer weniger gelingt es zur Zeit, Meinungsbildungsprozesse sinnstiftend zu gestalten.
Dieser Zeitgeist wirkt sich auch in der Kirche aus. Auch wenn es in Deutschland seit Jahren einen synodalen Weg gibt, wirkte in der Außenwahrnehmung dieser Meinungsbildungsprozess eher wie eine Kopie der derzeitigen gesellschaftlichen Diskussionskultur: abschreckend und frustrierend. Das ist nicht die ganze Wahrheit, denn vor allem in nicht-öffentlichen Teilgruppen fand ein intensiver und geistvoller Austausch statt. Aber leider – und das gehört auch zur Wahrheit – blieb der ganze Diskussionsvorgang den meisten auch engagierten Katholikinnen und Katholiken vor Ort merkwürdig fremd oder sogar unbekannt.
Ein langer Weg zur Synodalität
Spätestens seit 2015 hat mit Papst Franziskus eine neue Wahrnehmung und Ernstnahme des synodalen Handelns in der katholischen Kirche begonnen: Die Familiensynode brachte eine erste Neuheit, die hier in Deutschland, aber nicht nur hier, überrascht hat. Ein erster Schritt der Synodalität sollte das Hinhören, das Konsultieren sein: Was denken die Christinnen und Christen vor Ort, in den Ortskirchen, über die Familie und die damit verknüpften Fragen? Ich erinnerte mich, dass diese konkrete Nachfrage erst sehr spät ernst genommen wurde in unseren Ortskirchen. Man dachte bislang, dass in jedem Bistum eine Fachgruppe die Fragen bearbeitet, die dann ohnehin in einem Gesamtdokument „untergeht“. Diesmal war es anders – es war herausfordernd und zugleich spannend, die Meinungen und Impulse der Christinnen und Christen einzuholen und auszuwerten. Dieser Modus der Konsultation war neu – und spannend: Denn es gilt ja, die Betroffenen in das Spiel der Entscheidungsfindung zu holen – den gemeinsamen Glaubenssinn des Gottesvolkes ins Licht zu rücken. Spannend war auch, dass die Synode in zwei Episoden über zwei Jahre stattfand: Offensichtlich ging es wirklich um Meinungsbildung! Und das päpstliche Schlussdokument der Synode machte deutlich, dass diese Meinungsbildung provozieren kann, ja sogar als Provokation empfunden werden kann.Dieser Modus der Konsultation war neu – und spannend: Denn es gilt ja, die Betroffenen in das Spiel der Entscheidungsfindung zu holen – den gemeinsamen Glaubenssinn des Gottesvolkes ins Licht zu rücken.
Ein nächster Schritt, die Amazonassynode, machte deutlich, in welche Richtung die Beratungskultur sich entwickelt. Erstmals veröffentlichte der Papst kein eigenes Schlussdokument, sondern machte sich das Schlussdokument zu eigen, um eigene Bemerkungen anzufügen. Es wurde aber auch deutlich, dass auch in der Kirche Positionen unversöhnlich und zunehmend denunzierender sich gegenüberstehen. Die Bischofssynoden brauchten dringend ein methodisches Update, um nicht im Gegenüber der Meinungen stecken zu bleiben.
Impulse verpasst!
Man kann nur überrascht sein, wie wenig wir hier in Deutschland von dem weltsynodalen Prozess mitbekommen haben. Durchaus verständlich war die Kirche in Deutschland mit dem synodalen Weg beschäftigt. Aber wir haben etwas verpasst.
Verpasst haben wir eine Erfahrung der Synode selbst. Mich hat sehr beeindruckt, von Synodenteilnehmenden die Dynamik des Zuhörens erzählt zu bekommen. Echtes einander Zuhören zu inszenieren, indem jeder erstmal eine bestimmte Zeit erhält, in der er sprechen darf und die anderen zuhören sollen. Zeit zu schweigen, um zu verarbeiten, was gehört wurde – und schließlich in einer zweiten Runde wiederzugeben, was man von anderen gehört hat: Das wirkt etwas formalisiert, aber ist faszinierend, wenn man es ausprobiert. Denn hier wird deutlich, dass ein Meinungsbildungsprozess in Gang kommt, der alle Meinungen, Impulse und Gedanken aufnimmt ohne sie zu werten – und auf das gemeinsame Entdecken einer Wahrheit zielt, die kein Gesprächspartner vorher in den Blick genommen hatte.
Das ist ja auch theologisch eine Provokation: Wahrheit ereignet sich im Zwischen, in der echten Beziehung, die kenotisch gelebt wird – im radikalen Hinhören, das das Eigene loslässt und radikal aufnimmt, was der Gesprächspartner sagt. Das ändert das „Sagen“ wie das „Hören“ und ermöglicht die Geburt einer neuen Wirklichkeit. Dass diese Übung nicht „einfach so“ gelingen kann und auch bei der Synode nicht immer gelungen ist, macht deutlich, dass synodales Handeln nicht einfach eine Technik ist oder eine Methode, sondern eine Haltung und eine Kultur, die eingeübt werden muss. Darum geht es eigentlich – um eine Kultur, in der die Haltung des Evangeliums aufstrahlt: ein Leben aus der Kraft der Liebe, die ein Miteinander ermöglicht, das die Gleichwürdigkeit aller voraussetzt: Nur hier emergiert Wahrheit, nur hier zeigt sich die Orientierung und Wegrichtung des Lebens.Wahrheit ereignet sich im Zwischen, in der echten Beziehung, die kenotisch gelebt wird – im radikalen Hinhören, das das Eigene loslässt und radikal aufnimmt, was der Gesprächspartner sagt. Das ändert das „Sagen“ wie das „Hören“ und ermöglicht die Geburt einer neuen Wirklichkeit.
Der weltsynodale Prozess rückt aber noch eine weitere Perspektive in den Mittelpunkt, die mit einer Grundhaltung zu tun hat. Es gilt immer, den Raum zu weiten, um alle Menschen zur Mitwirkung einzuladen. Mich hat die Logik der Konsultation schon bei der Familiensynode bewegt, aber gerade auch der weltweite synodale Prozess setzte direkt vor Ort an. Es ging darum, beim Hören auf „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst“ gerade auch jene einzubeziehen, die nicht zum inneren Kern der Kirche gehören. Das Hören auf die Bedarfe, Fragen und Wünsche der Armen, der „Anderen“ geriet ins Zentrum. Und das ist nicht nur deswegen spannend, weil es die Umsetzung der in der Konzilkonstitution „Gaudium et spes“ benannten Selbstbeschreibung der Christen ist, sondern weil hier auch deutlich wird, dass es in der Frage der Zukunftsentwicklung kirchlichen Lebens nicht um den Selbsterhalt geht, sondern um eine radikale Infragestellung, indem die Sendung, das Evangelium allen zu bezeugen, in einer Haltung des radikalen Interesses am Leben der Anderen geschieht – und eben nicht an einem Interesse am Erhalt der Institution. Oder jesuanisch: Nur in der Hingabe sind wir wir selbst.
Mich hat deswegen unglaublich beeindruckt, wie manche Ortskirchen etwa in den Philippinen in der Rezeption des synodalen Handelns diese Ideen der Konsultation vertieft haben. Beim Nachdenken über eine Zukunftsstrategie der Diözese war eine der ersten methodischen Fragen, welche Gruppen bislang nicht in den Blick gekommen seien. Die sind zu befragen! Über dreißig Gruppen von Personen kamen in den Blick …
Dennoch bleiben auch bei den Impulsen der Weltsynode noch Fragen offen: Wie findet man bei gegensätzlichen Fragestellungen gemeinsame Lösungen? Wie kann entschieden werden – oder muss bei bleibender Uneinigkeit und Erkenntnisdifferenz die Entscheidung verschoben werden? So sehr das „decision making“ überzeugt – das „decision taking“ bleibt fragil.
Impulse verpasst?
Man kann es nicht leugnen, wir haben die Impulse der weltkirchlich-synodalen Bemühung bislang kaum aufgenommen. Das ist bedauerlich und wirklich ein Verlust, weil wir mit der Praxis der Synodalität einen wichtigen Schritt gehen könnten im Blick auf eine Kirche, in der das Volk Gottes wirklich Subjekt ihres geistgewirkten Weges werden könnte. Es ist Zeit zu beginnen.
Aber: Je länger ich über die faszinierende Perspektive synodaler Praxis nachdenke, erinnere ich mich an Erfahrungen, die für mich in Verbindung mit einer Kultur der Synodalität stehen und die darunter verborgene Ekklesiologie des Volkes Gottes, den gemeinsamen sensus fidelium zum Ausdruck bringen können.
Am Ende einer Reihe von Workshops, die ich zusammen mit Valentin Dessoy in der Diözese Graz gestalten konnte, bot Valentin Dessoy als Methode für die Schlussreflexion das „Circle Work“1 an. In einem Kreis mit allen Teilnehmenden konnte sich ein offenes Gespräch entwickeln, in dem jeder und jede eingreifen konnte – ohne jeweils zu kommentieren, mit Phase der Stille, mit unterschiedlichen Themen. Ich habe es jedes Mal als tief spirituellen Reflexionsmoment erlebt: Das Hinhören, die Offenheit für alle Beiträge und das vorsichtige Anknüpfen an Themen und Positionen der Vorredner machten diese Runden zu beeindruckenden Reflexionsereignissen. Den Raum dieses Kreises offen zu halten, das ist die Kunst des Begleiters hier – und auf diese Weise wurde ein roter Faden sichtbar, der durch die Beiträge der Teilnehmenden freigelegt wurde. Neue Erkenntnisse wurden generiert – und auf mich wirkt das wie eine Übung im synodalen Hören und Reden.
In ähnlicher Weise habe ich dies in den vergangenen Jahren erlebt im Zusammenhang „denkender Runden“. Diese Methode2 ermöglicht es, dass jeder und jede seinen Beitrag einbringen kann, ohne kommentiert zu werden und in Diskussionen zu geraten. Bei Reflexionsrunden des Priesterrats habe ich selbst ausprobiert, wie sich eine solche Methode auswirkt. Der Austausch über die Erfahrungen einer Sitzung, die Tagesreflexion im Kontext von Exposurereisen – immer entstand in einer solchen Runde, die der Reihe nach jeden einlud, seine Perspektive zu veröffentlichen, ein Erkenntnisgewinn und eine völlig andere Atmosphäre: Auch wenn die Erfahrungen und Erkenntnisse sehr unterschiedlich waren, war die Atmosphäre deutlich kreativ und inspirierend.
Und es gab einen deutlichen Erkenntnisgewinn, den wir allerdings nicht gehoben haben: Hätten wir nach einem Moment des Schweigens in einer zweiten Runde die Erkenntnisse gesammelt, hätten wir eine synodale Erfahrung gemacht.
Spannend ist aber auch, wie sehr in vielen Prozessen der Kirchenentwicklung sozialräumliche Erkundungen und Interviews mit Menschen aus dem Sozialraum eingeübt werden. Eine Kirche, die sich neu auf die Zukunft ausrichtet, ist herausgefordert, in den Lebenskontexten der Menschen nachzufragen, was diese Zeitgenossen von Kirche und den Christen in ihrem Umfeld erwarten. Die Erfahrungen solchen sozialräumlichen Suchens sind beeindruckend, weil hier ein doppelter Erkenntnisgewinn zu verzeichnen ist. Viele Gemeinden entdecken hier erstmals, wie hoch die Erwartungen sind und mit welch großer Wertschätzung auch in unserer Zeit Erwartungen an die Christen vor Ort gerichtet werden: von wegen Bedeutungslosigkeit. Auf der anderen Seite wirkt eine solche Konsultation des Umfeldes belebend: Es löst die Binnenorientierung vieler kirchlicher Gemeinden auf und öffnet sie auf die Lebenswelt – gelebte Sendung also, die ja schon in sozialen Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Familienbildungsstätten selbstverständlich gelebt wird und sie heute zu wichtigen und zuweilen wichtigsten Orten kirchlichen Handelns macht.
Eine letzte Erfahrung erzähle ich vom letzten Studientag meines Arbeitsbereichs im Bistum Hildesheim: Im Nachdenken über strategische Prozesse in unserem Bistum haben wir synodale Hörrunden eingebaut. Die Kolleginnen und Kollegen, die vorher dieses methodische Vorgehen nicht kannten, waren sehr beeindruckt – und schätzten die spirituelle Tiefe dieses Weges.
Hier wird deutlich, dass im deutschsprachigen Kontext Methoden und Wege eingeübt sind oder werden können, die aus dem Kontext der kirchlichen Organisationsentwicklung stammen. Sie haben in sich die Grundarchitektur der Synodalität – es ist eine spirituelle Grundarchitektur, denn sie nimmt die Wirklichkeit ernst, die wir Evangelium nennen: Es geht nämlich nicht um spirituelle Gebetsübungen, sondern um eine Kultur und Praxis des Miteinander, die gründet in der Überzeugung einer gleichwürdigen Verbundenheit zwischen den Menschen und der Möglichkeit, dass sich Wahrheit im Zwischen ereignen kann.Hier wird deutlich, dass im deutschsprachigen Kontext Methoden und Wege eingeübt sind oder werden können, die aus dem Kontext der kirchlichen Organisationsentwicklung stammen. Sie haben in sich die Grundarchitektur der Synodalität – es ist eine spirituelle Grundarchitektur, denn sie nimmt die Wirklichkeit ernst, die wir Evangelium nennen.
In diesem Sinn gibt es „synodale Impulse“, die einen Weg zu einer Kultur der Synodalität ermöglichen – und die schon teilweise eingeübt sind oder doch leicht eingeübt werden können.
Eine andere Demokratie
Steffen Mau hat in seinem Werk „Ungleich vereint“3 neben anderen wichtigen Beobachtungen die These vertreten, dass die Gewohnheiten und Praxen einer repräsentativen Demokratie den Ostdeutschen fremd und unzugänglich bleiben, aber andere Demokratieformen aus Ostdeutschland eine Pionierrolle für eine andere demokratische Zukunft einnehmen könnten.
Die „runden Tische“ der Wendezeit, die Experimente mit Bürgerräten und auch die Praxis des Community organizing4 reflektieren im säkularen Bereich Formen der Gemeinschaftsbildung durch Partizipation, partizipative Prozesse der Meinungsbildung und Formen der Entscheidungsfindung, die dem synodalen Handlungsgprinzipien nahekommen. Auch hier liegen Überzeugungen zugrunde, die der Synodalität nahe sind: die Gleichwürdigkeit aller Beteiligten und das Vertrauen in partizipative Prozesse, die neue Erkenntnisse hervorbringen – und nicht in alltäglich unfruchtbaren Polemiken untergehen.
Auf dem Weg zu einer anderen Kirche
Zweifellos sind wir mitten in einem tiefgreifenden Transformationsprozess und auf dem Weg zu einer anderen Kirche. Das braucht nicht erläutert zu werden. Dafür steht auch diese Zeitschrift. Entscheidend wird bei alldem aber nicht sein, mit welchen Strukturen und Sozialgestalten wir unterwegs sind – entscheidend ist vielmehr, ob Christinnen und Christen eine synodale Praxis einüben können. Hier geht es aber um mehr als um eine Mode, die seit 2015 en vogue war, sondern, so glaube ich, um eine Ekklesiopraxis des II. Vatikanischen Konzils, die auch eine neue Form gemeinsam gelebter Spiritualität und Mystik beinhaltet. Nicht Frömmigkeitsformen und biblische Übungen, die ebenso nützlich sein können, sondern eine Praxis des Miteinanders, die Maß nimmt an der geschenkten Erlösungswirklichkeit, die jeden und jede in eine Gleichwürdigkeit stellt und ins Spiel bringt. Es geht um ein Handeln, das von einer größtmöglichen Partizipation aller Beteiligten ausgeht und einen ereignisorientierten Wahrheitsverständnis den Weg bahnt. Das Sich-Ereignen und Aufgehen der Wahrheit ermöglicht die vielen Wahrheiten, macht aber deutlich, dass sie nicht verfügbar ist und Wahrheit hier nicht mit Macht verknüpft ist.Entscheidend wird bei alldem aber nicht sein, mit welchen Strukturen und Sozialgestalten wir unterwegs sind – entscheidend ist vielmehr, ob Christinnen und Christen eine synodale Praxis einüben können.
Eine solche Kirche entspricht der Vision des Volkes Gottes, wie sie im II. Vatikanischen Konzil entwickelt wurde – einer Kirche, die inmitten und mit den Zeitgenossen unserer Zeit auf der Suche nach der unverfügbaren und nicht besitzbaren Wahrheit ist, die sich uns immer neu zeigen will. Kein Zweifel, das ist herausfordernd. Vor allem hierarchisch-machtbesetzte Praxen und Gewohnheiten, die mit der klassischen kirchlichen Tradition und vor allem mit gewohnten Kirchenbildern verbunden sind, geraten hier in die Herausforderung, neu gedacht werden zu müssen. Das ist spannend und ein offener Weg. Sich auf diese neuen synodalen Wege einzulassen, ist aber das Gebot der Stunde – und weit mehr als eine franziskanische Mode.
- Christina Baldwin/Ann Linea, Die Kraft des Kreises. Gespräche und Meetings schöpferisch und effektiv gestalten, Weinheim 2014.
- Thomas L. Saaty, Creative Thinking, Problem Solving and Decision Making, Pittsburgh 2001.
- Steffen Mau, Ungleich vereint: Warum der Osten anders bleibt, Frankfurt 2024.
- Vgl. hierzu zuletzt die Überlegungen im Abschlusskapitel bei Wolfgang Beck, Sprung in den Staub: Elemente einer risikofreudigen Praxis christlichen Lebens. Ein Essay, Mainz 2024.