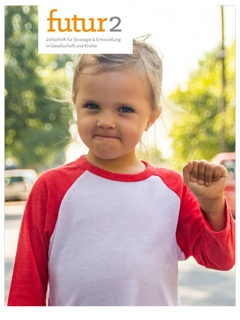Die Wiederentdeckung des tätigen Bürgertums
Ob wir rothe, gelbe Kragen,
Hüte oder Helme tragen,
Stiefeln oder Schuh’;
Oder, ob wir Röcke nähen,
Und zu Schuh’n die Fäden drehen –
Das thut nichts dazu.Ob wir können decretiren,
Oder müssen Bogen schmieren
Ohne Rast und Ruh;
Ob wir just Collegia lesen,
Oder ob wir binden Besen –
Das thut nichts dazu.Ob wir stolz zu Rosse reiten,
Ob zu Fuß wir fürbaß schreiten
Unsrem Ziele zu;
Ob uns vorne Kreuze schmücken,
Oder Kreuze hinten drücken –
Das thut nichts dazu.
Im Bürgerlied von 1845 wird vor dem Hintergrund der deutschen republikanischen Bewegung das Ideal eines solidarischen und tätigen Bürgertums besungen, das mit vereinten Kräften am Aufbau der Republik zusammenwirkt. In den ersten drei Strophen wird dieses Ideal deutlich benannt: Egal welchem Stand oder Beruf man angehört, in der zukünftigen Republik wird kein Unterschied gemacht. Alle Menschen gehören dazu und sollen Teil der Bewegung werden. In der Mitte des Liedes wechselt der Inhalt dann von einer allgemeinen Einladung zu einer Klarstellung der gewünschten Ideale der mitwirkenden Bürger*innen.
Aber, ob wir Neues bauen,
Oder’s Alte nur verdauen
Wie das Gras die Kuh –
Ob wir für die Welt was schaffen,
Oder nur die Welt begaffen –
Das thut was dazu.Ob im Kopf ist etwas Grütze
Und im Herzen Licht und Hitze,
Daß es brennt im Nu;
Oder, ob wir friedlich kauern,
Und versauern und verbauern –
Das thut was dazu.Ob wir, wo es gilt, geschäftig
Großes, Edles wirken, kräftig
Immer greifen zu;
Oder ob wir schläfrig denken:
Gott wird’s schon im Schlafe schenken –
Das thut was dazu.
Die Republik entsteht also nicht von alleine, sondern kann nur dann gelingen, wenn alle daran mitwirken. So offen und solidarisch die Einladung ist, so klar ist man ebenso, welche Ideale zu vertreten sind: Es ist das tätige Mitwirken am gemeinsamen Ziel, das die Menschen eint und als Anspruch formuliert wird.Die Republik entsteht also nicht von alleine, sondern kann nur dann gelingen, wenn alle daran mitwirken.
In der aktuellen Weltlage ist der Anspruch des Bürgerlieds aktueller denn je. Denn jenseits von Unterschieden im Detail leben alle republikanischen und demokratischen Staatsformen auch im 21. Jahrhundert davon, dass sich ihre Bürger*innen aktiv in ihre Gesellschaft einbringen. Im Lied wird das vielleicht etwas verstaubte Ideal der „mündigen Bürger*innen“ besungen. Dieses Ideal findet sich im Grundsatz auch heute noch in einer großen Breite der Gesellschaft: In Vereinen, Kirchengemeinden, Initiativgruppen und Nachbarschaften sind auch heute noch Menschen aktiv und wirken in ihrem Alltag am gesellschaftlichen Gemeinwohl mit. So zeigen die Zahlen des aktuellen Freiwilligensurveys deutlich, dass das Engagement in Summe eher zu- denn abnimmt (Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2019, 9).
Die Form des Engagements hat sich aber verändert. Mit der Veränderung von Familienstrukturen, mit geteilter Care-Verantwortung und beruflichen Mobilitätsanforderungen hat sich die Bereitschaft und die Möglichkeit für gesellschaftliches Engagement grundlegend geändert. Nicht mehr regelmäßig, dafür aber punktuell und auf Anfrage engagieren sich weiterhin viele Menschen neben ihren familiären und beruflichen Aufgaben (ebd., 31).
Hierfür gilt es Strukturen zu entwickeln, die das aufnehmen und verstärken. Es ist nicht mehr das klassische „Ehrenamt“ oder der „Freiwilligendienst“, die angestrebt werden sollen, sondern es gilt einen „Aktions-Sinn“ bei möglichst vielen Bürger*innen zu entwickeln, um gleichermaßen dem Ideal des Bürgerlieds und den Herausforderungen der Gegenwart zu entsprechen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Begriff der Aktion, dem tätigen Handeln, die in einem starken Gegensatz zum Verwalten und zum reinen Erfüllen von Funktionen steht. Die Aktion verändert, gestaltet und bringt Bestehendes in Bewegung. Die Aktion kommt aber auch mit „Sinn“ daher. Der Sinn transportiert Werte und Ideale, ist in Verbindung mit der Aktion aber selbst auch sinnhafte Wahrnehmung der Welt und engagiert sich in denjenigen Situationen, in denen solidarisches Handeln notwendig und sinnvoll ist.
Menschen mit Aktions-Sinn kümmern sich um andere, sehen Not und packen an und sind vor allem bereit, sich passend und pragmatisch den Anforderungen der heutigen Welt zu stellen. Es sind Schlüsselpersonen (Richter 2022), Viertelgestalter*innen (Hoeft et al. 2014) oder einfach Bürger*innen, die im Sinne des Bürgerlieds in Solidarität und mit Anspruch an einer besseren und demokratischen Zukunft mitwirken. Mal im Alltag verortet, mal auf ein größeres Ziel hin orientiert, wirken sie im Kleinen und Großen darauf hin, dass sich das gesellschaftliche Miteinander entwickelt und Teilhabe organisiert wird.Menschen mit Aktions-Sinn kümmern sich um andere, sehen Not und packen an und sind vor allem bereit, sich passend und pragmatisch den Anforderungen der heutigen Welt zu stellen.
Der Aktions-Sinn kann dabei nicht gemanagt oder kanalisiert werden, er gedeiht und wächst in der barmherzigen Konfrontation auf Augenhöhe. Es geht bei dieser Form der Konfrontation darum, andere Menschen mit allen ihren Fehlern und Vorurteilen dort abzuholen, wo sie in ihrem Leben gerade sind. Sie sollen nicht von etwas überzeugt oder zu etwas überredet werden, sondern in der Konfrontation auf Augenhöhe ihren eigenen Aktions-Sinn entdecken und entwickeln. Dabei entstehen bei allen Beteiligten oftmals auch Frustrationen und unerfüllte Erwartungen, dies ist aber Teil des Prozesses und muss für das gegenseitige Wachstum durchlebt werden. Barmherzigkeit heißt vor diesem Hintergrund eben auch, der gegenseitigen Beziehung immer wieder Zeit zum Wachsen zu geben und nicht in Zynismus zu verfallen oder Wut auf das (vermeintlich unsinnige) Handeln des Gegenübers zu haben.
Die Entwicklung des Aktions-Sinns kann systematisch erfolgen, wenn über die Zeit immer wieder Momente des Gesprächs und des Mit-Erlebens gesucht werden. Ausgehend von aufrichtigem Interesse an den Wünschen, Nöten, Erfahrungen und Frustrationen des Gegenübers und dem Teilen der eigenen entsteht in der barmherzigen Konfrontation auf Augenhöhe eine gegenseitige Aktions-Beziehung. Zu dieser Beziehung gehört ganz zentral dann auch die Freude, das miteinander Lachen und eventuell auch die Trauer, denn dann wird deutlich, dass man sich aufeinander zu bewegt. Dies geht nicht ohne eine wiederkehrende gegenseitige Präsenz, digital und analog, um über die Zeit immer wieder Situationen und Erfahrungen miteinander zu teilen und dadurch auch im Handeln miteinander zu wachsen. Durch eine Aktions-Beziehung muss (und sollte vielleicht auch) keine Freundschaft oder private Beziehung entstehen, es reicht, wenn das Vertrauen und der Respekt zueinander wachsen, dies ist – auch im Sinne des Bürgerlieds – schon ausreichend, um große Dinge zu bewegen.Durch eine Aktions-Beziehung muss (und sollte vielleicht auch) keine Freundschaft oder private Beziehung entstehen, es reicht, wenn das Vertrauen und der Respekt zueinander wachsen, dies ist – auch im Sinne des Bürgerlieds – schon ausreichend, um große Dinge zu bewegen.
Damit sich der Aktions-Sinn und Aktions-Beziehungen entwickeln können, ist es zwingend notwendig, immer wieder neue Aktionsräume zu eröffnen, die die Möglichkeiten des Handelns aufzeigen und dazu einladen, miteinander aktiv zu sein. Ein Aktionsraum ist dabei im besten Fall ein „Heterotopos“ (Foucault 2021), in dem sowohl die gegenwärtigen Zustände als auch die kommenden Zukünfte bereits eingeschrieben sind. Foucault spricht dabei von „Gegenräumen“ und „lokalisierten Utopien“ (ebd., 10), also Orte, die der Zeit entrissen sind und gleichsam den Raum geben, eine Gedankenreise in andere Welten zu unternehmen. Sein Beispiel ist dabei das Schiff, auf dem die Zeit ein Eigenleben entwickelt und gleichzeitig derjenige Ort ist, der zu neuen Ufern führt (ebd., 21f.). Beispiele für solche Aktionsräume gibt es en masse: Kirchengebäude können Aktionsräume sein (Bahr 2007), aber auch Stadtteilzentren, Einkaufsläden, öffentliche Plätze oder Kindergärten oder einfach alle Orte des Alltags, an denen aktionsorientierte Formen des einander Begegnens stattfinden. Denn nur dort, wo Begegnung auch zur barmherzigen Konfrontation auf Augenhöhe führt und nicht nur Dienstleistungen organisiert werden, entwickelt sich überhaupt die Chance auf die Entwicklung eines Aktions-Sinns.Denn nur dort, wo Begegnung auch zur barmherzigen Konfrontation auf Augenhöhe führt und nicht nur Dienstleistungen organisiert werden, entwickelt sich überhaupt die Chance auf die Entwicklung eines Aktions-Sinns.
Für die Entwicklung des Aktions-Sinns ist es zuletzt hilfreich, aktionsorientiertere Formen bürgerschaftlichen Engagements zu kennen und in den Aktionsräumen zu entwickeln. So hat in der Geschichte der deutschen Bundesrepublik das Mitwirken in sozialen Bewegungen seit Jahrzehnten zu individuell-biografischen und kollektiven Impulsen und Veränderungen geführt. Auch das Mitwirken in nachbarschaftlichen Netzwerken und Strukturen ist für viele Menschen der Einstieg in barmherzige Konfrontationen auf Augenhöhe, sofern diese Aktivitäten das Gefälle von Helfenden und Hilfesuchenden aufbrechen. Und zuletzt sollte darüber nachgedacht werden, ob Austausch- und Stipendienprogramme und soziale Freiwilligenjahre nicht noch mehr für viel mehr Menschen ermöglicht und ausgebaut werden sollten.
Ansatzpunkt für die Wiederentdeckung des tätigen Bürgertums gibt es also genug, nun gilt es dieses anzupacken und vor Ort zu überlegen, wo und wie der Aktions-Sinn entdeckt und ausgebaut werden kann. Denn das Bürgerlied hat noch eine letzte Strophe, die hier nicht vorenthalten werden soll, und wir halten uns an den abschließenden Appell „thun wir [unseres] denn dazu“.
Drum ihr Bürger, drum ihr Brüder,
Alle eines Bundes Glieder,
Was auch jeder thu’ –
Alle, die dies Lied gesungen
So die Alten wie die Jungen –
Thun wir denn dazu.