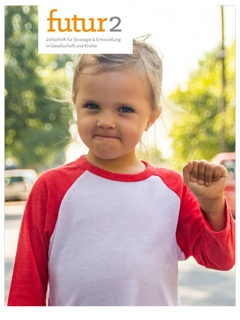Demokratie reparieren!
Wie Beteiligungsinnovationen auf Repräsentationsprobleme reagieren und warum Polarisierung nicht immer schlecht ist
Zweifelsohne verlangen die Herausforderungen der Zeit – von der Erosion klassischer gesellschaftlicher Institutionen über (empfundene) gesellschaftliche Polarisierung bis hin zu globalen Krisen wie dem drohenden Zusammenbruch von Ökosystemen, der Verknappung von Ressourcen und humanitären Krisen als Folgen grausamer Zusammenspiele aus Klimawandel und Gewalt – neue Antworten, wie gutes und gerechtes Zusammenleben nachhaltig gestaltet werden kann. Allein: Modelle gesellschaftlichen Zusammenlebens, verstanden als konzeptionelle Systematisierung komplexer Interdependenzen, Modelle, die überzeugend und umfassend, nachhaltig und gerecht die weitgehende Behebung von Dysfunktionalitäten unserer bisherigen gesellschaftlichen, demokratischen Praxis in Deutschland (um nur den näheren Kontext der Autorin zu adressieren) – zum Beispiel wachsende soziale Ungleichheit, Exklusion marginalisierter Gruppen, regionale Disparitäten und Segregation – ausweisen, sind rar gesät, um es vorsichtig auszudrücken. Wenn die großen Entwürfe – allein aufgrund der Komplexität der Problemzusammenhänge – fehlen, werden Verfahrensfragen interessanter. Wie kommen wir in eine gesellschaftliche Situation, von der wir denken, dass sie mit ihrem epistemischen wie praktischen Instrumentarium den Anforderungen der Zeit entspricht?
Disruptiv weiter?
Klassischerweise existieren zwei Modelle: Disruption und Inkrementalismus, Revolution und Reform. Vielfach wird disruptives Denken als passende Antwort auf rasante technologische und gesellschaftliche Herausforderungen betrachtet, mit ihm werden intuitiv Aufbruch und Innovation verbunden. Politisch birgt Disruption Gefahren: Disruptive Politik befördert – auch in liberalen Demokratien – einen Zug zu autoritären Methoden, wenn etwa in politischen Verfahren Widerstände schnell überwunden werden sollen und wenn komplexe Legitimationsverfahren zu aufwendig erscheinen, um möglichst rasch Neues zu setzen.
Gleichwohl gibt es Plädoyers für ‚helle‘ Disruptionen, wie etwa kürzlich von Bernd Ulrich formuliert: Die Herausforderungen der Polykrise erforderten klare Schnitte und Zumutungen sowie eine synergetische Adressierung der Probleme – das alles im Sinne einer nachhaltigen, am Gemeinwohl orientierten Gestaltung liberaldemokratischer Zukünfte. Unabhängig davon zeigt sich gegenwärtig allerdings in vielen politischen Kontexten, wie disruptives Denken und Handeln und Autoritarismus ungute Allianzen eingehen, welche der liberalen Demokratie Schaden zufügen. Ein anschauliches Beispiel dafür ist der disruptive politische Habitus des 47. Präsidenten der Vereinigen Staaten.Wie kommen wir in eine gesellschaftliche Situation, von der wir denken, dass sie mit ihrem epistemischen wie praktischen Instrumentarium den Anforderungen der Zeit entspricht?
Disruption und Autoritarismus
Autoritär agierenden Akteur:innen gilt der Status Quo nämlich nicht als bewahrenswert, es geht ihnen um die Überwindung der alten Ordnung, die autoritäre Perspektive drängt ins Aktivistische. Autoritäres Denken, das hat Thomas Biebricher ausführlich in seiner Studie Mitte/Rechts (2023) dargestellt, findet sich dabei nicht nur unter Akteur:innen der extremen Rechten, sondern auch unter Akteur:innen eines sich radikalisierenden Konservatismus mit autoritärer Ausrichtung (vgl. Strobl 2022). Auch die autoritäre Alternative zum gemäßigten Konservatismus sucht den Bruch mit Bestehendem, sie hat etwas Umstürzlerisches und ist insofern prozedural weit entfernt vom erfahrungsbasierten Inkrementalismus als Kernkonzept eines gemäßigten Konservatismus. Im autoritären Modell geht es nicht um Verhandlungen, Verständigungen oder gar Konsens, sondern um die kompromisslose Durchsetzung unteilbarer Forderungen, um Machtdurchsetzung und Machtsicherung, um unbedingte Gefolgschaft und Exklusivität – dies alles unter Verwendung dichotomer Diskurslogiken bzw. einer Dichotomisierung von Weltbildern (z. B. Volk vs. Elite, wir vs. die, Homogenität vs. Heterogenität, Wahrheit vs. Unwahrheit) (vgl. Frankenberg/Heitmeyer 2022). Dabei können die Krisen bzw. krisenhaft zugespitzte Ereignisse und Entwicklungen in den letzten Dekaden als „Treiber und Pfade des Autoritären in Betracht kommen“ (ebd., 44f.): Das Autoritäre gewinnt Attraktivität, weil von ihm „Sicherheit und Wiedergewinnung der Kontrolle erwartet wird“ (ebd., 45), faktisch folgen ihm aber Einschränkung individueller Freiheiten, Schwächung von Zivilgesellschaft und sozialem Vertrauen, Repression und Diskriminierung, soziale Ungleichheiten und politische Apathie, um nur einige Schlagworte zu nennen.
Demokratie inkrementell weiterentwickeln
Tatsächlich sind in Deutschland viele Menschen mit dem Funktionieren der Demokratie unzufrieden, wenngleich die Demokratie als Staatsform sehr hohe Zustimmungswerte erhält (vgl. Hebenstreit et al. 2025). Die Unzufriedenheit hat „sowohl rationale wie irrationale Ursachen“ (Schwan et al. 2025, 7), viele Bürger:innen thematisieren ein Repräsentationsproblem und kritisieren „eine fehlende Rückkopplung der politischen Akteure an die Interessen der Bevölkerung“ (Hebenstreit et al. 2025, 181). Faktische Problemzonen, aus denen rechte Akteur:innen agitatorisch und in destruktiv-polarisierender Absicht Kapital schlagen, sind im Interesse eines besseren Funktionierens der Demokratie zu bearbeiten, Demokratie also weiterzuentwickeln.
Die Überwindung von Repräsentationsdefiziten ist ein Akt sozialer Gerechtigkeit wie der Ermöglichung bürgerschaftlicher Selbstwirksamkeitserfahrungen. Das bedeutet vom Verfahren her, dass die Idee der Weiterentwicklung der repräsentativen Demokratie ein inkrementelles Verfahren nahelegt: Inkrementelle Innovation achtet gesellschaftliche und politische Errungenschaften und sichert in gewisser Weise die demokratische Grundordnung bzw. die Kontinuität zu den erprobten Eckpfeilern des Zusammenlebens – wie Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und die Achtung der Menschenrechte – in Zeiten des (notwendigen) Wandels. Auch ist wahrscheinlich, dass Akzeptanz und Integration von Veränderungen eher möglich sind, wenn diese allmählich und in nachvollziehbaren Schritten vonstattengeht. Inkrementalismus ist potenziell chaosavers, was in Zeiten globaler Unübersichtlichkeit verfahrenstechnisch für ihn spricht.Inkrementalismus ist potenziell chaosavers, was in Zeiten globaler Unübersichtlichkeit verfahrenstechnisch für ihn spricht.
Beteiligungsinnovationen
Wenn es um die Weiterentwicklung der repräsentativen Demokratie geht, verbreiten sich im Bereich der individuellen Bürger:innenbeteiligung zunehmend demokratische Innovationen im Sinne von Beteiligungsinnovationen. Als zukunftsfähig werden unter anderem Verfahren erachtet, die dialogorientierte, zufallsbasierte Formate wie Bürger:innenräte mit direktdemokratischen Instrumenten kombinieren, da die Kombination die jeweiligen Schwächen ausgleichen und Beteiligung sowohl inklusiver als auch wirkmächtiger gestalten kann (vgl. Geißel/Hoffmann 2024). Schwan, Gerards Iglesias und Grimm weisen dabei auf das Problem hin, dass der Wunsch nach ‚direkter‘ Demokratie „ohne Vermittlung durch Abgeordnete“ (Schwan et al. 2025, 7) mit der Tatsache konfligiert, dass das imaginierte politische Kollektivsubjekt faktisch divers ist; es besteht aus verschiedenen Interessengruppen, die auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen wollen, „mit […] durchaus unterschiedlichen Machtpotenzialen“ (ebd.). In Ergänzung zu Formaten der individuellen Bürger:innenbeteiligung schlagen Schwan, Gerards Iglesias und Grimm daher Multi-Stakeholder-Beteiligung als Innovation vor, die individuelle Interessen „gemeinwohlorientiert miteinander vermittelt“ (ebd.).
Es geht also um die Organisation konfliktuöser, dann aber deliberativer, moderierter Prozesse, in denen organisierte Interessen (vertreten durch z. B. Verbände, Gewerkschaften, NGOs, Unternehmen, Verwaltung, Parteien, auch den Kirchen) ihre Perspektiven einbringen und tragfähige, gemeinwohlorientierte Kompromisse mit Blick auf bestimmte politische Themen (in der Regel kommunal-, landes- oder bundespolitisch beauftragt) miteinander erarbeiten. Solche Formate können, so Schwan, Gerards Iglesias und Grimm, antidemokratischen Tendenzen begegnen, weil sie die Output-Legitimität politischer Prozesse stärken, da sie marginalisierte Gruppen stärken können, und weil der Gemeinwohlfokus im Unterschied zur Praxis einer Konkurrenz von Partikularinteressen soziale Kohäsion befördern kann. Multi-Stakeholder-Formate bieten mit Blick auf die Weiterentwicklung von Demokratie eine Kombination von Repräsentation und direkter Teilhabe, weil sie die parlamentarische Entscheidungsfindung nicht aussetzen wollen, sondern diese – auf kommunaler Ebene wie auf Länder- und Bundesebene – ‚unterfüttern‘.Als zukunftsfähig werden unter anderem Verfahren erachtet, die dialogorientierte, zufallsbasierte Formate wie Bürger:innenräte mit direktdemokratischen Instrumenten kombinieren.
Kirchen als Stakeholder
Auch die Kirchen können von Multi-Stakeholder-Formaten profitieren und im Konzert mit anderen zivilgesellschaftlichen Playern ihre Interessen mit Blick auf die Gestaltung des Gemeinsamen einbringen. Denkbar ist die Einbindung von Kirchen bzw. Gemeinden vor Ort als relevante Akteurinnen in Multi-Stakeholder-Beteiligungsverfahren, wenn es um Diskussionen und Entwicklung gemeinsamer Strategien zu ethisch, sozial oder anderen gesellschaftlich relevanten Themen geht, in der Stadtentwicklung, Sozialpolitik, bei Fragen im Umgang mit geflüchteten Menschen, zu Asyl oder auch bei Fragen von Armutsbekämpfung, mit Blick auf Bildungsinitiativen etc. Im Rahmen solcher partizipativer Formate ist es möglich, Zugänge zum Dialog mit Wirtschaft, Politik, Verwaltung und anderen zivilgesellschaftlichen Akteur:innen zu erhalten, wodurch kirchliche Stimmen in demokratischen Prozessen Gewicht erhalten können. Dadurch können Kirchen ‚ihre‘ Themen und Werte, zum Beispiel zu Menschenwürde, sozialer Teilhabe oder Nachhaltigkeit, gezielt einbringen und zur Gemeinwohlorientierung demokratischer Entscheidungsfindung beitragen.
Es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass es solche Aushandlungsformate sind, über die Kirchen, die vielen Menschen fremd (geworden) sind, Glaubwürdigkeit gewinnen und Kompetenzzuschreibungen generieren können.
Das kann mit Blick auf Kirchen und Gemeinden gesellschaftliche Akzeptanz fördern und gibt ihnen die Möglichkeit, angesichts schwindender gesellschaftlicher Relevanz Allianzen zu knüpfen und gesellschaftliche Bedeutung über die Mitwirkung an Lösungen komplexer gesellschaftlicher Problem- und Konfliktlagen zu plausibilisieren. Von einer langen Tradition staatlicher Privilegierung herkommend, die auch um einen besonderen Auftrag der Kirchen zur Mitgestaltung des Gemeinwesens wusste, mag es für ‚das‘ kirchliche Selbstverständnis eine Herausforderung sein, sich nunmehr als ein zivilgesellschaftlicher Player unter vielen wiederzufinden. Dieser Umstand bildet schlicht die gesamtgesellschaftliche Dynamik ab, dass klassische religiöse Institutionen in Situationen weltanschaulicher Pluralität notwendigerweise selbstverständliche Bedeutungszuweisungen verlieren. Organisierte Beteiligungsprozesse wie das Multi-Stakeholder-Format entsprechen dabei dem Habermas’schen Deliberationsmodell, das idealerweise eine Konsensfindung der Verschiedenen auf Basis der Einbringung von Interessen und Argumenten vorsieht – nicht eine Durchsetzung von Interessen und Positionen aufgrund von Privilegien und Macht. Und es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass es solche Aushandlungsformate sind, über die Kirchen, die vielen Menschen fremd (geworden) sind, Glaubwürdigkeit gewinnen und Kompetenzzuschreibungen generieren können.
Polarisierung – wenn schon, dann richtig!
Es erscheint mir wesentlich, Dysfunktionalitäten repräsentativer Demokratie zu benennen, zu debattieren und alles daran zu setzen, sie zu beheben – und sie nicht rechten Akteur:innen zu ‚überlassen‘, die sie zugunsten ihrer antiliberalen und antipluralen Agenda instrumentalisieren. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, Funktionsweisen gegenwärtiger Gesellschaft zu verstehen, um politisch klug handeln zu können. Einen interessanten Vorschlag hat kürzlich Nils Kumkar gemacht, nämlich ‚richtig‘ zu polarisieren und damit nicht zuletzt die Logiken rechtspopulistischer bzw. rechtsextremer Polarisierung zu irritieren. Kumkar weist noch einmal auf den Umstand hin, dass gesellschaftliche Polarisierung kaum als empirisch vorfindliche Verteilung von Haltungen und Einstellungen zu fassen ist, sondern dass Polarisierung „ein strukturell in der Funktionslogik der politischen Öffentlichkeit angelegtes Ordnungsmuster der Selbstverständigung“ (Kumkar 2025, 222) ist, das mehr oder weniger unvermeidlich ist. Über kommunikative Polarisierung wird zudem Inklusion gewährleistet und – zumindest temporär und affektiv – eine Entfremdung von Politik minimiert. Kumkar weist darauf hin, dass rechte Akteur:innen freilich die Strukturdynamiken für sich zu nutzen wissen, indem sich die extreme Rechte „erfolgreich als eskalierend-negativer Pol der Polarisierung in Stellung gebracht“ (Kumkar 2025, 224) hat – freilich mithilfe der Behauptung, selbst Träger eines einheitlichen Volkswillens zu sein. Man verspricht über die ideologische Einheitsfiktion eine Bearbeitung der (in vielen Fällen erst kommunikativ hergestellten) Polarisierung und eskaliert faktisch damit zugleich eben jene.
Das alternative Verfahren zur Zerstörung demokratischer Errungenschaften heißt also: die liberale, plurale Demokratie fröhlich zu reparieren.
Im Sinne einer liberaldemokratischen Gestaltung von Gesellschaft wäre geraten, auch das Geschäft der Polarisierung nicht antiliberalen, autoritären Kräften zu überlassen, dabei für die eigene politische Strategie Polarisierung zu tabuisieren, sondern diese selbst bewusst zu gestalten, also ‚richtig‘ zu polarisieren: Entscheidend ist, wie und mit welchem Ziel Konflikte aufgemacht werden, denn an sich sind demokratische Gesellschaften darauf angewiesen, Raum für kontroverse, aber faire und sachlich begründete Konflikte zu haben. Für die Entwicklung der Demokratie folgt daraus, demokratische Innovationsprozesse – ob als individuelle Beteiligungs- oder Multi-Stakeholder-Formate – nicht vorschnell auf Konsensfindungen abzurichten, sondern sie auch als Räume für legitimierte Auseinandersetzungen zu begreifen, in denen Konflikte produktiv, integrativ und gemeinwohlorientiert moderiert werden. Solche Zugänge stärken nicht nur demokratische Legitimation und Resilienz, sondern entziehen autoritären und rechtspopulistischen Agenden den Nährboden, indem notwendige Konflikte offen geführt und gesellschaftliche Vielfalt anerkannt werden. Gerade indem kommunikative Polarisierung als verantwortlich gestaltbares Moment politischer Öffentlichkeit bewusst genutzt und demokratisch moderiert wird, können aus Dissens kreative Lösungen und neue Allianzen zum Wohle des Gemeinwesens erwachsen.
Das alternative Verfahren zur Zerstörung demokratischer Errungenschaften heißt also: die liberale, plurale Demokratie fröhlich zu reparieren, auf die kommunikativen Funktionslogiken politischer Öffentlichkeit sachgemäß zu reagieren und im Sinne sozialer Gerechtigkeit möglichst viele Interessen gemeinwohlorientiert in die Aushandlungsprozesse gemeinsamer Gestaltung von Welt einzubinden.