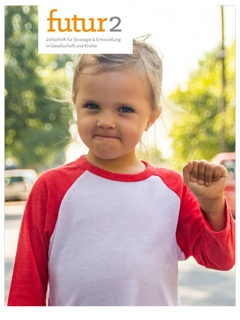Die katholische Kirche in der Welt der Politik. Die fruchtbare Spannung von Synodalität und Demokratie
Die katholische Kirche ist politisch präsent und relevant: weil sie keine politische Größe ist, sondern eine religiöse. Das Paradox ist die Pointe. Wegen ihrer Liebe zu Gott ist sie unabhängig von Menschenmächten – oder sollte es sein; weil Gottes- und Nächstenliebe zusammengehören, setzt sie sich nicht nur dafür ein, den Glauben weiterzugeben und die internen Beziehungen zu pflegen, sondern auch dafür, die Welt zu deuten und zu verändern, in der Politik gemacht wird – oder sollte es tun. Die Kirche ist in der Welt, um für das Evangelium Gottes vom Reich Gottes einzutreten – das unendlich größer und weiter ist als die Kirche selbst. Deshalb ist es ihr Auftrag, der auf Jesus zurückgeht, in der Öffentlichkeit für die Verbindung von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, von Freiheit und Verantwortung, von Transzendenz und Immanenz einzutreten. Ihre Verbindung mit Gott verschafft ihr politische Unabhängigkeit, ihre politische Verantwortung schützt sie vor Spiritualisierung, Isolierung und Hybris – oder sollte es.
In der katholischen Kirche bricht unter dem Leitwort Synodalität eine Verfassungsdiskussion auf, die politisch sensibel ist, weil sie das Verhältnis der Kirche zur Demokratie berührt.
Die politische Verantwortung des Evangeliums verbindet die katholische Kirche mit allen anderen Kirchen. Aber aufgrund ihrer Größe und ihrer Geschichte fällt ihr eine besondere Verantwortung zu: Sie ist in eminenter Weise international. Sie wächst. Sie muss sich gleichzeitig mit sehr verschiedenen Herrschaftsformen und Politikstilen auseinandersetzen. Sie ist teils Mehrheit, teils Minderheit. In vielen Ländern wird sie unterdrückt, in anderen ist sie dominant. Sie ist lange Zeit dem Missverständnis erlegen, selbst die Zügel des politischen Handelns in die Hand nehmen zu sollen, ohne die jesuanische Fundamentalunterscheidung zu berücksichtigen, dass dem Kaiser zu geben sei, was des Kaisers ist, weil Gott zu geben ist, was Gottes ist (nicht: der Kirche zu geben, was der Kirche ist). Sie steht in der Versuchung, mit Autokratien zu sympathisieren, weil die (angeblich) traditionelle Werte vermitteln. Sie steht auch in der Versuchung, sich auf Prinzipien zurückzuziehen, wenn es um Konkretisierungen angesichts von Zielkonflikten in Abwägungsprozessen geht. Unter ihrem Dach haben sich im 20. Jahrhundert politische Bewegungen wie die Theologie der Befreiung entwickelt, die kirchenamtlich domestiziert werden sollte und politikwissenschaftlich die Kritik auf sich gezogen hat, von ökonomischen Theorien abhängig zu sein, die unterkomplex seien. Gegenwärtig gewinnt der Neo-Integralismus an Einfluss, der eine Autonomie der Politik bezweifelt und über Ethik eine politische Macht der Kirche aufbauen will. Gleichzeitig bricht in der katholischen Kirche unter dem Leitwort Synodalität eine Verfassungsdiskussion auf, die politisch sensibel ist, weil sie das Verhältnis der Kirche zur Demokratie berührt.
Der große Aufbruch des Anfangs
Durch den Ruf Jesu in die Nachfolge und durch die österliche Sendung zu allen Völkern entsteht die Gemeinschaft der Glaubenden. Ihre frühesten Selbstbezeichnungen und starken Begriffe sind politisch – und demokratieaffin. Jesus verkündet das Königreich Gottes – und bringt dadurch die alttestamentliche Grundeinsicht neu zur Geltung, dass Gott allein der wahre König Israels wie der ganzen Welt ist und dass kein König dieser Welt Gott ist. Aus dem Bild des göttlichen Königreiches ist zwar immer wieder im Laufe der Geschichte abgeleitet worden, dass ein irdischer König, von Gott geheiligt, die Weltherrschaft übernehmen müsse – am besten in Gestalt des Papstes, des kirchlichen Oberhauptes, dem sich auch jeder christliche Kaiser und König beugen müsse. Aber diese Ableitung unterläuft die entscheidende Differenzierung zwischen Religion und Politik, die Jesus dadurch in die Welt gebracht hat, dass er das Reich Gottes verkündet und verwirklicht, aber keinen Gottesstaat gegründet, sondern das Volk Gottes gesammelt hat.
Diese Inklusion ist die Folge der Theozentrik: Der eine Gott ist der Gott für alle – und seine Kirche ist berufen, eine Kirche für alle zu sein.
Die frühesten Selbstbezeichnungen der Glaubensgemeinschaft spiegeln beides wider: die politisch brisante Präsenz in der Öffentlichkeit und die religiös begründete Transzendenz jeder Politik. Ein Grundwort, das auf die Jerusalemer Urgemeinde zurückgeht und von Paulus zu einem Schlüsselbegriff gemacht worden ist, heißt ekklesía, übersetzt mit „Kirche“ oder „Gemeinde“. Es hat eine doppelte Wurzel. Zum einen greift es die Theologie des Volkes Gottes auf, die in Israel beheimatet ist, und verweist dadurch auf die Liturgie, die Martyrie und die Diakonie als genuine Ausdrucksformen des Glaubens, die von jeder Herrschaft dieser Welt um Gottes und der Menschen willen anerkannt werden müssen und ihrerseits politisch markant sind: Der Gottesdienst wird öffentlich gefeiert, das Glaubenszeugnis wird öffentlich abgelegt, und der Dienst der Nächstenliebe wird nicht nur in den eigenen Reihen geübt, sondern auch in der Welt. Zur ekklesía gehören Juden und Griechen, Sklaven und Freie, Männer und Frauen, Gebildete und Ungebildete. Diese Inklusion ist die Folge der Theozentrik: Der eine Gott ist der Gott für alle – und seine Kirche ist berufen, eine Kirche für alle zu sein.
Eine prägnante Ausformung der paulinischen Volk-Gottes-Ekklesiologie ist das Bild der Kirche als „Leib Christi“. Es ist der politischen Theologie der Antike entlehnt, die den Staat als einen Organismus vorstellt, um die herrschenden Verhältnisse zu stabilisieren. Paulus stellt das Bild vom Kopf auf die Füße: Der Leib Christi stärkt die „Schwachen“ und ruft die „Starken“ zur Solidarität; er bringt Vielfalt durch Einheit und Solidarität durch Anerkennung zur Geltung. Der emanzipatorische Ansatz ist stark. Nicht die Diktatur ist das säkulare Pendant, wie Carl Schmitt meinte, sondern die Demokratie, allerdings nicht die antike, die elitär und patriarchal war, sondern erst die moderne, deren religiöse Wurzeln, vor allem in den Orden selten gesehen werden.
Der lange Schatten des 19. Jahrhunderts
Im 19. Jahrhundert hat sich die katholische Kirche als Bollwerk gegen die Aufklärung, gegen die Menschenrechte, gegen die Demokratie aufgebaut. Das Projekt war weder alternativlos noch konsequent, aber wirkmächtig. Es war einer katholischen Defensive geschuldet, die meinte, am Kirchenstaat festhalten zu müssen, um nicht in politische Abhängigkeit zu geraten, und gegen den „Modernismus“ der Aufklärung die katholische Identität profilieren zu müssen, um nicht der Beliebigkeit anheimzufallen. Das ideologische Mittel war die Beschwörung eines überzeitlichen „Naturrechts“, das gegen staatliche Übergriffe die Heiligkeit der Person und der Familie verteidigen sollte, das Privateigentum und die Würde der Arbeit. Das kirchenpolitische Mittel war die Entwicklung klerikaler Führung nach dem Modell der Monarchie: mit dem Papst als Oberhaupt, der zugleich oberster Gesetzgeber und Richter ist, unfehlbar in seinem Lehramt. Die Hierarchie wurde streng von oben nach unten gedacht: Die Herrschaft Jesu Christi über die Kirche stelle sich in der Herrschaft des Papstes dar, die des Papstes in derjenigen der Bischöfe und der „Pfarrherren“.
Es braucht ein Geschichtsbewusstsein, das Traditionskritik mit Respekt vor früheren Generationen verbindet und Erneuerungswillen mit dem Nutzen der Ressourcen aus Schrift und Tradition. Das Verhältnis zur Demokratie ist die Nagelprobe.
Das Projekt war zwar nie unumstritten, aber es war über lange Zeit sehr erfolgreich. Zum einen ging es mit einer dialektischen Modernisierung einher. Durch kirchliche Verwaltungen, kirchliches Recht und kirchliche Wissenschaft sollte die Wahrheit des katholischen Glaubens zum Ausdruck kommen; die päpstliche Soziallehre schärfte die Aufmerksamkeit für soziale Ungerechtigkeit, kirchliche Hilfswerke, Vereinigungen und Genossenschaften schufen diesseits von Revolutionen Abhilfe bei sozialen, ökonomischen, politischen Problemen. Zum anderen boten sich intelligenten jungen Männern Aufstiegschancen und Verantwortungspositionen, die ihnen gesellschaftlich versagt blieben, wenn sie nicht aus begüterten Kreisen stammten; die Frauenorden reüssierten und belebten sowohl Erziehungs- als auch Sozialeinrichtungen, bei denen der Staat oft versagte, die Kirche aber – auch im Eigeninteresse – Initiativen ergreifen konnte, das kirchliche Amt wurde geistlich erneuert, bis hin zum Zölibat; die Sonntagspflicht wurde eingeschärft, verbunden mit der Beichtpflicht. Die Zustimmung im Kirchenvolk zum Ausbau der Hierarchie war vielerorts hoch.
Weil der Erfolg lange Zeit groß war, fällt es vielen, die in der Kirche engagiert sind, schwer, sich von den Bildern, den Versprechungen, den Sicherungen des 19. Jahrhunderts zu lösen, während andere so schnell wie möglich den Ballast der Geschichte abwerfen wollen. Es führt kein Weg in die Vormoderne zurück; es wird keinen Weg in die Zukunft geben, der die Neuformation der katholischen Kirche nach der Aufklärung zementiert oder negiert. Es braucht ein Geschichtsbewusstsein, das Traditionskritik mit Respekt vor früheren Generationen verbindet und Erneuerungswillen mit dem Nutzen der Ressourcen aus Schrift und Tradition. Das Verhältnis zur Demokratie ist die Nagelprobe.
Die halbe Reform des 20. Jahrhunderts
Nach den Schrecken zweier Weltkriege, nach der Katastrophe des Holocaust, nach den Brüchen der Kolonialisierung hat sich die katholische Kirche im 20. Jahrhundert neu aufgestellt. Sie wird in neuen Dimensionen zur Weltkirche. Sie orientiert sich einerseits gegen den selbstgemachten Papalismus an älteren Traditionen, freieren Glaubensräumen und tieferen Frömmigkeitsschichten, so vor allem an der Bibel-, der Jugend-, der Arbeiter-, der Frauen- und der Liturgischen Bewegung. Andererseits sucht sie mit Hinweisen von Papst Johannes XXIII. nach den „Zeichen der Zeit“, die ihr die Fingerzeige Gottes außerhalb der eigenen Grenzen zeigen: in der Wissenschaft, der Kultur, der Gesellschaft, die sich auf ihre soziale und politische Verantwortung besinnt.
Die größte Frucht beider Bewegungen ist das Zweite Vatikanische Konzil. Es holt die liturgische Erneuerung ein (Sacrosanctum Concilium), überwindet das instruktionstheoretische Glaubensverständnis zugunsten eines geschichtstheologischen Offenbarungsansatzes, der Traditionskritik und Lehrentwicklungen umfasst (Dei Verbum), und orientiert die Pastoral neu in der Welt von heute (Gaudium et spes). Nicht zuletzt macht das Konzil auch erstmals in der Geschichte die Kirche selbst zum Thema (Lumen gentium) – Zeichen einer tiefen Krise, Kirche „heute“ zu sein, Zeichen aber auch des entschiedenen Selbstbewusstseins, in der Gegenwart die katholische Kirche nicht aufzugeben, sondern zu erneuern.
Es bleibt bei der Hierarchie, aber die Aufgabe des Papstes, der Bischöfe und der Priester wird darin gesehen, dem Glauben, dem Recht und der Freiheit aller zu dienen.
Der entscheidende Paradigmenwechsel vom Ersten zum Zweiten Vatikanischen Konzil besteht darin, dass die Kirche vom Volk Gottes aus gedacht wird: von der Gemeinschaft der Getauften her, die ihren Glauben leben. Es bleibt bei der Hierarchie, weil es bei der Sendung durch Christus und der apostolischen Nachfolge bleibt; aber die Aufgabe des Papstes, der Bischöfe und der Priester wird darin gesehen, dem Glauben, dem Recht und der Freiheit aller zu dienen.
Allerdings hat die kirchenoffizielle Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils die Vorzeichen vertauscht. Das kirchliche Gesetzbuch von 1983, in dem Papst Johannes Paul II. die Krönung des Konzils sah, betonte einseitig die Rechte der Kleriker, während die „Laien“ auf lediglich beratende Hilfsdienste zurückgesetzt wurden. Die Erklärung desselben Papstes 1994, die Kirche habe keine Vollmacht, Frauen zu Priestern zu weihen (Ordinatio sacerdotalis), ließ den Vatikan als Kämpfer gegen die Gleichberechtigung erscheinen. Durch die rechtliche Aufwertung des Klerus und die pastorale Abwertung der Frauen (die durch die höchsten Lobestöne ob ihrer Würde noch verstärkt wurde) geriet die Kirchen-Theologie in Schieflage. Während Johannes Paul II. mit theologischen Gründen und historischer Wirkung die Geltung der Menschenrechte im politischen Raum einklagte, konnte die katholische Kirche immer weniger erklären, warum sie intern andere Maßstäbe anlegt. In traditionellen Gesellschaften wurde der Konflikt lange zugedeckt – diese Ära endet.
Der neue Ansatz im 21. Jahrhundert
Während Papst Benedikt XVI. die Linie von Johannes Paul II. fortsetzte und sich bemühte, den ästhetischen und intellektuellen Glanz einer geistlich neu verstandenen Tradition zu verbreiten, ohne die kirchlichen Strukturen zu verändern, hat Papst Franziskus die enorme Unruhe aufgegriffen, die in der katholischen Kirche wegen der ungelösten Verfassungsfragen aufkam, und mit dem Stichwort „Synodalität“ in neue Bahnen zu lenken begonnen. Papst Leo XIV. hat sich zu diesem Kurswechsel bekannt – zu welchem Ziel er führt, entscheidet sich im Gehen.
Die Unruhe entsteht durch drei Entwicklungen, die einander überlagern.
Erstens braucht die katholische Kirche, die in der globalisierten Welt wächst und mit Lateinamerika, Asien und Afrika neue Zentren, jeweils an den Peripherien der Gesellschaft, ausbildet, eine neue Verbindung von Einheit und Vielfalt. Die katholische Kirche war noch nie so zentralistisch wie heute, weil die Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten des Durchgriffs erlaubt; sie war aber auch noch nie so plural wie heute, weil sie noch nie so groß wie heute war, noch nie so vielsprachig, noch nie so stark inkulturiert wie heute. Es fehlt in der katholischen Kirche nicht an Stimmen, die das Anti-Modernismus-Paradigma aufgreifen und die Einheit am Kampf gegen den „Gender-Wahn“ festmachen wollen, Verurteilung praktizierter Homosexualität einbeschlossen; teils sind die Konflikte kulturell, teils ideologisch bestimmt. Es braucht aber eine gemeinsame Besinnung auf das, was die katholische Kirche eint: die Liturgie und die Sakramente, Rom und das Papsttum, das zweite Vatikanische Konzil und das Bischofsamt gehören dazu, sind aber nur notwendige, nicht auch hinreichende Bestimmungen. Es fehlt an Orten, an Foren, auch an Gremien, in denen der Glaubenssinn des Gottesvolkes zur Sprache kommt – und zwar nicht unverbindlich, sondern verbindlich.
Es fehlt an Orten, an Foren, auch an Gremien, in denen der Glaubenssinn des Gottesvolkes zur Sprache kommt – und zwar nicht unverbindlich, sondern verbindlich.
Zweitens erlebt die katholische Kirche weltweit eine Bildungsexplosion, die nicht zuletzt von Frauen vorangetrieben wird. Religiöses Wissen ist nicht mehr das Privileg von Klerikern. Es gibt viele, die mitreden können und wollen, ohne dass sie geweiht sind: Ordensangehörige, lay ministers, Ehrenamtliche, Freiwillige. Für sie braucht es neue Formen und Orte, Strukturen und Institutionen verantworteter Mitarbeit. Gegenwärtig lähmen Rollenkonflikte zwischen Klerikern und anderen Engagierten die gemeinsame Arbeit. Solange die Zugangsvoraussetzungen zum kirchlichen Amt nicht verändert werden, braucht es neue Ordnungen verantwortlicher Arbeit in der Kirche und für sie. Die Erwartungen der Gläubigen an kompetente Führung sind gestiegen, weil Christsein aus Tradition immer weniger und Christsein aus Entscheidung immer mehr Bedeutung hat. Diese Verschiebung ist aus biblischer Sicht nur zu begrüßen. Sie verlangt mehr Synodalität in den Beziehungen: mehr Qualifikation und Partizipation, mehr Transparenz und Kontrolle.
Drittens muss die katholische Kirche in der globalen Welt von heute ihren Auftrag neu bestimmen, das Evangelium zu verbreiten. „Mission“ hat einen schalen Beigeschmack, wenn das Wort auf Deutsch, aber einen recht guten Klang, wenn es auf Englisch ausgesprochen wird. Die neutestamentliche Mitgift ist eine doppelte: Mission ist Befreiung, weil sie von eigenen Plausibilitäten in die weiten Räume führt, die Gottes Liebe öffnet, und weil sie Menschen die Möglichkeit bietet, Glaube und Vernunft, Verantwortung für die Welt und Hoffnung auf den Himmel, Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft und Entdeckung des eigenen Ich zu verbinden. Diese Mission hat in einer Welt der Politik, die Religion meist mit Fundamentalismus verbindet, große Bedeutung. Die Geschichte der Kirche ist ambivalent: Sie kennt Kriegstreiberei und Friedensaktionen. Die heutige Aufgabe ist klar: zwischen Ost und West, Nord und Süd zu vermitteln. Die politische Aufgabe geht aber weit über die Politik hinaus: Entscheidend ist die Entwicklung einer religiösen Zeichen- und Formensprache, die Kirche und Welt vermittelt, Tradition und Innovation, Wahrheit und Freiheit. Damit dies gelingt, braucht es nicht nur eine Erneuerung alter und die Einrichtung neuer Kommunikationsprozesse des Glaubens; es braucht nicht nur eine neue Mentalität des Miteinanders. Es braucht ebenso eine Reform des kirchlichen Rechts, das die Beteiligung der „Laien“ an Beratungs- und Entscheidungsprozessen sichert.
Es braucht ebenso eine Reform des kirchlichen Rechts, das die Beteiligung der „Laien“ an Beratungs- und Entscheidungsprozessen sichert.
Papst Franziskus hat die synodale Erneuerung der katholischen Kirche angestoßen, damit in einem weltweiten Prozess geklärt werden kann, was die kirchliche Gemeinschaft ausmacht, welche Beteiligungsformen sie braucht und wie sie ihre Sendung in der Welt von heute und morgen erfüllen kann. Er hat schon in seiner Eröffnungspredigt der Generalversammlung 2023 Synodalität scharf vom Parlamentarismus abgegrenzt – und damit nicht nur die Augen für die weltweite Krise der Demokratie geöffnet, sondern auch den kategorialen Unterschied zwischen einer politischen und einer kirchlichen Versammlung markiert. Er ist aber auch auf Kritik gestoßen, weil die Kirche sich nicht als Verächterin, sondern als Verfechterin der Demokratie äußern sollte, wenn sie den Impulsen von Johannes XXIII., des Zweiten Vatikanischen Konzils und Johannes Paul II. folgt. Deshalb wird im Schlussdokument, das Papst Franziskus sich zu eigen gemacht hat, eigens die Demokratie als Staatsform gewürdigt. Demokratie ist verantwortete Freiheit. Eine katholische Synode ist aber etwas anderes als ein politisches Parlament: Sie steht nicht der Regierung gegenüber, sondern bildet eine Versammlung aus Papst, Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und Gewählten wie Berufenen aus dem Kirchenvolk. Sie erlässt keine Gesetze, sondern ordnet das Leben der Kirche. Sie führt nicht zu reinen Mehrheitsentscheidungen, sondern zu möglichst breiten Konsensen, die der Einheit des Glaubens in der Vielfalt der Lebenswege Ausdruck verleihen. Ihre Methode ist nicht die Debatte der Parteien, sondern der Austausch im Glauben, sei es in Form der geistlichen Gespräche ignatianischer Prägung, sei es in offeneren Dialogformaten.
Die Demokratie ihrerseits ist keineswegs die reine Herrschaft der Mehrheit, als die sie Aristoteles portraitiert und kritisiert hat. In ihrer heutigen Form kennt sie Grundrechte, die nicht zur Disposition stehen. Sie kennt Minderheitenschutz. Sie muss dem „Prinzip Verantwortung“ (Hans Jonas) folgen. Sie muss das „Recht auf Rechte“ verwirklichen (Hannah Arendt).
Entwickelte Synodalität ist aber der Weg, sich dem Ziel zu nähern. Die Demokratie ist die stärkste politische Verbündete.
Kirche gab und gibt es in den verschiedensten politischen Konstellationen, auch in Diktaturen. Die Geschichte der Neuzeit und der Gegenwart stand lange Zeit im Zeichen einer Unterscheidung von Politik und Religion, die sich als späte Wirkungsgeschichte der Reich-Gottes-Botschaft Jesu erklären lässt. Die gegenwärtigen Rückfälle, die in verschiedenen Teilen der Welt zu beobachten sind, verdanken sich dem politischen Willen, Religion als Identitätsfaktor zu funktionalisieren, und dem religiösen Willen, Macht über die Seelen durch Macht über die Gesellschaft und die Kultur zu gewinnen. Beides widerspricht der Ethik des Evangeliums. Im deutschen Bundestag hat Papst Benedikt XVI. 2011 erklärt, das Christentum stehe gegen eine religiöse Begründung und für eine ethische Orientierung der Politik. In der Konsequenz liegt, dass auch für die Kirche der Zugang zur Politik nicht durch Religion, sondern durch Ethik geöffnet wird: und zwar eine, die sowohl die Systemlogik der Politik formatiert als auch die Politik mit den vorpolitischen Faktoren verbindet, die Freiheit generieren: das Ethos und das Recht.
Die römische Weltsynode 2021–2024 hat der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass die katholische Kirche durch entwickelte Synodalität ein Friedensfaktor in der Welt der Politik sein kann. Von dieser Vision ist sie derzeit weit entfernt. Entwickelte Synodalität ist aber der Weg, sich dem Ziel zu nähern. Die Demokratie ist die stärkste politische Verbündete.