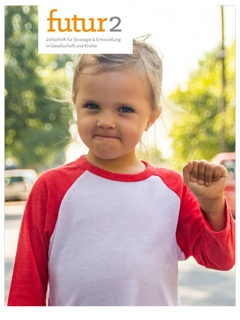Wie wir morgen leben wollen. Alternativen gesellschaftlicher Entwicklungspfade
Auf der Suche nach der Zukunft unserer Gesellschaften und bei der Frage, welches Gesellschaftsmodell unsere Lebenswirklichkeiten morgen prägen wird, scheint der Blick in die Glaskugel verführerisch. Er wäre aber unklug, denn es könnte in der Kristallkugel der Eindruck entstehen, als seien die Würfel für die Zukunft bereits gefallen, als seien die Eigenschaften des Gesellschaftsmodells von morgen schon festgelegt durch die Entwicklungen von gestern. Dieser Eindruck ist unbedingt zu vermeiden, gerade in einer Zeit, in der das Gefühl der Ohnmacht sich wie ein schleichendes Gift verbreitet und Luisa Neubauer mit ihrer Oma so energisch gegen die Mutlosigkeit anschreiben muss wie Papst Franziskus. Die eigene Fähigkeit, den Verheerungen und Verrohungen unserer Gesellschaften etwas entgegenzusetzen, wird notorisch klein geschätzt, und die Zuversicht schwindet, dass sich die Populisten noch aufhalten lassen bei ihrem offenkundig planvollen Zerstören unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung.
Besser als der Blick in die Glaskugel ist nach meinem Empfinden der Blick in Steffen Maus voluminöse Studie über „Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft“, die er unter dem Titel „Triggerpunkte“ zusammen mit Thomas Lux und Linus Westheuser 2023 veröffentlicht hat. Am besten scheint es mir, mit Seite acht zu beginnen. Überraschend in einem Buch, das sonst von Text und Tabellen bestimmt wird, illustrieren Schattenrisse eines Kamels und eines Dromedars den Anfang des Buches und zeigen, welche Gesellschaftsmodelle in Gegenwart und Zukunft zur Auswahl stehen: auf der einen Seite die Kamelgesellschaft, die von immer tieferen Gräben zwischen sozialen Klassen geprägt ist, auf der anderen Seite die Dromedargesellschaft, in der eine breite gesellschaftliche Mitte ähnliche Werte und Einstellungen teilt. „This is not America“ beginnt wenige Seiten später ein Kapitel, in dem Mau und seine Co-Autoren die Realität der amerikanischen Kamel-Gesellschaft messerscharf analysieren. Im Trump-Land haben über Jahre Zweiparteiensystem und Mehrheitswahlrecht eine soziale Sortierung begünstigt, innerhalb derer politische Parteineigungen zu „Mega-Identitäten“ avanciert sind. Um sie herum formen sich jeweils exkludierende Einstellungsringe, die in den letzten Jahren zunehmend religiös aufgeladen und von extrem konservativen Katholiken ebenso wie von Evangelikalen befeuert worden sind. Indem es den Rechten gelang, den Hass der Mittelschicht auf die vermeintlich den Fleiß der Anständigen ausbeutenden Migranten und sonstige „Andere“ zu schüren, gleichzeitig die Reichen immer reicher werden zu lassen, wurden toxische Entwicklungen beschleunigt, die die Chancen auf Überwindung der republikanischen Gräben längst zunichtemachten.
„This ist not America“, schreibt Mau zurecht über Europa. Das, was sich in den USA zurzeit beobachten lässt, ist eben nicht automatisch die Blaupause für das Gesellschaftsmodell Europas von morgen, auch wenn unbestreitbar in der Vergangenheit die US-amerikanischen Entwicklungen eine hohe Vorbildfunktion für die Gesellschaftsentwicklung Europas hatten. Das ließ sich besonders bei der weiter anhaltenden Entwicklung hin zu einer omnipräsenten Informationsgesellschaft beobachten – die technologische Entwicklung in den USA war der Treiber all der Dynamiken, die sich in den letzten Jahren als wesentliche Einflussfaktoren auf unser Gesellschaftsmodell erwiesen haben. Digitalisierung und Plattformisierung haben nicht nur die Wirtschaft, sondern das gesellschaftliche Miteinander insgesamt so wesentlich umgekrempelt, dass fast alle offensichtlichen Veränderungen auf diese Faktoren zurückzuführen sind: Singularisierung, Beschleunigung, Vereinsamung, Verrohung …
Auf der einen Seite die Kamelgesellschaft, die von immer tieferen Gräben zwischen sozialen Klassen geprägt ist, auf der anderen Seite die Dromedargesellschaft, in der eine breite gesellschaftliche Mitte ähnliche Werte und Einstellungen teilt.
Wenn wir wollen, dass das Gesellschaftsmodell der Zukunft in Europa der Dromedar-Gesellschaft Maus halbwegs ähnelt und nicht der Kamel-Gesellschaft Trumps, müssen heute die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Eine wesentliche Rolle kommt dabei den Christen und Christinnen zu, Menschen, die auf die soziale Macht des Christlichen vertrauen und die den kulturellen Mehrwert, den die auf christliche Werte gegründete Sozialordnung erzeugt, verteidigen wollen. Gegen eine religiös aufgeheizte Polarisierung in den USA muss in Europa eine religiös abgekühlte Anstrengung der Verständigung unternommen werden. Die Wettbewerbsökumene, die Deutschland seit über 100 Jahren prägt, bietet dafür gute Voraussetzungen. Katholische und evangelische Kirche können in der Art, wie sie gemeinsam und getrennt den samaritanischen Auftrag des Christentums ernst nehmen, wesentliche Weichenstellungen vornehmen. Diakonie und Caritas stehen hier als die beiden großen konfessionellen Wohlfahrtsverbände in besonderer Verantwortung. Mit ihren Programmen und konkreten Leistungen können sie dazu beitragen, dass Konsens nicht in Dissens umschlägt, dass Konflikte nicht vergiftend emotionalisiert werden und dass sich in den Ungleichheitsarenen die Spaltungen weniger vertiefen.
Die vier Ungleichheits-Arenen, die Mau benennt – die sozioökonomischen Verteilungskonflikte (Oben-Unten-Ungleichheiten), die Kontroversen um Migration und Integration (Innen-Außen-Ungleichheiten), identitätspolitische Anerkennungskonflikte (Wir-Sie-Ungleichheiten) und die auf Generationengerechtigkeit zielenden Umweltfragen (Heute-Morgen-Ungleichheiten) sind alle vier geeignet, von den Kirchen und den konfessionellen Wohlfahrtsverbänden „erobert“ zu werden. Die Bibel steckt voller Tipps, dass und wie der Aufladung der Exklusionen Zuspruch zu Inklusion und tätige Nächstenliebe entgegenzusetzen ist. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter ist dazu die bekannteste Geschichte: Unabhängig von unübersehbaren religiösen und ethnischen Unterschieden übernimmt der Samariter Verantwortung für den am Wegesrand Niedergeschlagenen, macht sich die Hände schmutzig, belastet seinen Esel, investiert Geld für die weitere Versorgung – ohne jede begründete Erwartung auf Dank oder Gegenleistung. Die zweite Geschichte, die als Quelle für den Glauben an zukünftige solidarische Gesellschaftsmodelle dienen kann und sollte, ist die Erzählung von der wunderbaren Brotvermehrung. Ihre schlichte Botschaft lautet: Wer teilt, hat mehr. Das ist eins zu eins die Gegenerzählung gegen das, was die religiös geharnischten Fundamentalisten in den USA vor sich hertragen: Dein Gewinn ist mein Verlust. Wer für sich und seine Familie, seine Nation sorgen will, muss verhindern, dass andere mehr erhalten, muss aufhören zu teilen, so ihr Mantra, das sie christlich dekorieren, ohne es christlich begründen zu können.
Gerade bei der Klimafrage als lebensentscheidender Zukunftsfrage wird der Immunisierung der Gesellschaft gegen Vergiftungen durch eine Sozialreligion tätiger Nächstenliebe eine besondere Bedeutung zuwachsen.
Gerade in Bezug auf die „Heute-Morgen-Arena“ in Maus Triggerpunkten ist das Vertrauen auf die Kraft des Teilens unübertroffen ermutigend; gerade bei der Klimafrage als lebensentscheidender Zukunftsfrage wird der Immunisierung der Gesellschaft gegen Vergiftungen durch eine Sozialreligion tätiger Nächstenliebe eine besondere Bedeutung zuwachsen. Die Klimafrage ist die Klassenfrage im Werden schlechthin und das unter vier Vorzeichen (Mau et al. 2023, 220): 1. Der menschengemachte Klimawandel ist in vollständig unterschiedlichem Ausmaß von Arm und Reich verursacht – die heute Reichen hinterlassen den ökologischen Riesenfußabdruck, der die Erde unter sich zerdrückt. 2. Die Folgen des menschengemachten Klimawandels müssen vor allem von den Armen getragen werden, sie haben weder Geld noch Kapazität, um sich vor den existenzbedrohenden Auswirkungen des Klimawandels wirksam zu schützen. 3. Die Anpassungen an die ökologische Transformation führen zu (politischen) Entscheidungen, die die Lebenswirklichkeit der unteren Einkommensgruppen stärker beschneiden als die der Reichen. 4. In den „symbolischen“ Verteilungskämpfen um Status und Geltung spielen die sichtbaren Möglichkeiten, „nachhaltige“ Lebensstile zu realisieren, eine immer größere Rolle. Wer sich bewusst für vegane Ernährung entscheidet, klassifiziert sich als zur überlegenen Gesellschaftsschicht gehörig – und die Grillwurst wird zur stillen, aber leicht entzündbaren Gegenwehr der Otto-Normalos. Längst bedienen Populisten den symbolischen Klassenkampf: Der politische Kampf um die Mitte wird mit der Currywurst geführt – sehenden Auges die Gefahr in Kauf nehmend, dass der polarisierende Kampf genau die gesellschaftliche Mitte zerstört, von der die um sie werbenden Parteien leben.
Das Gesellschaftsmodell der Zukunft möge die Dromedar-Gesellschaft sein! Mit Menschen, die teilen, mit einer Wirtschaftsordnung der Gemeinwohlorientierung.
Das Gesellschaftsmodell der Zukunft möge die Dromedar-Gesellschaft sein! Mit Menschen, die teilen, mit einer Wirtschaftsordnung der Gemeinwohlorientierung. Elinor Ostrom hat ein Forscherinnenleben lang zusammengetragen, dass und wie es geht: Die Allmende ist eine Wirtschaftsform, die funktioniert! Die Güter dieser Erde sind gemeinsam zu bewirtschaften, solange ein paar Spielregeln beachtet werden. Es braucht Vertrauen in die „Mitspieler“, Einsicht in die Begrenztheit der Ressourcen, Überzeugung davon, dass alle mehr haben, wenn sich nicht einzelne zulasten der Allgemeinheit bereichern … Die Sehnsucht nach einer solchen Gesellschaft und die Wertegrundlagen der sie stabilisierenden Regeln profitieren von einem Christentum der tätigen Nächstenliebe, und Laudato si’, die zweite Enzyklika von Papst Franziskus, bleibt dafür eine wesentliche Inspiration. Franziskus führt uns vor Augen, wie sehr „die Sorge um die Natur, die Gerechtigkeit gegenüber den Armen, das Engagement für die Gesellschaft und der innere Friede untrennbar miteinander verbunden sind“ (LS 10). Und er ist zuversichtlich, dass, wenn wir uns „allem, was existiert, innerlich verbunden fühlen, … Genügsamkeit und Fürsorge von selbst aufkommen [werden]“ (LS 11). Die Haltungen aber, welche vielfältig „selbst unter Gläubigen – die Lösungswege blockieren, reichen von der Leugnung des Problems bis zur Gleichgültigkeit, zur bequemen Resignation oder zum blinden Vertrauen auf die technischen Lösungen“ (LS 14). Die Gesellschaft von morgen hingegen braucht Zukunftsmut: unsere tätige Solidarität heute für morgen.