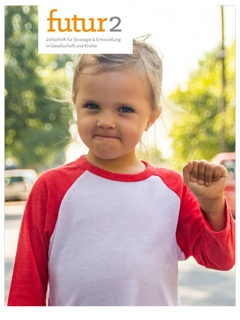Gesucht: kompromissbereite Heilige
„Wenn ihr heute ein wenig Zeit habt, dann nehmt die Bibel, das zweite Buch der Makkabäer, Kapitel sechs, und lest diese Geschichte von Eleasar. Das wird euch gut tun. Es wird euch Mut machen, für alle ein Beispiel zu sein und es wird euch auch Kraft geben und eine Hilfe sein, um die christliche Identität voranzutragen – ohne Kompromisse, ohne ein Doppelleben.“1 Mit diesem flammenden Appell endet eine Predigt von Papst Franziskus über den „angesehensten Schriftgelehrten Eleasar, ein Mann von hohen Alter und sehr edlen Gesichtszügen“ (2 Makk 6,18), der lieber den gewaltsamen Tod in Kauf nahm, als Schweinefleisch zu essen. Für Papst Franziskus ist klar. „Man darf sich nicht vom Geist der Welt schwächen lassen und soll das eigene Christ-Sein konsequent leben, ohne schwach zu werden und ohne Kompromisse einzugehen.“2 Auch die Kölner Stadtpatron*innen Ursula und Gereon werden dafür verehrt, konsequent und ohne Kompromisse ihrer Überzeugung treu geblieben zu sein. Wie alle anderen Heiligen dienen sie als Vorbilder für die Gläubigen, weil die „Kirche feierlich erklärt, dass diese die Tugenden heldenhaft geübt“3 haben und deshalb in der Allerheiligenlitanei um Hilfe angerufen werden können. Ich habe noch keinen Heiligen, keine Heilige gefunden, die ich nicht wegen ihrer Kompromisslosigkeit, sondern im Gegenteil wegen ihrer Kompromissbereitschaft und -fähigkeit anrufen könnte. Ich möchte eine Kerze vor einer Heiligenfigur anzünden, die die Kultur des Kompromisses verkörpert. Solche Vorbilder brauchen wir angesichts der gesellschaftlichen Polarisierungen und Verwerfungen.
Ein Kompromiss bringt dir selten Ruhm ein. Schon in der Bibel lautet ein Vorwurf „Du bist weder kalt noch heiß“ (Offb 3,15). Mittelmäßig, charakterschwach, inkonsequent – so werden Menschen gescholten, die einen Kompromiss ausgehandelt haben. „In der Politik gilt zur Schau getragene Kompromisslosigkeit als Ausweis moralischer Prinzipienfestigkeit.“4 Vielleicht auch deshalb hat Friedrich Merz das „Zuwanderungsbegrenzungsgesetz“ im Bundestag mit der Haltung „keine Kompromisse“ zur Abstimmung gestellt. Lieber nahm er die Stimmen der AfD in Kauf, als eine gemeinsame Mehrheit mit SPD und Grünen zu suchen.
Ich möchte eine Kerze vor einer Heiligenfigur anzünden, die die Kultur des Kompromisses verkörpert. Solche Vorbilder brauchen wir angesichts der gesellschaftlichen Polarisierungen und Verwerfungen.
Auch in der Diskussion zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde Kompromiss zum Unwort. Als Jürgen Habermas neben den militärischen Optionen für „ein öffentliches Nachdenken über den schwierigen Weg zu Verhandlungen“ sowie für die Suche nach „erträglichen Kompromissen“ plädierte, erntete er massive Kritik.
Zugegeben: Es gibt gute Gründe, auf die Kompromisslosigkeit ein Loblied zu singen. „Zahlreiche große soziale Veränderungen wie die Abschaffung der Sklaverei, die Einführung des Frauenwahlrechts oder der gleichgeschlechtlichen Ehe, aber auch wissenschaftliche Fortschritte oder große Kunstwerke sind durch Männer und Frauen möglich geworden, die sich kompromisslos für eine Sache eingesetzt haben, die sie um jeden Preis vorantreiben wollten.“5 Dabei darf nicht übersehen werden, dass die meisten Reformen letztlich nur durch Kompromisse erreicht werden konnten. Ein Beispiel dafür ist der Atomausstieg, den die Grünen mit ihrem Markenkern „Atomkraft – Nein Danke“ in Regierungsverantwortung durchsetzen konnten. Die lang ersehnte Abschaltung des letzten Atomkraftwerks konnte erst nach einer Laufzeitverlängerung erfolgen, der die Ökopartei schweren Herzens zustimmte. Solche Kompromisse sind, wie so viele in der Politik, strategischer Natur. Ich lasse mich auf ein Verhandlungsergebnis ein, auch wenn es meinen eigenen Überzeugungen widerspricht. Nicht selten hängt deshalb ein „wohl oder übel“-Schild an einer solchen Vereinbarung. Pragmatismus schlägt Idealismus. Wie wäre es, wenn wir den Kompromiss als geeignetes Instrument, wenn nicht sogar als Ideal betrachten, um in einer Gesellschaft, die nicht zuletzt durch ihre zunehmende Spaltung in vielen Reformvorhaben blockiert ist, wieder Lösungen für die Zukunft zu entwickeln?
Die Politische Theorie unterscheidet zwischen Konsens und Kompromiss. Ein Konsens ist dadurch gekennzeichnet, dass unterschiedliche Parteien zu einer gemeinsamen Überzeugung gelangen und diese teilen. Unterschiedliche Einstellungen und Meinungen werden zugunsten einer gemeinsamen Position aufgegeben. Aus Verschiedenheit wird Einheit – ut omnes unum sint (Joh 17,21). In einer pluralistischen Gesellschaft mit einer Vielzahl religiöser und säkularer Überzeugungen ist dieser Einheitsoptimismus kaum geboten. Zu groß sind die Differenzen entlang, aber auch innerhalb der Grenzen von Religionsgemeinschaften, Parteien und Verbänden. Konsens ist angesichts einer multikulturellen Gegenwart weder realisierbar noch erwartbar. Was auf den ersten Blick als Defizit markiert werden kann, erweist sich beim zweiten Blick als Chance. Der Kompromiss bietet sich gerade in einer durch Vielfalt gekennzeichneten Gesellschaft als Alternative an, denn im Gegensatz zum Konsens verlangt er nicht die Preisgabe der eigenen Position. Beim Atomkompromiss konnten die Grünen ihren „Atomkraft – Nein Danke“ Button am Revers lassen und deshalb einer Laufzeitverlängerung zustimmen.Der Kompromiss bietet sich gerade in einer durch Vielfalt gekennzeichneten Gesellschaft als Alternative an, denn im Gegensatz zum Konsens verlangt er nicht die Preisgabe der eigenen Position.
Ein Kompromiss liegt vor, wenn „beteiligte Parteien das Ziel ihrer Handlung oder ihre Handlung selbst im Hinblick auf divergierende und unversöhnliche Überzeugungen in einer für alle Parteien annehmbaren, aber von keiner als optimal angesehenen Richtung modifizieren.“6 Kompromisse zeichnen sich also dadurch aus, dass eine Entscheidung akzeptiert wird, die für die Beteiligten eigentlich nicht akzeptabel ist. Sie tun dies, weil das Verhandlungsergebnis die Chance bietet, dass zumindest wichtige Aspekte der eigenen Position Teil der Lösung werden. Diese Möglichkeit bietet eine Entscheidungsfindung durch Abstimmung nicht. Hier gilt: The winner takes it all. Der Verlierer findet sich im Ergebnis im Gegensatz zum ausgehandelten Kompromiss nicht wieder.
Der Kompromiss ist weit mehr als ein strategisches Instrument zur Durchsetzung eigener Positionen, denn er ist getragen von dem Grundsatz, dass auch die Positionen, die mir fremd sind, wichtig sind und es gute Gründe gibt, ihnen entgegenzukommen.
Neben der Möglichkeit, eigene Überzeugungen in die Lösung zu integrieren, erfordert der Prozess der Kompromissfindung eine Bereitschaft, nämlich die, sich mit den Positionen des Gegenübers auseinanderzusetzen. Ich bin in der Lage, meine eigenen Überzeugungen ins Spiel zu bringen, aber gleichzeitig gezwungen, mich mit den Positionen des Verhandlungspartners auseinanderzusetzen, und sie zu berücksichtigen.
An dieser Stelle kommt der Konsens wieder ins Spiel, denn die Kompromissfindung basiert auf der gemeinsamen Überzeugung, dass die unterschiedlichen Standpunkte, die zur Diskussion stehen, relevant und gleichzeitig verhandelbar sind. Wenn ich mich auf den Prozess der Kompromissfindung einlasse, vertraue ich darauf, dass auch die anderen Beteiligten sich ihre Gedanken gemacht haben. Deshalb ist der Kompromiss weit mehr als ein strategisches Instrument zur Durchsetzung eigener Positionen, denn er ist getragen von dem Grundsatz, dass auch die Positionen, die mir fremd sind, wichtig sind und es gute Gründe gibt, ihnen entgegenzukommen. Die Anerkennung des anderen ist notwendige Bedingung für den Kompromiss.7 Daher sind Gewalt(androhung) und Zwang bei der Kompromissfindung ausgeschlossen. Ebenso dürfen Kompromisse nicht auf Kosten Unbeteiligter geschlossen werden. „Faul sind Kompromisse auf dem Gebiet der Menschenrechte, weil die Leidtragenden ihnen niemals zustimmen könnten.“8
Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland beginnt mit einem Plädoyer für den Kompromiss. Am 8. Mai 1949 hielt Konrad Adenauer nach der Schlussabstimmung über das Grundgesetz als Präsident des Parlamentarischen Rates eine Rede. Darin sagte er „Wir haben einen Kompromiss geschlossen. … Jeder Kompromiss hat Fehler und Mängel. Aber ein Kompromiss hat auch einen großen Vorteil. Er lehrt die Parteien, die so gezwungen waren, miteinander zu arbeiten, auch im politischen Gegner den überzeugten, den ehrlichen Gegner zu schätzen.“9 Die Bereitschaft zum Kompromiss zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Bundesrepublik. Sie als Ressource neu zu entdecken, würde uns als Gesellschaft guttun. Vielleicht kann Papst Leo XIV. bei zukünftigen Heiligsprechungen die Kompromissfähigkeit als Tugend berücksichtigen. Für ihn als Augustiner-Mönch gäbe es sogar die passende Gaststätte dazu.
- https://www.vatican.va/content/francesco/de/cotidie/2015/documents/papa-francesco-cotidie_20151117_kompromisslos.html [abgerufen: 21.08.2025].
- Ebd.
- Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 828.
- Volker M. Heins, Eine Verteidigung des Kompromisses, 27.04.2023, https://www.republik.ch/2023/04/27/eine-verteidigung-des-kompromisses [abgerufen : 21.08.2025].
- Veronique Zanetti, Spielarten des Kompromisses, Frankfurt/M. 2022, 14.
- Ebd., 21.
- Ein Völkischer Nationalismus verweigert die Anerkennung des anderen als Anderen. Daher sind Kompromisse mit der AfD nicht möglich. Vgl. Erklärung des Deutschen Bischöfe https://www.dbk-shop.de/media/files_public/a56986289ce4037a4f18c78a098f22fc/DBK_10148.pdf, [abgerufen: 21.08.2025].
- Volker M. Heins, Eine Verteidigung des Kompromisses (s. Anm. 4).
- https://www.konrad-adenauer.de/seite/8-mai-1949/ [abgerufen: 21.08.2025].