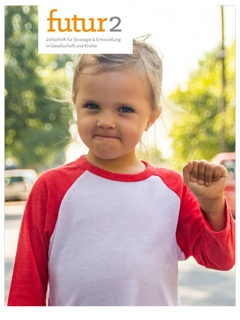Was rettet die Demokratie? Impulse gegen den autoritären Umbau der Gesellschaft
1. Was ist
Die gegenwärtige Gesellschaft befindet sich in einer Krise. Darin wirken verschiedene Faktoren zusammen. Digitalisierung und Globalisierung sind starke Treiber radikaler gesellschaftlicher Veränderungen, die sich gegenseitig bedingen und verstärken. Neue technische Möglichkeiten der Kommunikation lassen die Welt zusammenschrumpfen. Zugleich geraten die Demokratien immer mehr unter Druck.
1.1 Die Krise des Kapitalismus
Damit verbunden ist eine Krise des Kapitalismus.1 Das Versprechen des Kapitalismus besagt im Kern, dass wirtschaftliches Wachstum mehr Wohlstand für alle bedeutet und die freien Kräfte des Marktes das regeln. Dass Gewinne ungleich verteilt sind, wird nicht als ernsthaftes Problem gesehen, solange genug Wachstum für alle eine Verbesserung bewirkt – auch für die Ärmeren. Dieses Versprechen kann aber gegenwärtig nicht mehr eingelöst werden. Faktisch wird es nur noch für wenige Vermögende immer besser, für die große Mehrheit dagegen schlechter.
Dafür lassen sich verschiedene Ursachen benennen. So hat sich die Ungleichverteilung von Vermögen in den letzten Jahren noch einmal deutlich verstärkt. Während der Corona-Pandemie (2020–2021) hat sich das Vermögen der zehn reichsten Milliardäre verdoppelt(!), während 160 Millionen Menschen zusätzlich in Armut geraten sind.2 Diese Ungleichheit hat inzwischen Dimensionen angenommen, die weit jenseits der Vorstellungsfähigkeit liegen.3
Eine andere Ursache für die Krise des Kapitalismus besteht darin, dass die Grenzen des planetaren Wachstums an verschiedenen Stellen erreicht bzw. überschritten sind.
Durch den Effekt, dass viel Vermögen wiederum weiteres Vermögen generiert, sind die Verhältnisse komplett aus dem Lot und haben einen selbstverstärkenden Effekt. Wenn einzelne Menschen quasi ganze Staaten kaufen könnten, sind Methoden der Gewaltenteilung und Machtkontrolle weitgehend ausgehebelt.
Eine andere Ursache für die Krise des Kapitalismus besteht darin, dass die Grenzen des planetaren Wachstums an verschiedenen Stellen erreicht bzw. überschritten sind. Die Klimakrise ist eine Folge davon. Sie erzwingt einen grundlegenden Umbau der Gesellschaft und des Wirtschaftens, wenn das Leben für die Mehrheit der Menschen erträglich bleiben soll. Deren Eckpfeiler sind:
a) Nachhaltige, langfristig ressourcenschonende statt kurzfristig profitorientierter ressourcenverbrauchender Investitionen (dies steht allerdings in direktem Konflikt zum generellen Wachstumsparadigma).
b) Umstellung weg von fossilen hin zu erneuerbaren Energien.
Dies beinhaltet allerdings als Nebeneffekt nicht weniger als einen Umbau der globalen Machtstrukturen.
Seit der industriellen Nutzung des Erdöls gilt: Öl = Macht. Wer den Zugang zum Öl kontrolliert, hat das Sagen in der Welt. Dafür wurden nicht wenige Kriege geführt.
Erneuerbare Energien sind demgegenüber dezentral. Sie können mit vergleichsweise geringem Aufwand genutzt werden. (Ein Solarpanel oder ein Windrad sind technisch viel einfacher als eine Ölraffinerie oder ein Atomkraftwerk.) Ihre Energiequellen lassen sich schwer kontrollieren oder monopolisieren. Der Wind weht, wo er will, und die Sonne scheint an vielen Stellen. Die erneuerbaren Energien sind darum nicht nur „Freiheitsenergien“, die den Ressourcenfluch brechen, sondern auch „Friedensenergien“ (so ein Begriff von Michael Blume)4.
Der weltweite Umbau auf erneuerbare Energien lässt das gegenwärtige Machtmodell schlicht implodieren.
Der weltweite Umbau auf erneuerbare Energien lässt das gegenwärtige Machtmodell schlicht implodieren. Alle Vermögenswerte, die auf fossiler Energie basieren, werden absehbar komplett wertlos, wenn kein fossiles CO2 mehr ausgestoßen werden darf. Das hat eine revolutionäre Dimension.
1.2 Die autoritäre Wendung
Die Krise des Kapitalismus führt dazu, dass das zentrale Versprechen der Aufklärung für viele Menschen nicht mehr plausibel ist. Wenn die liberale Gesellschaft, die auf Menschenwürde, Vernunft und individuelle Freiheit setzt, nur noch Wohlstand für wenige garantieren kann und gegenüber allen anderen ihre Werte missachtet, wird sie insgesamt unglaubwürdig. Wo die praktischen Folgen der Theorie nicht entsprechen, greift dies auch die Geltung und Plausibilität der theoretischen Setzungen dahinter an. Vernunft und Menschenrechte erscheinen dann nicht mehr als lebensorientierende Prinzipien, sondern als inhaltsleere Worthülsen.
Die Annahme ist naheliegend, dass diejenigen, die bisher vom fossilen Geschäftsmodell profitiert haben, diese Zusammenhänge auch erkennen. Sie werden aber nicht tatenlos zusehen, sondern versuchen gegenzusteuern. Dies ist auf verschiedenen Ebenen zu beobachten.
a) Desinformation: Zahlreich sind die vielfältigen Kampagnen zur subversiven Streuung von Desinformation, besonders zur Klimakrise und zur Energiewende. Wenn der Wandel schon nicht komplett aufzuhalten ist, soll er damit möglichst gebremst werden
b) Autoritärer Umbau der Gesellschaft: Erheblich ist auch die finanzielle und logistische Unterstützung von nationalistischen Kräften weltweit durch sehr vermögende Einzelpersonen.
c) Populismus lebt von bewusst herbeigeführter gesellschaftlicher Spaltung und Polarisierung, indem ein Feind markiert und ein „Wir gegen die anderen“-Gefühl erzeugt wird. Dies dient auch der Ablenkung vom Problem der Ungerechtigkeit, indem die Wut darüber auf andere (Ausländer, Bürgergeldempfänger…) umgeleitet wird.
Geschichte wiederholt sich nicht identisch. Aber die Gefahr einer autoritären Wende ist sehr real.
Bereits einmal in der deutschen Geschichte war der Faschismus eine Antwort und Reaktion auf eine Krise des Kapitalismus (Weltwirtschaftskrise 1929). Der Faschismus braucht für die Machtergreifung keine Mehrheit. Ihm genügt ein fanatisches Drittel, ein eingeschüchtertes Drittel und ein desinteressiertes Drittel.5 Zur gleichen Zeit schafften es die USA mit massiven öffentlichen Investitionen im New Deal, die Überwindung der Krise mit einer Verbesserung der Lebensverhältnisse und der Bewahrung der Demokratie zu verbinden.
Geschichte wiederholt sich nicht identisch. Aber die Gefahr einer autoritären Wende ist sehr real. Demokratien sterben nicht in einem großen Knall, sondern durch schleichende Prozesse: durch Legitimitätsverlust, durch Diskursverhärtung, durch die Fragmentierung des Wissensraums und die zunehmende Rückkehr totalitärer Versuchungen.6
2. Was hilft
Was könnte helfen, diese problematischen Entwicklungen positiv zu beeinflussen?
2.1 Positive Visionen erzählen
Die derzeitige politische Polarisierung hat auch mit einem Erzählvakuum und einem Mangel an positiven Visionen für die Gesellschaft zu tun. Liberale Vorstellungen sind in der Defensive. Sie haben vielerorts ihre kulturelle Strahlkraft verloren. Der Liberalismus wirkt technokratisch, defensiv, manchmal elitär. In dieses Vakuum drängen autoritäre Bewegungen mit einfachen Erzählungen von Ordnung, Identität und Zugehörigkeit.
Wir brauchen demokratische Erzählungen, die das Gemeinsame nicht aus der Vergangenheit, sondern aus der erstrebten Zukunft ableiten.
Wenn wir der totalitären Neigung begegnen wollen, brauchen wir ein neues demokratisches Narrativ: eines, das nicht auf Homogenität basiert und die Nation als Schicksalsgemeinschaft beschwört, sondern Individualität mit Gemeinschaft und Freiheit verbindet. Es braucht dazu beides:
1) ein positives Bild einer Gesellschaft der Zukunft, und
2) anschauliche Erzählungen, die dieses Bild vermitteln.
Das erfordert eine politische Sprache, die mehr ist als Zahlen und Management. Wir brauchen demokratische Erzählungen, die das Gemeinsame nicht aus der Vergangenheit, sondern aus der erstrebten Zukunft ableiten.
2.2 Institutionelle Innovation stärkt demokratische Resilienz
Viele unserer Institutionen stammen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Sie sind nicht dafür entworfen, mit global vernetzten Desinformationsnetzwerken, KI-gesteuerten Meinungsblasen oder einer Plattform-Ökonomie umzugehen, in der Aufmerksamkeit die härteste Währung ist. Wir brauchen daher eine Ergänzung durch neue, resiliente Institutionen – digital und analog:
Gemeinwohlorientierte öffentliche digitale Räume
Die Informationsinfrastruktur muss als Teil der Daseinsvorsorge verstanden werden. Eine rechtliche Regulierung der bestehenden kommerziellen Plattformen ist zwingend nötig, genügt aber nicht. Wir brauchen öffentlich-rechtliche, gemeinwohlorientierte digitale Räume – als Alternative und Gegengewicht zu kommerziellen Plattformen. Der Kurznachrichtendienst Mastodon als Teil des auf Open Source basierenden Netzwerkzusammenschlusses Fediverse zeigt beispielhaft, wie eine solche Infrastruktur aussehen kann. Es braucht mehr staatliches Engagement in diesem Bereich.
Neue Beteiligungsformen
Die repräsentative parlamentarische Demokratie muss ergänzt werden – durch Formate, die unmittelbare Beteiligung ermöglichen. Geloste Bürgerräte, lokale Demokratielabore, partizipative Haushalte – solche Experimente stärken nicht nur das Vertrauen, sondern auch die Kompetenz der Gesellschaft zur Selbstgestaltung.
2.3 Gesellschaftliche Sanktionierung von Lüge & Desinformation
Im zwischenmenschlichen Bereich ist es Standard, die Lüge zu ächten, weil ansonsten keine verlässliche Kommunikation und kein beziehungsorientiertes Miteinander möglich ist. In der modernen Gesellschaft werden hingegen selbst offensichtliche Lügner kaum noch bestraft. Politikern schadet es im Ansehen nur selten, nachweislich gelogen zu haben. Dabei ist offensichtlich, dass das gezielte und strategische Lügen in Politik und Medien die Gesellschaft zerstört.
Im zwischenmenschlichen Bereich ist es Standard, die Lüge zu ächten, weil ansonsten keine verlässliche Kommunikation und kein beziehungsorientiertes Miteinander möglich ist.
Nun ist die Lüge in der Politik kein neues Phänomen. Dass sie in digitalen Öffentlichkeiten systemisch belohnt wird, ist aber eine neue Dimension. Wenn wir den Wert der Wahrheit in unserer Gesellschaft nicht aktiv schützen, verlieren wir das Fundament der Demokratie.
Kulturelle Resilienz: Wahrheit als Wert stärken
Die Grundlage jeder Strategie gegen Desinformation ist eine Gesellschaft, die Wahrheit wieder als sozialen Wert erkennt – nicht nur als private Tugend, sondern als kollektives Gut. Die Schamlosigkeit, mit der gegenwärtig öffentlich gelogen wird, muss sichtbar gemacht und gebrandmarkt werden. Lügen dürfen nicht als cleverer Trick durchgehen, sondern müssen als Vertrauensbruch markiert werden. Es braucht mehr gesellschaftliche Debatten über eine Kultur der Wahrhaftigkeit. Dabei zählt das ernsthafte Bemühen. Irrtümer sind immer möglich. Auch der Umgang mit eigenen Fehlern gehört mit in diesen Kontext.
Ebenso spielt Bildung eine Rolle: Wo kritisches Denken, Argumentationslogik, Quellenbewertung und digitale Medienkompetenz geschult werden, sinkt die Manipulierbarkeit.
Systemische Transparenz: Anreizstrukturen ändern
Lügen florieren, wenn die Kosten dafür gering, aber die Gewinne hoch sind. Es gilt also die Anreizsysteme in Politik, Medien und Wirtschaft so zu verändern, dass Wahrheit wieder lohnender wird als Desinformation.
Mittel dafür könnten sein:
- Transparenzpflichten für öffentliche Kommunikation: Politiker, Unternehmen und Medien könnten verpflichtet werden, auf Anfragen hin Belege für öffentliche Behauptungen offenzulegen – nicht zur Zensur, sondern zur Nachvollziehbarkeit. Dies könnte die Sorgfalt erhöhen und lügenhafte Polemik begrenzen.
- Konsequenzen bei erwiesener Desinformation: Wer als Politiker, Journalist oder Funktionsträger wiederholt nachweislich lügt, sollte systemische Konsequenzen spüren. In Wales wurde bereits ein entsprechender Gesetzesvorschlag eingebracht.7 Möglichkeiten wären eine temporäre Aberkennung öffentlicher Sprecherrollen in Gremien oder der Ausschluss von bestimmten Ämtern oder Funktionen. Ebenso nötig sind wirksamere Sanktionen für den Presserat bei Verstößen gegen den Pressekodex8.
- Vertrauens-Ratings statt Klickzahlen: Für Medienplattformen könnte es öffentliche, unabhängige Bewertungsmetriken geben, die auf faktischer Korrektheit, Korrekturbereitschaft und Transparenz beruhen – ähnlich einem Nachhaltigkeitssiegel. Wenn erzielbare (Werbe-)einnahmen von solchen Ratings abhängig sind, werden sie mehr Beachtung finden als rein moralische Appelle.
Wahrheitsfindung muss kollaborativ und dezentral durch viele unabhängige Stellen betrieben werden (wie dies guter Brauch in der Wissenschaft ist).
Bei all diesen Bemühungen wird es entscheidend darauf ankommen, allen Versuchungen zu widerstehen, die Definition von Wahrheit zu monopolisieren. Wahrheitsfindung muss kollaborativ und dezentral durch viele unabhängige Stellen betrieben werden (wie dies guter Brauch in der Wissenschaft ist). Dazu gehört die demokratische Kontrolle über die Kontrollinstanzen. Alle Maßnahmen zur Wahrheitsförderung müssen öffentlich, überprüfbar und demokratisch legitimiert sein.
Meinungen und Fakten sind zu unterscheiden. Jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Dazu gehört in jedem Fall Offenheit für Dissens. Auch unbequeme, kontroverse Meinungen müssen Raum haben – solange sie nicht gezielt täuschen oder hetzen.
Solche Maßnahmen können nicht alle Probleme lösen. Grenzfälle bleiben. Oft wird nicht glatt gelogen, sondern nur ein Teil der Wahrheit verschwiegen. Dennoch ist es sinnvoll, auf eine Kultur der Wahrhaftigkeit hinzuarbeiten und aktiv gegen die gröbsten Missbräuche vorzugehen. Demokratie lebt davon, dass Menschen informierte Entscheidungen treffen. Dafür brauchen sie zutreffende Informationen über die sie umgebende Wirklichkeit als Basis für das gemeinsame Ringen um den richtigen Weg.
2.4 Gemeinschaft durch Teilhabe
Dass die Gesellschaft anfällig für autoritäre Konzepte ist, speist sich aus realen Erfahrungen von Kontrollverlust, Entwertung und Entfremdung. Dies ist oft eine Reaktion auf eine als unübersichtlich empfundene Welt, in der alte Sicherheiten verschwinden – ökonomisch, kulturell, sozial. Dem begegnet man nicht mit moralischer Überlegenheit, sondern mit einem inklusiven Gesellschaftsprojekt, das reale Teilhabe ermöglicht – materiell und ideell.
Die Zukunft gehört denen, die bereit sind, die Unsicherheit des Wandels auszuhalten – und ihn aktiv zu gestalten. Demokratie ist kein Zustand, sondern ein Prozess, kein Besitz, sondern eine Praxis.
Wohlstand gerecht verteilen
Wesentlich für die Akzeptanz eines demokratischen Staatswesens ist die Erfahrung seiner Wirksamkeit in der Sicherung sozialer Lebensräume. Die permanente Privatisierung von Gewinnen und Sozialisierung von Risiken und Verlusten hat die öffentlichen Kassen geplündert. Es braucht eine gerechte Besteuerung von Vermögen und Erbschaften, um den undemokratischen Machtzuwachs durch gigantische Einzelvermögen zu reduzieren. Das könnte auch den Kommunen wieder nötige finanzielle Handlungsspielräume verschaffen. Maßnahmen wie das Klimageld sollten wesentlich zur Akzeptanz der Energiewende beitragen – ihre Verschleppung ist Teil fossiler Politik.
Vielfalt einüben
Hilfreich ist Bildung zur Ambiguitätstoleranz – die Fähigkeit, mit Widersprüchen, Mehrdeutigkeiten und Unsicherheit umzugehen. Demokratien scheitern nicht an zu wenig Wissen, sondern an zu wenig Komplexitätskompetenz. Dazu können auch Beteiligungsformen (s.o. 2.2.) beitragen, die dazu motivieren, Probleme nicht eindimensional, sondern in ihrer Vielschichtigkeit wahrzunehmen. Verschiedene Meinungen in Sachfragen sind nicht Verrat am Volkskörper, sondern selbstverständliche Normalität in einer freien Gesellschaft.
Wertschätzung zeigen
Demokratie ist kein binärer Zustand. Es kann wenig oder mehr davon geben. In der Athener Demokratie waren wenige wohlhabende Bürger an den Diskussionen beteiligt. Das ist besser als eine Diktatur. Die Entwicklung der modernen Demokratien ist davon geprägt, dass immer mehr ehemals ausgegrenzte und marginalisierte Bevölkerungsgruppen nach Beteiligung und Mitbestimmung streben. Das führt bei den bisher meinungsprägenden Gruppen verständlicherweise zu Verlustängsten. Sie verlieren an Einfluss – andere gewinnen. Wo diese Prozesse gut laufen, kann ein neues gemeinsames „Wir“ entstehen.
Fazit
Die Zukunft gehört nicht jenen, die das Gestern mit harter Hand konservieren wollen. Sie gehört denen, die bereit sind, die Unsicherheit des Wandels auszuhalten – und ihn aktiv zu gestalten. Demokratie ist kein Zustand, sondern ein Prozess, kein Besitz, sondern eine Praxis.
Wenn wir dem totalitären Rückschritt begegnen wollen, brauchen wir neue Geschichten für unsere positiven Visionen, neue Beteiligungsformen und eine neue Liebe zur Wahrhaftigkeit. Erzählen wir uns mehr positive Geschichten, die zeigen, dass Fortschritt nicht Gleichschritt heißt, sondern gerechte Vielfalt.
- https://www.podcast.de/episode/690212425/kapitalismuskritik-das-system-kommt-an-seine-grenzen (abgerufen am 02.09.2025).
- https://www.oxfam.de/presse/pressemitteilungen/2022-01-17-reichsten-verdoppeln-vermoegen-waehrend-160-millionen (abgerufen am 02.09.2025).
- Eindrücklich ist der Versuch einer Visualisierung, in der ein Bildschirmpixel 1.000 USD entspricht: https://dbkrupp.github.io/1-pixel-wealth/ (abgerufen am 02.09.2025).
- https://energiewinde.orsted.de/koepfe-der-energiewende/michael-blume-antisemitismus-ressourcenfluch-oel-gas-konflikte-interview (abgerufen am 02.09.2025).
- Michael Seemann, Mastodon @mspro[at]fnorden[.]deemobascript('%6D%73%70%72%6F%40%66%6E%6F%72%64%65%6E%2E%64%65','<span class="emoba-em">mspro[at]fnorden[.]de</span>','emoba-6477','','','0'); .
- Vgl. Steven Levitsky, Daniel Ziblatt: Wie Demokratien sterben und was wir dagegen tun können, München 2018, aktuell: Peter R. Neumann, Richard C. Schneider: Das Sterben der Demokratie, Berlin 2025.
- https://podcast.forum.eu/fundstuecke/wales-arbeitet-an-gesetz-gegen-das-lugen-in-der-politik (abgerufen am 02.09.2025).
- https://www.presserat.de/pressekodex.html (abgerufen am 02.09.2025).