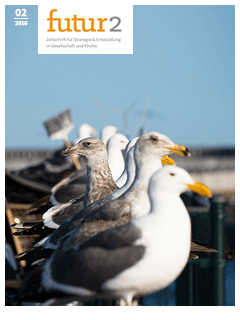Keine Wahrheit ist exklusiv
Im Zentrum der interreligiösen Diskussion um Inklusion und Exklusion steht die Auseinandersetzung mit den Bedingungen und Grenzen eines konstruktiven, von Achtung getragenen Umgangs mit religiöser Pluralität und Differenz. Ich gehe von der Prämisse aus, dass Religionen innerhalb der eigenen plural verfassten Tradition ebenso wie gegenüber konkurrierenden religiösen und nicht-religiösen Weltbildern notwendigerweise ihren Standpunkt vertreten müssen. Dadurch werden Positionen vertreten, die grundsätzlich immer auch konfliktträchtig sind. Konflikte aber müssen nicht zwangsläufig als destruktiv betrachtet werden, sie können auch integrativ wirken. Was ich kritisiere, sind vorwiegend konsensorientierte Modelle des interreligiösen Gesprächs oder Definitionen eines religiösen Pluralismus, die dazu neigen, um einer friedlichen Koexistenz religiöser Gruppen willen eigene Positionen preiszugeben oder das Trennende auszuklammern.
Es lässt sich in der interreligiösen Diskussion so etwas wie ein “dialogical turn” erkennen, nämlich die Bereitschaft, religiös-kulturelle Diversität und Pluralität als selbstverständliche, ja, notwendige Gegebenheit menschlicher Kultur anzuerkennen und die eigene religiöse Identität in einem offenen interreligiösen Gespräch neu zu konfigurieren. Exemplarisch lässt sich dies am jüdisch-christlichen Dialog festmachen, insbesondere an einem berühmt gewordenen Vortrag des ursprünglich aus dem chassidischen Judentum Polens stammenden amerikanischen Theologen Abraham J. Heschel, den dieser 1965 unter dem Titel “No Religion is an Island“ in New York gehalten hat.
Kein Dialog könne funktionieren ohne die Anerkennung des fremden Anderen in seiner unverfügbaren Heiligkeit und Kostbarkeit: „Wenn ich im Gespräch mit einem Menschen anderer religiöser Überzeugung feststelle, daß wir in Dingen, die uns heilig sind, nicht übereinstimmen, verschwindet dann das Bild Gottes, dem ich mich gegenübersehe? […] Zerstört die Verschiedenheit religiöser Überzeugung die Tatsache, daß wir verwandte menschliche Wesen sind?“ 1Inklusion benötigt eine deutliche, gerade auch sachkundige Verwurzelung im eigenen Glauben, um nicht der Gefahr fauler Kompromisse und einer Gleichgültigkeit anstelle von Achtung zu erliegen.
Juden und Christen können sich bei aller Differenz, die sich auch durch Dialoge nicht auflösen lässt, auf grundlegende Gemeinsamkeiten beziehen: auf den biblischen Schöpfungsglauben zum Beispiel, auf die Ebenbildlichkeit von Gott und Mensch und die darin begründete Heiligkeit des Lebens. In bestimmten Aspekten ihrer Gottesvorstellung, ihres Menschenbildes, ihrer ethischen Tradition und Zukunftshoffnung hingegen sind und bleiben sie Fremde und müssen einander widersprechen. Dieses klare Differenzbewusstsein hindert das Judentum nicht daran, das Christentum – und auch den Islam – als Teil(e) eines göttlichen Heilsplans in seinen Glauben zu integrieren, anstatt sie als „Zufälle der Geschichte oder rein menschliche Phänomene“ 2 abzuwerten. Unabdingbare Voraussetzung von Dialog sei Heschel zufolge ein angemessenes Verhältnis von Anerkennung, Achtung und Bewahrung von Differenz in einer pluralistischen Gesellschaft und Kultur.
Ich betrachte diesen interreligiösen Ansatz als brauchbares Modell für Interkulturalität, weil es in einem großen Umfang Inklusion ermöglicht. Zwei Absichten aber schließen sich hier grundsätzlich aus: (1.) jegliche auch nur im Verborgenen wirkende Absicht zur Mission, weil sie die religiöse Würde und Eigenständigkeit des Gegenübers verletzen würde, und (2.) ein Wahrheitspluralismus, der die wechselseitige Fremdheit und den Widerspruch gegen den Anderen einfach verschwiege. Mit anderen Worten: Inklusion benötigt eine deutliche, gerade auch sachkundige Verwurzelung im eigenen Glauben, um nicht der Gefahr fauler Kompromisse und einer Gleichgültigkeit anstelle von Achtung zu erliegen. In der Logik inklusiver Religion wird nicht geworben und vereinnahmt, sondern die Begegnung mit anderen als Geschenk empfangen, das je neu das Geheimnis Gottes erschließen lässt. Dazu gehört es, offen zu sein für das, was sich von Gott her gerade durch den Anderen ereignen will, und dies zu deuten und weiterzuerzählen.
Die entscheidende Frage lautet daher, wie man die Treue zur eigenen Tradition mit der Achtung vor unterschiedlichen Traditionen verbinden kann. Gemessen an diesem Maßstab haben weder die tolerante Duldung fremder Identität noch das beliebige Konstatieren von Pluralität dialogische Qualität. Dialog zeichnet sich durch eine realistische Wahrnehmung der tiefgreifenden Differenz zwischen unterschiedlichen Systemen aus. Bis in die Gegenwart hinein bilden Religionen und Weltanschauungen beständige Systeme kollektiven Wissens mit besonderem Fokus auf die existenziellen Fragen des Menschen. In dieser Hinsicht bieten sie ein großes Repertoire sinn- und orientierungsgebender Glaubensinhalte, die in einem ständigen Prozess gesellschaftlichen Wandels lebendig bleiben und von Generation zu Generation Identitäten stiften.Unabdingbare Voraussetzung von Dialog sei Heschel zufolge ein angemessenes Verhältnis von Anerkennung, Achtung und Bewahrung von Differenz in einer pluralistischen Gesellschaft und Kultur.
Das Differenzbewusstsein im interreligiösen Dialog muss eingebettet sein in eine ausdrückliche Bejahung der fremden Identität als einer ebenso menschlich legitimen wie von Gott gewollten.
Dialogische Qualität beruht auf der Erkenntnis, dass Wahrheit nicht exklusiv ist und nicht besessen werden kann, dass Gottes Stimme das Bewusstsein des Menschen auf vielerlei Weise und in einer Fülle von Sprachen erreicht, dass selbst die von Glaubenden als unumstößlich heilig empfundenen Antworten beides sind: „sowohl entschieden als auch bedingt, endgültig als auch tastend“ 3. Mehr noch: Pluralismus, Diversität und Differenz sind nicht bloß unvermeidliche Folge der Begrenztheit menschlicher Erkenntnis; sie besitzen göttliche Dignität. Gottes Wahrheit, so Heschel, ist grundsätzlich polyphon: „In diesem Äon ist Vielfalt der Wille Gottes.“4 Eine religiös und kulturell uniforme Gesellschaft wäre hingegen ein Zeichen spiritueller Verarmung.
- Heschel, Abraham J., „Keine Religion ist ein Eiland“, in: Rothschild, Fritz A. (Hg.), Christentum aus jüdischer Sicht. Fünf jüdische Denker des 20. Jahrhunderts über das Christentum und sein Verhältnis zum Judentum (Veröffentlichungen aus dem Institut Kirche und Judentum, Bd. 25), Berlin und Düsseldorf, 1998, 324–341, hier 328.
- Ebd., 339
- Ebd., 335
- Ebd.